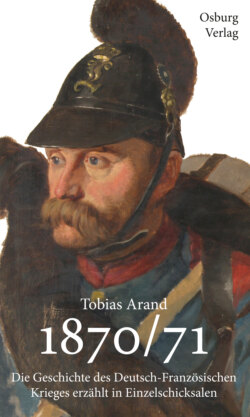Читать книгу 1870/71 - Tobias Arand - Страница 11
Оглавление»Rache für Sadowa« – Der Weg in den Krieg
Die ›Luxemburg-Krise‹
Nach dem Debakel in Mexiko benötigt Napoleon wieder einen außenpolitischen Erfolg. Der Versuch, Luxemburg für Frankreich zu erwerben, endet in einem von Bismarck bereiteten Fiasko.
Luxemburg wird in Personalunion von Wilhelm III., dem König der Niederlande und zugleich Großherzog von Luxemburg, regiert. Anders als die Niederlande ist Luxemburg bis 1866 Teil des ›Deutschen Bundes‹, der dort sogar eine Bundesfestung unterhält. Auch nach der Gründung des ›Norddeutschen Bundes‹, dem Luxemburg nicht beitritt, sind in über 20 Forts mehrere Tausend Mann preußischer Besatzung in der Festung stationiert. Seit 1842 ist Luxemburg obendrein noch Mitglied des Deutschen Zollvereins.
Die ›Luxemburg-Krise‹ ist ein typisches Beispiel für das Spiel mit Menschen und Macht, dem sich die Herrscher und Diplomaten des 19. Jahrhunderts immer wieder hingeben. Kriege sind dabei als mögliche Lösungswege stets vorgesehen. Wie bereits gezeigt, hatte Bismarck vor dem Krieg Preußens und seiner Verbündeten gegen Österreich, Napoleon III. Hoffnungen auf Landerwerb links des Rheins gemacht. Noch vor Abschluss des von Frankreich vermittelten Vorfriedens von Nikolsburg am 26. Juli 1866, der den Waffenstillstand zwischen Österreich und Preußen besiegelt, droht Napoleon die Kontrolle über seine Minister und engsten Berater zu entgleiten. Napoleon will sich mit Preußens Versprechen, die Mainlinie zu respektieren, zufriedengeben. Er hofft, dass die bislang freien deutschen Südstaaten als ›Drittes Deutschland‹ gemeinsam mit Frankreich Preußens Zuwachs eindämmen würden. Doch die Kaiserin und der Kriegsminister raten ihm in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 1866, mit 80 000 Mann den Rhein zu überschreiten, in den Konflikt einzugreifen, um doch noch Landgewinne erzielen zu können. Schließlich kann Napoleon seine Berater und Eugénie mühsam überzeugen, dass der Plan eines Kampfes gegen Preußen und Italien, das zwangsläufig als Verbündeter Preußens ebenfalls betroffen wäre, zu riskant sei. Außerdem erscheint ein weiterer Krieg der französischen Öffentlichkeit als nicht mehr vermittelbar. Die französischen Truppen stehen zum Teil noch in Mexiko. Stattdessen unterstützt Frankreich die Planungen für den Waffenstillstand und den späteren Vertrag von Prag und inszeniert sich so als starker Friedensvermittler. Gleichzeitig stellen französische Diplomaten jedoch, ohne Absprache mit Napoleon, Kompensationswünsche an Preußen. Luxemburg wird immer wieder als Wunsch genannt. Bismarck lehnt im Gefühl des jüngst errungenen Waffenerfolgs gegen Österreich kühl ab, erkennt aber in der Kompensationsfrage das Potenzial für den nächsten, dann entscheidenden Krieg. Der preußische Botschafter in Paris sieht im August 1866 die Zusammenhänge klar. Noch kommt der Krieg um Kompensationen nicht, aber er wird kommen: »Dass der Kaiser Napoleon jetzt gegen uns Krieg beginnen werde, um Kompensation zu erzwingen, ist nicht anzunehmen. Seine Armee ist dazu nicht vorbereitet. Er weiß außerdem, dass er uns dadurch nötigen würde, wider unsere Wünsche und Interessen den Entwicklungsprozess der deutschen Einheit zu beschleunigen […]. Aber kein Einsichtiger verhehlt sich hier, dass die gegenwärtige Konzentration der Kräfte Norddeutschlands in Preußens Hand nur ein erster Schritt ist, welchem die völlige [Einheit] Deutschlands früher oder später umso sicherer nachfolgen muss. […] Die Beendigung dieses unvermeidlichen Entwicklungsprozesses wird erst dasjenige Gleichgewicht herstellen, dessen Europa seit Jahrhunderten entbehrt […]. Für Frankreich würden dadurch reelle Gefahren nicht erwachsen […] wohl aber würde es aufhören, die erste Macht des Kontinents zu sein […] und dies würde die französische Nationaleitelkeit auf das tiefste verletzen.«47
Um die vom preußischen Botschafter herablassend sogenannte ›Nationaleitelkeit‹ der öffentlichen Meinung zu beruhigen, versucht Napoleon 1867 auf einem anderen Weg, seine Kompensation zu erhalten. Luxemburg soll dem niederländischen König abgekauft werden. Bismarck sieht die Chance, Napoleon in eine diplomatische Falle laufen zu lassen. In geheimen Verhandlungen ermuntert Bismarck Napoleon zu Verkaufsgesprächen mit Wilhelm III., besteht aber darauf, offiziell aus dem Spiel gelassen zu werden. In der Zwischenzeit veröffentlicht Bismarck im März 1867 den Wortlaut der bis dahin geheim gehaltenen ›Schutz- und Trutzbündnisse‹ mit den süddeutschen Staaten, um Napoleon und Frankreich deutlich die Grenzen ihrer Kompensationswünsche aufzuzeigen. Als schließlich ein unterschriftsreifer Verkaufsvertrag für Luxemburg vorliegt, instruiert der stets über alles informierte Bismarck Rudolf von Bennigsen, am 1. April 1867 im Norddeutschen Landtag eine parlamentarische Anfrage an ihn, Bismarck, zu stellen. Bennigsen fragt die Regierung in einem abgekarteten Spiel, ob es stimme, dass Frankreich Luxemburg kaufen wolle. Schließlich hat Preußen ein gewisses Mitspracherecht beim Verkauf eines Landes, das Mitglied im Deutschen Zollverein ist. Bismarcks Antwort auf die Anfrage ist eine Ohrfeige für den französischen Kaiser. Er bestätigt, dass die niederländische Regierung kurz zuvor wegen des Verkaufs von Luxemburg bei ihm vorstellig geworden sei. Weiter führt er aus, dem König Wilhelm III. sei dann mitgeteilt worden, »[…] dass die königliche Regierung und ihre Bundesgenossen im Augenblick überhaupt keinen Beruf hätten, sich über diese Frage zu äußern, dass sie Seiner Majestät der Verantwortlichkeit für die eigenen Handlungen selbst überlassen müssten, und dass die königliche Regierung, bevor sie sich über die Frage äußern würde, wenn sie genötigt würde, es zu tun, sich jedenfalls versichern würde, wie die Frage von ihren deutschen Bundesgenossen […] und wie sie von der öffentlichen Meinung in Deutschland […] aufgefasst werden würde.«48 Mit dieser Abfuhr ist der Geheimdiplomat Napoleon bloßgestellt, der nun wie ein ›Krämer‹ wirkt, der kaufen will, was er nicht erkämpfen kann. Auch der niederländische König ist blamiert und die öffentliche Meinung in Deutschland tobt, wie von Bismarck erwünscht. Luxemburg, Heimat vier spätmittelalterlicher römisch-deutscher Kaiser, wird dort keineswegs als Ausland betrachtet. Vielen Patrioten gilt nur der Gedanke an den Verkauf Luxemburgs an die ›welschen‹ Franzosen als Sakrileg. Dem Preußen Bismarck hingegen ist Luxemburg vollständig gleichgültig, er sieht nur den diplomatischen Coup. Der König der Niederlande tritt von dem Geschäft zurück und in Frankreich kocht die Volksseele ebenfalls. Bereits 1867 besteht wegen der Luxemburg-Affäre die Möglichkeit, den von Bismarck für prinzipiell notwendig gehaltenen Krieg herbeizuführen. Die nationalen Emotionen auf beiden Seiten sind stark genug für einen Waffengang. Doch die schon gezeigten inneren Schwierigkeiten im ›Norddeutschen Bund‹ und das 1867 noch nicht gefestigte Verhältnis zu den deutschen Südländern lassen Bismarck zu diesem Zeitpunkt zurückschrecken. Preußens König Wilhelm will ebenfalls keinen Krieg: »Ich tue alles, was möglich ist, um die Kriegsfackel nicht anzuzünden, denn wie nötig haben gerade wir jetzt in Deutschland den Frieden!«49
Auch Napoleon hält seine Armee zu diesem Zeitpunkt für nicht bereit, gegen die nunmehr kampferprobten, selbstgewissen und dank der ›Schutz- und Trutzbündnisse‹ gestärkten Preußen einen Krieg bestehen zu können. Stattdessen wird im Mai 1867 in London ein Vertrag über die Neutralität Luxemburgs geschlossen, der das Scheitern der französischen Ambitionen endgültig besiegelt. Dass nach den Londoner Bestimmungen die alte Bundesfestung geschliffen wird und Preußen seine Besatzung abziehen muss, bemäntelt die Niederlage Napoleons nur unzureichend.
Nach Mexiko und ›Sadowa‹ ist diese Demütigung der letzte Akt in Napoleons Abstieg. Napoleon III. ist jetzt nur noch die Symbolfigur seines Kaiserreichs. Eugénie und ehrgeizige Minister übernehmen die Macht, während der Kaiser lediglich repräsentieren darf. Dazu kommt, dass Napoleon zunehmend weiter körperlich verfällt. Seine Stimme stockt häufig, seine Hände zittern. Blasensteine und Hämorrhoiden quälen Napoleon. Seine kränkliche Blässe übermalt er mit Rouge auf den Wangen. In der Öffentlichkeit hat er kaum noch Rückhalt, woran auch weitere innenpolitische Liberalisierungsmaßnahmen, die in einem letzten Plebiszit im Mai 1870 bestätigt werden, nichts mehr ändern können. Zwar folgt ihm das Volk nach wie vor, vor allem auf dem Land, aber es ist abzusehen, dass es nicht mehr viel bedarf, Napoleon und das Regime zu stürzen.
Napoleon siegt gegen Garibaldi
Einen letzten kleinen militärischen Sieg kann Napoleon 1867 noch erringen, der aber sein Prestige nicht mehr zu retten vermag – zumal dieser Sieg nur das Ergebnis eines vorhergegangenen politischen Scheiterns ist. Ende 1866 hatten sich die französischen Truppen aus Rom und dem Rest des Kirchenstaats zurückgezogen und diesen in den Schutz des jungen italienischen Königreichs gestellt, das die Unabhängigkeit des ›Patrimonium Petri‹ bewahren sollte. Ziel war hierbei die Vermeidung weiteren innenpolitischen Haders über Frankreichs Rolle in Italien, der sich vor allem immer wieder zwischen nationalistischen Kräften und katholischen Ultramontanen entzündete. 1867 fallen jedoch 3000 Freischärler, wegen ihrer roten Blusen ›Rothemden‹ genannt, unter Führung des abenteuerlichen Haudegens und Kämpfers in den italienischen Einheitskriegen, Giuseppe Garibaldi, in den Kirchenstaat ein, um Rom und sein Umland nach Italien ›heimzuholen‹. Das Königreich Italien ignoriert seine vertraglichen Verpflichtungen, sodass Napoleon erneut eine Eingreiftruppe senden muss, obgleich er gehofft hat, den innenpolitischen ›Zankapfel‹ eigentlich los zu sein. Am 3. November 1867 werden die Truppen Garibaldis in der Schlacht von Mentana von französischen und päpstlichen Truppen geschlagen. Napoleon beschließt entgegen den Vereinbarungen des Jahres 1866, bis auf Weiteres französische Regimenter zum Schutz des Papstes im Kirchenstaat stationiert zu halten. Nun hat Napoleon dauerhaften Zwist mit Italien, und die Rom-Frage ist noch immer ungelöst. Hatte der Kaiser 1859 Italiens Einigung mit auf den Weg gebracht, kämpft er jetzt gegen italienische Nationalisten und verrät damit erneut eines der Hauptprinzipien seiner eigenen Ideologie. So trägt letztlich auch dieser Sieg zum Bild einer konfusen Herrschaft in einem System voller Widersprüche und damit zur weiteren Erosion der napoleonischen Macht bei.
Die spanische Thronfolge
Die Gründe für den Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 sind im Kern zwei wesentliche Faktoren. Einmal hält Bismarck noch einen letzten Krieg, der die süddeutschen Staaten an die Seite Preußens zwingt, als unabdingbar für den Abschluss des Einigungsprozesses, wenn dieser so verlaufen wird, wie es sich der preußische Ministerpräsident und Kanzler des ›Norddeutschen Bundes‹ vorstellt. Eine friedliche ›Inbesitznahme‹ des Südens auch gegen den Willen Frankreichs wäre vielleicht in einem längeren Zeitraum denkbar, doch ob sich ebenso die Bewohner Badens, Württembergs oder Bayerns à la longue so einfach würden einfügen lassen, wird im ›Norddeutschen Bund‹ von manchen mit guten Gründen bezweifelt. Im nationalen Taumel sollen Bayern, Norddeutsche, Badener und Württemberger vielmehr gegen den ›alten‹ Feind Frankreich ziehen und dabei willig die Erschaffung eines ›kleindeutschen‹ beziehungsweise großpreußischen Reichs aus dem Geist des gemeinsamen Kampfes vollenden.
Für Napoleon oder besser für seine Entourage, die den Kaiser nur noch als Aushängeschild für ihre eigenen Pläne vorschiebt, sind außenpolitische Erfolge hingegen unabdingbar für den Fortbestand des Regimes. Autoritäre Bonapartisten sehen im Krieg das natürliche Lebenselement eines Staates, der sich auf Napoleon I. bezieht. Gleichzeitig wollen sie mit einem Krieg die liberalen Experimente Napoleons III. unterbrechen. Diese ›Kriegspartei‹ schart sich um die Kaiserin. Eugénie hält ihren kranken Mann zunehmend für regierungsunfähig und ist gleichzeitig bestrebt, dem einzigen gemeinsamen Kind, Napoléon Eugène Louis Bonaparte, genannt ›Lulu‹, den Thron zu erhalten. Den besten Weg hierfür sieht sie in der Verwirklichung einer ›Rache für Sadowa‹ und der Weiterführung eines autoritären Regimes. Napoleons Versuche zur Errichtung eines liberalen Kaisertums hält sie für Zeichen herrscherlicher Schwäche.
Der Anlass für den entscheidenden Krieg, der in dieser Gemengelage von Gründen gefunden wird, ist schließlich aus heutiger Sicht ein Streit von »erhabener Lächerlichkeit«50 um dynastische Empfindlichkeiten, verdrehte Worte und lässliche Unhöflichkeiten. Im Jahre 1870 werden Kriege noch mit Begriffen wie ›Ehre‹ und ›Gloire‹ begründet.
In Spanien wird ein Thronfolger gesucht. Die einstige stolze Kolonialmacht Spanien ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer traurigen Karikatur vergangener Größe herabgesunken. Die Kolonien sind überwiegend verloren, Korruption, Vetternwirtschaft, Thronstreitigkeiten, Bürgerkriege – die sogenannten ›Karlistenkriege‹ – haben Spanien ruiniert und in Anarchie gestürzt. Der überwiegende Teil der Bevölkerung lebt in Armut und ohne Zugang zu ausreichender Bildung, während sich eine kleptokratische Oberschicht ungehemmt bereichert. Im Jahre 1868 kommt es so zu einer Revolution, die von einer bunten Mischung aus Liberalen, Militärs, Progressiven und Republikanern unter Führung des Generals Juan Prim getragen wird. Königin Isabella II. wird abgesetzt und ins Exil geschickt. Bei der darauffolgenden Suche nach einem neuen Staatsoberhaupt fällt die Wahl nach längerem Hin und Her auf den Spross einer katholisch-schwäbischen Seitenlinie des preußischen Herrscherhauses Hohenzollern, auf Leopold Stefan Karl Anton Gustav Eduard Tassilo von Hohenzollern-Sigmaringen. Versuche Frankreichs, in die Frage der Thronregelung mit eigenen Vorschlägen einzugreifen, waren zuvor gescheitert. Der spanische Thron wird Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen gleich dreimal angeboten. Zweimal lehnt Leopold, der mit einer portugiesischen Prinzessin verheiratet ist, ab. Leopold und sein Vater Karl Anton, Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen, fürchten die vorhersehbaren Schwierigkeiten, die mit der Kandidatur verbunden sind. Der 1835 geborene Leopold ist über seine Großmutter Stéphanie de Beauharnais, der Adoptivtochter Napoleons I., eng mit dem Hause Bonaparte verwandt. Die Verwandtschaft mit der preußischen Hohenzollernlinie beschränkt sich hingegen in erster Linie darauf, dass Wilhelm I. von Preußen als Oberhaupt aller Hohenzollern anerkannt wird, obgleich sich beide Linien bereits im Mittelalter getrennt haben. Die Idee, dem eigentlich unwilligen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen den spanischen Thron ein drittes Mal antragen zu lassen, stammt von Bismarck. Über Diplomaten in Madrid lanciert er erfolgreich in geheimen Verhandlungen die Idee eines neuerlichen Versuchs. Die Motive für diesen Schachzug sind unklar und häufig kontrovers diskutiert worden. Sicher fürchtet Bismarck, dass wie zu Zeiten Karls V. das Haus Habsburg auf den spanischen Thron zugreifen könnte, vielleicht will er die katholische Opposition in Deutschland ein wenig besänftigen, indem er einen katholischen Hohenzollern protegiert. Auch einen möglichen Kandidaten aus dem bayerischen Haus Wittelsbach will Bismarck sicher verhindern, könnte doch der süddeutsche Partikularismus durch einen solchen Erfolg Bestätigung finden. Wenn Bismarck 1870 an einen sanften und friedlich-evolutionären Weg zur deutschen Einheit glauben würde, ergäbe der ›spanische Plan‹ mit seiner Kriegsgefahr keinen Sinn. Am wahrscheinlichsten ist es vielmehr, dass Bismarck die Reaktionen auf seine Idee in Frankreich voraussieht und einen ›Casus Belli‹ erzwingen will. Gleichzeitig weiß er um den Einfluss der ›Kriegspartei‹ um Kaiserin Eugénie. Diesen Bellizisten will er einen Kriegsgrund auf dem Silbertablett servieren, bei dem er vermeiden kann, als Aggressor dazustehen. Nur so kann er den Bündnisfall mit den süddeutschen Staaten erzwingen. Anders als 1867 wähnt er Preußen und seine Verbündeten im Jahr 1870 für stark genug, um einen Waffengang zu riskieren. Ein wichtiger Hinweis für die Stichhaltigkeit der Annahme, dass Bismarck die Frage der spanischen Thronfolge wohlkalkuliert als möglichen Kriegsgrund vorangetrieben hat, ist eine Depesche an den Gesandten des ›Norddeutschen Bundes‹ in Sankt Petersburg. Am 9. März 1869 schreibt Bismarck dem Botschafter Prinz Heinrich VII. Reuß zu Köstritz im Zusammenhang mit möglichen preußischen Beistandsplänen im Fall eines russisch-französischen Konflikts in aller Deutlichkeit: »Wir würden dann unsere Beteiligung an der Seite Russland durch eine Haltung und ein Vorgehen herbeizuführen suchen, welches Frankreich zum Angriffe oder zur Bedrohung Deutschlands nötigte. Truppenaufstellungen, nationale Manifestationen in Deutschland und Italien sowie unsere Beziehungen zu Belgien, selbst zu Spanien, würden uns Gelegenheit zu Diversionen bieten, welche unser Eingreifen herbeiführten, ohne demselben gerade die Form eines aggressiven Cabinetskrieges zu geben.«51
Für das in den Jahren 1866 und 1867 gedemütigte Frankreich und seinen kranken Kaiser wirkt die Kandidatur ausgerechnet eines Hohenzollern, auch wenn er überhaupt kein Preuße ist, im südwestlichen Nachbarland Spanien wie ein Affront. Man fühlt sich ein weiteres Mal herabgewürdigt und wähnt sich – nicht ganz frei von Paranoia – im Fall einer Thronannahme durch Deutsche eingekreist. Entsprechend sind die weiteren Folgen. Dazu kommt, dass Frankreich selbst Ambitionen hat, in Spanien in der Thronkandidatenfrage mitzureden. Pläne, einen italienischen Kandidaten, Prinz Amadeus von Savoyen, zu installieren, stoßen auf Ablehnung Frankreichs. Die noch immer ungeklärte Rom-Frage verhindert ein Übereinkommen zwischen Italien und Frankreich. Napoleon bevorzugt den Sohn der gestürzten Isabella als neuen Regenten.
Napoleon III. selbst wird erkannt haben, dass mit der Kandidatur des freundlichen und harmlosen Leopold eigentlich keine Gefahr für Frankreich verbunden ist und kein Grund zur Hysterie besteht. Das Haus Hohenzollern-Sigmaringen ist ihm persönlich vertraut, hatte er in seiner Jugend dort sogar Jagdeinladungen angenommen. Ihm ist bewusst, dass Leopold im heruntergewirtschafteten Spanien andere Sorgen haben würde, als Frankreich zu schaden. Auf den jungen Mann warten keine Ruhmestaten, sondern Prüfungen und Entbehrungen in einem vormodernen, fremden Land voller überkommener Strukturen. In einem Anflug von Zynismus hätte der französische Kaiser sogar sagen können, dass »ein Hohenzoller auf dem spanischen Thron seine ›Rache für Sadowa‹«52 sei. Allein, der Kaiser bestimmt die Politik in der Realität nicht mehr. Die entscheidenden Kräfte sind nun andere. Neben der Kaiserin Eugénie sind dies vor allem Émile Ollivier, seit dem 2. Januar 1870 liberaler Ministerpräsident Frankreichs, und Antoine Alfred Agénor, Duc de Gramont, der konservative Außenminister. Dem Herzog von Gramont, einem backenbärtigen ›Preußenfresser‹ und Günstling der Kaiserin, fehlen alle Voraussetzungen für die Funktion eines Diplomaten. Er ist unbedacht, ungeschickt und aufbrausend. Ollivier, ein etwas zögerlicher Intellektueller mit Nickelbrille, ist von Beruf Anwalt und liberalen Prinzipien verpflichtet, mit denen er das Regime Napoleons von innen reformieren möchte. Er steht an der Spitze des ›Empire libérale‹. Außenpolitisch sucht Ollivier den Ausgleich mit Preußen. Er ist weder Teil der ›Kriegspartei‹ noch des Günstlingskreises um Kaiserin Eugénie.
Die ›Julikrise‹
Bevor Leopold den von der Regierung in Madrid angebotenen Thron übernehmen kann, muss Bismarck noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Leopolds Vater Karl Anton und König Wilhelm I. von Preußen müssen ebenso wie Leopold zuvor ihre Zustimmung geben. Die Bedenken sind nicht unerheblich, ahnen sie doch auch beim dritten Anlauf die Probleme, die da kommen können. Schließlich aber willigen alle nach massivem Druck Bismarcks ein. Dass Wilhelm I. bei der ganzen Sache aber durchaus Bedenken hat, zeigt sein Einwilligungsschreiben vom 21. Juni 1870 an den Thronprätendenten Leopold: »Du hast einen Entschluß gefaßt, den Du früher, nach meiner Überzeugung vollbewußt mit Recht zurückgewiesen hattest. Jetzt findest Du die im Winter d. J. vom Minister Graf Bismarck aufgestellten politischen Ansichten für staatsmännisch berechtigt und unwiderlegbar. Wäre dies von Haus aus meine Auffassung gewesen, so würde ich nicht so entschieden Deine damalige Zurückweisung der spanischen Krone gebilligt haben.«53
Als Leopold nach langem Zögern der spanischen Regierung endlich seine Zusage macht, ist die ›Cortes‹, das Parlament in Madrid, bereits in der Sommerpause. Da aber nur die ›Cortes‹ über die Annahme des Throns durch Leopold entscheiden kann, muss sie erneut einberufen werden. Damit wird außerdem der so lange geheim gehaltene Anlass öffentlich, über den das Parlament abstimmen soll. Die am 3. Juli 1870 öffentlich gewordene Nachricht über die »spanische Bombe«54, wie sich König Wilhelm I. ausdrückt, sorgt in Paris für helle Aufregung. Zwar waren auch den französischen Diplomaten zuvor Gerüchte zugetragen worden, dass Leopold nun tatsächlich annehmen könnte. Über die beiden vorhergegangenen vergeblichen Versuche der Regierung in Madrid, Leopold als König zu gewinnen, war die französische Diplomatie von Anfang an unterrichtet. Doch als der Vorgang bekannt wird, handelt der Herzog von Gramont zielgerichtet im Sinne der ›Kriegspartei‹ am Hof, indem er die Kandidatur zu einem vermeintlichen Skandal stilisiert.
Die ›Bombe‹ platzt in eine friedliche europäische Sommeratmosphäre, die Theodor Fontane anschaulich und mit unnachahmlicher Ironie direkt zu Beginn seiner 1872 verfassten Darstellung des Krieges von 70/71 beschreibt. Theodor Fontane, aus Neuruppin stammender Journalist, Theaterkritiker und Militärschriftsteller mit hugenottischen Wurzeln und Apothekerausbildung, der später mit Gesellschaftsromanen wie ›Effi Briest‹ oder ›Frau Jenny Treibel‹ bekannt werden sollte, schreibt: »Der 1. Juli 1870 sah Europa in tiefem Frieden. Die Empfindung jedes Einzelnen hatte am Tag zuvor noch eine offizielle Bestätigung empfangen. ›Zu keiner Zeit – so etwa lauteten die Worte, mit denen der französische Minister Ollivier vor den gesetzgebenden Körper getreten war – war die Ruhe mehr gesichert, als eben jetzt; wohin man auch blicken mag, nirgends ist eine Frage zu entdecken, die Gefahr in sich bergen könnte.‹ So der Minister. Mit besondrer Genugtuung war dieses offizielle Siegel, das der Großsiegelbewahrer auf den Frieden und damit zugleich auf die Hoffnung jedes Einzelnen drückte, entgegengenommen worden und die vornehme Welt Europas, die distinguirten Träger der ›Gesellschaft‹ eilten in vollkommener Beruhigung ihren bevorzugten Rendez-vous-Plätzen, den deutschen Bädern zu.«55 Auch der preußische König ist seit dem 20. Juni schon im Kururlaub, den er wie stets in Bad Ems verbringt. Fontane schildert die Tage in Ems vor der ›Julikrise‹ als heiteres Idyll. Die oberen Tausend laben sich am heilenden Wasser und genießen die Nähe ihres Königs: »Ueber alle aber kam auf Augenblicke eine Ruhe im Gemüth, wenn die hohe Gestalt König Wilhelms, hinausragend über das Kleine und Krankhafte, grüßend an ihnen vorüberschritt. Glückliche, stille, in ihren Bildern beständig wechselnde Tage. Am Vormittage Revuen und Inspectionen auf Uebungsmärschen befindlicher Regimenter […], am Nachmittage Ouvertüren und Symphonien concertierender Kapellen, am Abend eine Theater-Vorstellung […] und dann zum Schluß ein Feuerwerk: Raketen und Tableaux, ein preußischer Adler in Brillantfeuer und die ganze Herrlichkeit wiedergespiegelt im stillen Wasser der Lahn. Nichts fröhlicher, nichts friedlicher als die Mittsommerzeit der 70er Saison im schönen Ems.«56
Inmitten dieser trügerischen Ruhe wittert Gramont die Chance, Preußen zu erniedrigen und endlich Rache für die Jahre 1866 und 1867 zu nehmen. Sollte es gelingen, Preußen als Drahtzieher hinter Leopolds Kandidatur zu entlarven und gleichzeitig durch Kriegsdrohungen einen Rückzug des Hohenzollers zu bewirken, wäre dies ein Triumph, der das Risiko eines militärischen Konflikts lohnte. Frankreich soll als beleidigte und gekränkte Nation dastehen, deren Ehre nur durch einen würdelosen Rückzug des preußischen Königs wieder herzustellen wäre. Sollte sich Preußen darauf nicht einlassen, stünde der Krieg vor der Tür, den die Bellizisten um die Kaiserin ohnehin wünschen. Gramont sieht sich so in einer Situation, in der er nur gewinnen kann. Ohne Absprache mit dem französischen Generalstab und ohne Abstimmung mit seiner Regierung, aber mit Billigung des kranken, mit Schmerzmitteln sedierten Kaisers, wird Gramont noch am 3. Juli 1870 hektisch aktiv. Baron Henri Mercier de l’Ostende, französischer Botschafter in Madrid, wird aufgefordert, sofort bei der spanischen Regierung gegen die Frankreich beleidigende Kandidatur eines Deutschen zu protestieren. An den Geschäftsträger der französischen Gesandtschaft in Berlin, Georges Le Sourd, geht der Auftrag, rasch auf die preußische Regierung einzuwirken, die Kandidatur nicht weiter zu betreiben. Frankreichs Botschafter in Berlin, Comte Vincent Benedetti, ist schon unterwegs nach Ems, um direkt mit dem König zu verhandeln. Der hagere Diplomat korsischer Herkunft hat bereits große Erfahrung im Ausland gesammelt und gilt als besonnener Mann. Ihm wird ohne eigene Schuld eine Schlüsselrolle beim Kriegsausbruch zufallen. Gleichzeitig lanciert Außenminister Gramont in führenden Zeitungen von Paris Artikel, die seine Sicht der Dinge in die Öffentlichkeit bringen und für die gewünschte Emotionalisierung in Frankreich und Deutschland sorgen. Die deutschen Zeitungen gehen ausführlich auf die Darstellungen ihrer französischen Konkurrenz ein. Auch über die Debatten in der Pariser Kammer wird ausgiebig und wortgenau berichtet. Kritisch äußert sich die konservative ›Kreuzzeitung‹ am 8. Juli darüber, »[…] in welcher thörichten Weise die Pariser officiösen Blätter ihre Verstimmung über die spanische Throncandidatur kundgeben, und wie sie ihre Leser förmlich mit Märchen füttern […]«57. Allerdings vermutet das Blatt ganz zutreffend eine tiefere Absicht: »Dem Kaiserthum kommt die plötzliche Aufstellung der Hohenzollern-Candidatur für den spanischen Thron so gelegen, daß man schon anfängt, die Achseln zu zucken über die maßlos empfindliche Sprache der Regierungsblätter.«58 In den Pariser Zeitungen werden aber nicht nur Vorwürfe gegen Preußen erhoben, auch Forderungen für eine Besänftigung des französischen Zorns werden laut. So schreibt der traditionsreiche ›Moniteur universel‹ am 8. Juli: »Die Frage muß erweitert werden. Das wenigste was uns heute befriedigen kann, wäre die Freiheit der süddeutschen Staaten, die Räumung der Festung Mainz, das Aufgeben jedes militärischen Einflusses jenseits des Mains […].«59 Über die Folgen der Pressearbeit Gramonts kann sich der Pariskorrespondent der ›Kreuzzeitung‹ nur wundern: »Die ganze Wuth ist los, der verhaltene Groll gegen Preußen, der Haß gegen Bismarck, das Alles ist entfesselt; die Blätter läuten Sturm […] während die eigentlichen Säbelrasseler jede Zurückhaltung abgeworfen haben und keinen Preußen mehr ansehen können, ohne herausfordernd die Schnurrbartspitze aufwärts zu drehen. […] Und doch geht die ganze Regierungspresse heute mit einer Wuth gegen Preußen, die durch nichts gerechtfertigt ist. Auch zeigt sie sich ganz schlecht unterrichtet dabei. Zuerst ist der Erbprinz von Hohenzollern gar kein preußischer Prinz […]. Aber mit Tobenden ist nicht zu streiten; ich kann diese Verhältnisse so oft auseinandersetzen wie ich will, es bleibt bei der Bismarckschen Intrigue!«60 Mit einer Rede, die Gramont am 6. Juli 1870 in der gesetzgebenden Kammer hält, heizt der Außenminister die Stimmung gezielt auf. Zuvor hat der Ministerrat eine passende »Konfliktstrategie«61 entwickelt. Er macht die spanische Thronfolge zu einer Frage der nationalen Ehre: »Wir glauben nicht, daß die Achtung vor den Rechten eines Nachbarvolks uns zu dulden verpflichtet, daß eine fremde Macht, indem sie einen ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. setzt, dadurch zu ihrem Vorteil das gegenwärtige Gleichgewicht der Mächte Europas derangieren und so die Interessen und die Ehre Frankreichs gefährden darf.«62 Die Folgen dieser Rede kommentiert die ›Kreuzzeitung‹ spitzzüngig: »Was sich jetzt hier ereignet, muß Ihnen in der Ferne ganz unglaublich scheinen; ich sehe und höre es mit eigenen Augen und kanns kaum glauben. Ists die entsetzliche Hitze, die verwirrend wirkt, mir ists zuweilen, als hätte ich nur Trunkene vor mir! Die Regierung des Volkskaisers ist empört, daß sich Spanien durch Volkswahl einen König geben will, der ihr nicht zu passen scheint! Man schreit über den preußischen Prinzen, aber Prinz Leopold ist kein preußischer Prinz! […] der Herzog von Gramont führte gestern in der Kammer eine so hohe Sprache, daß man wirklich einen verborgenen Grund annehmen muß; denn das, was geschehen ist, kann solchen Ton nicht rechtfertigen.«63 Die ›National-Zeitung‹, Organ der Nationalliberalen, zweifelt fassungslos am Verstand der Franzosen: »Dieses Volk, welches sich so gern der aufgeklärtesten, modernsten Anschauungen rühmt, welches täglich die Volkssouveränität im Mund führt, verirrt sich hier bei der spanischen Thronfrage in den Anschauungen und den Aberglauben der zopfigsten Diplomatie. Da wird von Karl V. gefaselt, von der Wiederherstellung seines Weltreichs, von der Störung des europäischen Gleichgewichts, von der Umschnürung und Erdrückung Frankreichs – und alles das aus keinem weiteren Anlaß, als daß die Rede ist von der Berufung eines geborenen Deutschen auf den spanischen Thron. Leuten, die dergleichen vorbringen, kann es doch nicht von Ferne ernst sein mit ihrem sonstigen demokratischen Wortkram.«64 Gramonts wegweisende Rede vom 6. Juli ist für die ›National-Zeitung‹ nur Ausdruck »der hysterischen Beschaffenheit des französischen Nationaltemperaments, von der wir in den letzten Jahren so häufige Beweise erhielten«65. Bedenkt man die Selbstverständlichkeit, mit der Frankreich noch wenige Jahre zuvor glaubte, der mexikanischen Republik einen österreichischen Prinzen als Kaiser aufdrängen zu dürfen, muss unabhängigen Zeitgenossen die Empörung in Paris in der Tat reichlich heuchlerisch und aufgesetzt erschienen sein.
Bereits am 7. Juli 1870 bereitet Gramont den Krieg vor. An Benedetti geht schriftlich die Mahnung, vom preußischen König eine rasche Antwort zu erhalten: »Wir sind sehr in Eile, weil es einen Vorsprung zu gewinnen gilt für den Fall einer unbefriedigenden Antwort, da ab Samstag die Truppenbewegungen einzuleiten sind, um in 14 Tagen in den Krieg einzutreten […].«66
König Wilhelm von Preußen ist über die Situation sehr verärgert und denkt nicht daran, Gramont willfährig zu sein. Den Vorwurf Gramonts, er habe die Kandidatur Leopolds betrieben und die sich daraus ableitende Forderung, er müsse diesen nun davon abbringen, bringt den ehrfixierten Wilhelm in Rage. Weder hat er Leopold bei der Annahme Druck gemacht, noch sieht er es als seine Aufgabe, bei der Ablehnung Druck auszuüben. Die Erfüllung der Forderungen Gramonts hält er für weit unter der Würde eines Königs von Preußen. Allerdings durchschaut er das Ganze nicht, zürnt zudem Bismarck und will auf keinen Fall Grund für einen weiteren Krieg sein. Am 8. Juli äußert sich der König in einem Gespräch mit dem preußischen Militärattaché in Paris, Alfred Graf von Waldersee, erregt: »Wir befinden uns mit einem Male inmitten einer sehr ernsten Situation […]. Ich verdanke das jedenfalls Bismarck, der die Sache auf die leichte Achsel genommen hat, wie schon so manch andere. Zunächst kann ich mich gar nicht dareinmischen, ich halte meinen anfänglichen und korrekten Standpunkt fest. […] Niemals habe ich mit jemandem direkt oder offiziell verhandelt und mich auch zu nichts verpflichtet. Ich kann die französische Regierung nur an den Fürsten Hohenzollern weisen und werde auf diesen keinerlei Einfluß ausüben […]. Daß ich in meinem hohen Alter nicht den Wunsch habe, noch einen so großen Krieg zu führen und so ernste Verwicklungen nicht leichtfertig herbeigeführt habe, das wird die Welt mir wohl glauben.«67 Auch der preußische Botschafter in Paris, Karl Freiherr von Werther, der mit Gramont auf gutem Fuß steht und die spanische Thronkandidatur offen für einen Fehler hält, warnt den französischen Außenminister vor der Wut seines Königs. Als Gramont Werther am 12. Juli bittet, König Wilhelm um ein Schreiben anzugehen, in dem dieser versichert, nie etwas gegen Frankreichs Interessen geplant zu haben, bekommt er einen deutlichen Hinweis auf die Stimmung des alten Königs. Werther berichtet Wilhelm schriftlich von seinem Gespräch mit Gramont: »Ich habe den Herzog von Gramont bemerkt, daß ein solcher Schritt ungemein durch seine am 6. des Monats in der Deputiertenkammer gegebene Erklärung erschwert würde; es kämen da Andeutungen vor, die E[ure] K[önigliche] M[ajestät] hätten tief beleidigen müssen.«68 Daneben drängt Werther, zum Ärger Bismarcks, den König, alles für den Erhalt des Friedens zu tun.
Mittlerweile hat man auch in Madrid verstanden, in was für ein Spiel man da geraten ist. Nun wünscht man ebenfalls dort den Verzicht Leopolds. Gramonts Weisungen an Benedetti in Bad Ems werden indessen immer drängender. Der Herzog will den Krieg vorbereitet haben, bevor Preußen so weit ist. Am 10. Juli schreibt er an Benedetti: »Sie müssen alle Ihre Kräfte einsetzen, um eine entschiedene Antwort zu erhalten; denn wir können nicht warten angesichts der Gefahr, daß Preußen unseren Vorbereitungen zuvorkommt. Der Tag darf nicht zu Ende gehen, ohne daß wir beginnen. Ich weiß aus sicherer Quelle, daß in Madrid der Regent den Verzicht des Prinzen von Hohenzollern wünscht.«69 Ebenfalls am 10. Juli sendet König Wilhelm an Karl Anton dann doch die verklausulierte Bitte, Leopold zum Verzicht zu bewegen. Der König wünscht ehrlichen Herzens keinen Krieg: »Die Kriegsrüstungen im größten Maßstabe in Frankreich sind im Gange, wie Du sehen wirst. Die Lage ist also mehr wie ernst. Ebensowenig wie ich Deinem Sohn meinen Befehl zur Annahme der Krone geben konnte, kann ich jetzt meinen Befehl zur Zurücknahme seines Entschlusses geben. Faßt er diesen Entschluss jedoch, so wird mein ›Einverstanden‹ wiederum nicht fehlen. – Das Französische Ministerium (ob der Kaiser, ist mir unklar) vor allem Gramont will den Krieg und hat es ausgesprochen, daß Spanien hors de ligne, nur Preußen soll bekriegt werden. Es grenzt an Wahnsinn […].«70 An seine Frau schreibt der König am 11. Juli: »Gott gebe, daß die Hohenzollern ein Einsehen haben.«71
Am 12. Juli erklärt Karl Anton für seinen Sohn den Verzicht auf den spanischen Thron. Leopold ist gerade auf einer Wandertour in den Alpen und mitten in der größten Krise des Kontinents, die sich schließlich um seine Person dreht, nicht erreichbar! König Wilhelm schreibt der Königin Augusta: »Mir ist ein Stein vom Herzen!«72
Mit dem erklärten Verzicht Leopolds auf den spanischen Thron hat Gramont seinen ersehnten außenpolitischen Erfolg. Nur seinen Krieg hat er nicht. An diesem Punkt hätte Bismarcks Plan scheitern können, doch der Krieg ist noch immer auch der Wille Gramonts und von Teilen der französischen Regierung. Selbst der sonst eher besonnene Ollivier glaubt nicht mehr, angesichts der bizarr erregten Stimmung in Frankreich, namentlich in Paris, der Öffentlichkeit nur den Thronverzicht als Siegespreis anbieten zu können. Dabei hat gerade Regierungschef Ollivier Mitschuld an der völlig überhitzten Situation. Schließlich wollte oder konnte er Gramont zuvor nicht in seinem für das Kaiserreich letztlich tödlichen Furor gegen Preußen und seinen alten König stoppen. Die ›National-Zeitung‹ ahnt diese Entwicklung bereits in der Ausgabe vom 12. Juli: »Inzwischen meldet eine Depesche aus Sigmaringen […], daß der Prinz Leopold unter den obwaltenden Verhältnissen auf die spanische Krone zu verzichten entschlossen ist. Es dürfte also für den Augenblick der Friede erhalten bleiben; doch ist leider zu besorgen, daß bei den Gesinnungen Frankreichs, die bei dieser Gelegenheit zu Tage gekommen sind, der Hochmuth durch einen solchen Erfolg nur gesteigert, und eine schließliche kriegerische Lösung nur vertagt werden wird.«73
Bismarck, der bisher die ganze Entwicklung von seinem Gut Varzin in Hinterpommern aus verfolgt hatte, ist wütend auf seinen König und dessen Rückzieher, den er als Blamage wertet. Gramonts Kriegsbereitschaft ist Bismarck bewusst, aber eine Garantie für den Krieg hat der Kanzler nicht. Er beschließt nun am 12. Juli, nach Berlin zu reisen und die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Bismarck hält es wieder für an der Zeit, einen seiner gefürchteten melodramatischen Auftritte hinzulegen. Unter Androhung seines Rücktritts verlangt er die Einberufung des Norddeutschen Reichstags, um dort eine Brandrede gegen Frankreich und indirekt auch gegen seinen, wie er meint, zu laschen König halten zu können. Gleichzeitig trifft sich Bismarck mit den beiden wichtigsten Militärs in Preußen, mit Kriegsminister Roon und dem Chef des Generalstabs, Moltke. Moltke und Roon sind, anders als ihr König, unglücklich über die Wendung, die das Ganze genommen hat. Bismarck berichtete später über Moltke: »Ich erinnere mich, wie er, als die spanische Frage brennend wurde, gleich zehn Jahre jünger aussah. Dann, wie ich ihm sagte, der Hohenzoller habe verzichtet, wurde er sofort alt und müde.«74 Der ersehnte Krieg scheint Roon und Moltke doch noch zu entgleiten.
Doch die Sorgen der drei kommenden Kriegslenker, deren Denkmäler bis heute nördlich der Berliner Siegessäule von der nach 1871 überbordenden Heldenverehrung für die Trias ›Bismarck–Roon–Moltke‹ künden, sind grundlos. Der französische Außenminister kommt ihnen in seinem Ungeschick und seiner Erregung zu Hilfe. Denn nun verlangt Gramont von Wilhelm I. auch noch eine in der Tat ehrverletzende Erklärung. Der König soll versichern, dass nie wieder ein Hohenzoller den spanischen Thron erstreben würde. Benedetti soll vom König persönlich eine solche Erklärung erwirken, die Gramont dann der Kammer in Paris vorlesen möchte. Dem König, der sich so friedensbereit gezeigt hatte und sich nicht in der Rolle sieht, seiner Verwandtschaft in Schwaben kleinlich-anmaßende Vorschriften zu machen, hat für diese weitere Forderung keinerlei Verständnis – zumal er noch immer auf dem Standpunkt steht, dass er ja eigentlich ohnehin nichts mit der ganzen Sache zu schaffen habe.
Am 13. Juli 1870 kommt es schließlich morgens zum entscheidenden Vorfall auf der Promenade von Bad Ems. Bis heute erinnert dort ein Gedenkstein an das Zusammentreffen des Königs mit dem Grafen Benedetti. Benedetti fängt den in Zivil promenierenden König ab und bedrängt ihn wortreich und immer nachdrücklicher, die von Gramont gewünschte Erklärung abzugeben. Der stets auf Form und Würde bedachte Wilhelm ist über das unkonventionelle Vorgehen Benedettis empört, lässt sich aber herab, mit ihm zu sprechen. Den Inhalt und Charakter des Gesprächs teilt er am Nachmittag des Tages seiner Gattin Augusta sichtlich indigniert brieflich mit: »Das große Ereigniß der Tagesfrage ist das alleinige Gespräch, seitdem an diesem Morgen das Cölner Extra Blatt die erste Kunde des Zurücktritts des Thron Candidaten brachte; ich sendete dasselbe sofort auch Benedetti, der mir sagen ließ, daß er die Nachricht bereits gestern Abend aus Paris erhalten hätte. Woraus folgt, daß man es in Paris früher wußte als ich. Er kam auf die Promenade und statt ihn satisfait zu finden, verlangte er von mir, daß ich tout jamais erklären sollte, daß ich nie wieder meine Zustimmung geben würde, wenn etwa diese Candidatur wieder auflebe, was ich natürlich sehr entschieden zurückwies, um so mehr da ich noch keine détails erhalten hätte, und als er immer dringender und fast impertinent wurde, sagte ich zuletzt, mettons que Votre Empereur lui même diese Candidatur aufnähme, so würde ich ja mit meinem geforderten Versprechen ihm entgegentreten müssen! Kurzum: er schien instruiert zu sein, diese Forderung mir abzupressen, die er sogleich nach Paris melden wollte, um mich zu irgend einer officiellen Kundgebung zu veranlassen, die ich bei der ganzen Sache bisher zu vermeiden hatte, aus der bekannten Stellung, die [ich] zu derselben 6 Wochen einzunehmen verpflichtet bin, D. h. als Gouvernement habe ich mit der ganzen Sache nichts zu thun.«75 Der König beschließt nun auf den Rat des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg und seinen Beraters, des Geheimen Legationsrats Heinrich Abekens hin, Benedetti nicht mehr zu empfangen. Aus seiner Sicht ist alles gesagt, die Franzosen haben doch ihren Willen erhalten!
Um 13 Uhr empfängt der König endlich eine Kopie der Verzichtserklärung Karl Antons und schickt auch diese, wie schon zuvor die Zeitungsmeldung, an Benedetti. Eine neuerliche Bitte Benedettis auf Audienz weist der König zurück, jedoch nicht, ohne dem Botschafter versöhnliche Worte zu senden. Über seinen Flügeladjutanten lässt der König Benedetti ein kleines Zugeständnis mitteilen, das die französische Seite jedoch nicht mehr zu beruhigen vermag. Benedetti berichtet noch am 13. Juli an Gramont: »[…] daß Se. Majestät keine Schwierigkeiten sehe, mir die Mitteilung zu erlauben, daß er den Rücktritt des Prinzen Leopold gebilligt habe.«76 Wieder hat Benedetti ein Telegramm Gramonts erhalten, dessen neuerliche Forderungen auch mit dem neuen Zugeständnis des Königs nicht zu befriedigen wäre. Benedetti bittet ein drittes Mal um ein weiteres Treffen, erhält aber erneut über den Flügeladjutanten Prinz Radziwill eine Abfuhr.
Nun weist der König seinen Berater in Bad Ems, den Geheimen Legationsrat Heinrich Abeken, an, ebenfalls Bismarck über die Vorgänge zu informieren. Ob willentlich oder nicht, setzt der König nun den letzten bedeutsamen Zug im diplomatischen Spiel in Gang. Das folgende Telegramm gibt den entscheidenden Stoß in Richtung Krieg. Abeken schreibt einen dreiteiligen, verschachtelten Bericht. Im ersten Teil gibt er eine Nachricht wieder, die der König ihm nach dem Treffen auf der Promenade gesendet hat: »Seine Majestät der König schreibt mir: ›Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir zu verlangen, ich solle ihn autorisieren, sofort zu telegraphieren, daß ich für alle Zukunft mich verpflichte, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Candidatur zurückkämen. Ich wies ihn, zuletzt etwas ernst, zurück, da man tout jamais dergleichen Engagements nicht nehmen dürfe noch könne. Natürlich sagte ich ihm, daß ich noch nichts erhalten hätte und da er über Paris und Madrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsähe, daß mein Gouvernement wiederum außer Spiel sei.‹«77 Im zweiten Teil referiert Abeken den weiteren Gang der Ereignisse nach dem vom König geschilderten Zwischenfall: »Seine Majestät hat seitdem ein Schreiben des Fürsten78 bekommen. Da seine Majestät dem Grafen Benedetti gesagt, daß er Nachricht vom Fürsten erwarte, hat Allerhöchstderselbe mit Rücksicht auf die obige Zumuthung, auf des Grafen Eulenburg und meinen Vortrag beschlossen, den Grafen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern ihm nur durch einen Adjutanten sagen zu lassen: daß Seine Majestät jetzt vom Fürsten die Bestätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti aus Paris schon gehabt, und dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe.«79 Im dritten Teil kommt die eigentlich interessante Botschaft. Der König ermächtigt Bismarck, den Vorgang öffentlich zu machen: »Seine Majestät stellt Eurer Excellenz anheim, ob nicht die neue Forderung Benedetti’s und ihre Zurückweisung sogleich, sowohl unseren Gesandten, als in der Presse mitgetheilt werden sollte.«80 Ahnt der König nicht, dass eine Veröffentlichung des Vorgangs seine Friedenspläne durchkreuzen könnte? Will er einer entehrenden französischen Darstellung zuvorkommen? Wie auch immer, Bismarck weiß sofort, was zu tun ist. Das Telegramm wird um 15.10 Uhr an Bismarck versendet, trifft um 18.09 Uhr in Berlin ein und ist bis etwa 20 Uhr entziffert. Es erreicht Bismarck beim Abendessen mit den dumpf vor sich hinbrütenden Roon und Moltke. Bismarck überarbeitet und kürzt das Telegramm und sendet es um 23.15 Uhr an die preußischen Gesandten in den deutschen Ländern, um 2.30 Uhr des 14. Juli geht die als ›Emser Depesche‹ berühmt gewordene Bismarck-Fassung des Abeken-Telegramms auch noch an die preußischen Botschafter im Ausland. Die ›Norddeutsche Allgemeine Zeitung‹ veröffentlicht es als erstes Presseorgan schon in der Zehn-Uhr-Abendausgabe des 13. Juli 1870. Bismarcks Änderungen und Kürzungen führen zu einer keineswegs fehlerhaften Darstellung, er spitzt die Ereignisse allerdings in einer Weise zu, die bewusst provokant angelegt ist. Im Mittelpunkt steht nun die königliche Weigerung, Benedetti erneut zu treffen und weitere Garantien abzugeben: »Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der Kaiserlich Französischen Regierung von der Königl. Spanischen amtlich mitgetheilt worden sind, hat der Französische Botschafter in Ems an S. Maj. den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisiren, daß er nach Paris telegraphire, daß S. Maj. der König sich verpflichte, niemals wieder Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurückkommen sollten. Seine Maj. der König hat es darauf abgelehnt, den Franz. Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, daß S. Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzutheilen habe.«81 In dieser Version der Ereignisse steht Benedetti wie ein begossener Pudel da, ohne Garantie, vom König stehen gelassen. In der späteren Zeugenschaft Bismarcks soll Moltke nach Lektüre des redigierten Telegramms gesagt haben: »So hat das einen anderen Klang, vorher klang es wie Chamade82, jetzt wie eine Fanfare in Antwort auf eine Herausforderung.«83
Die erste Zeitung in Frankreich, die Bismarcks Version des Telegramms veröffentlicht, ist der ›Soir‹, der für seine Sensations- und Skandalmeldungen bekannt ist. Der ›Soir‹ bringt die ›Emser Depesche‹ am 14. Juli um 18.30 Uhr. Allerdings bleibt die Wirkung zuerst bescheiden, da Bismarck nicht eindeutig als Urheber benannt wird. Eine erhebliche Steigerung der ohnehin großen öffentlichen Erregung ist durch die ›Emser Depesche‹ jedenfalls nicht nachzuweisen. Bedeutsamer ist die Depesche für die Gespräche des französischen Ministerrats, die ebenfalls am 14. Juli stattfinden. Hier haben alle Beteiligten die Darstellung in der ›Norddeutschen Allgemeinen Zeitung‹ vor Augen. Der 14. Juli, ohnehin als Tag des ›Sturms auf die Bastille‹ von 1789 symbolhaft aufgeladen, verläuft in Paris wechselhaft.
Der Ministerrat, der sich am 14. Juli mittags unter Vorsitz des Kaisers in den Tuilerien trifft, steht unter dem Druck der von Gramont entfesselten öffentlichen Meinung. Vor der Deputiertenkammer und den Ministerien tobt die erregte Meute. Nicht alle Minister sind mit Gramonts Forderungen nach Garantien einverstanden, umso mehr als der forsche Herzog sie nicht zuvor um Rat gefragt hat. Bereits am Vortag hat es erregte Diskussionen unter den Ministern wegen dieser Frage gegeben. Ollivier versucht, die Emotionen zu glätten. Kriegsminister Edmond Le Boeuf, ein vollbärtiger Held aus den Kriegen gegen Russland und Österreich, hingegen drängt zur Eile und fürchtet jede Verzögerung bei der bereits begonnenen Mobilisation. Der Kaiser, von akuten Blasenkoliken geschwächt, wünscht keinen Krieg, sondern schlägt eine internationale Konferenz zur Beilegung des Konflikts vor. Nach der ersten Sitzung des Ministerrats wird dieser Vorschlag angenommen. Am Abend wird der Ministerrat jedoch erneut zusammengerufen. In der Zwischenzeit haben Eugénie und der aufgebrachte Le Boeuf auf den Kaiser eingewirkt. Kaiserin Eugénie äußert sich später über ihre Rolle: »Zurückweichen, mit sich reden lassen, wir konnten es nicht; das ganze Land wäre wider uns aufgestanden. […] Wir konnten das Kaiserreich keinem zweiten Sadowa aussetzen, es hätte das nicht mehr ausgehalten.«84 Der Kaiser lässt nun die Idee einer Konferenz fallen, stattdessen wird nach Le Boeufs Drängen beschlossen, die Reserve zu mobilisieren, was schon beinahe eine Kriegserklärung bedeutet. Der Kriegsminister möchte sich seinen kommoden Vorsprung in den militärischen Vorbereitungen vor den noch untätigen Preußen nicht nehmen lassen. Dazu kommt im Ministerrat die, wie sich zeigen wird, völlig überzogene Vorstellung, über eine ohnehin unschlagbare Armee zu verfügen und so ein überschaubares Risiko einzugehen. Am nächsten Tag soll die Kammer einberufen werden, die über die offizielle Kriegserklärung entscheiden muss. Ollivier wird dort die Absicht des Ministerrats erklären und um Zustimmung und die Gewährung der Kriegskredite bitten.
Auch an diesem Tag ist die Stimmung in Paris aufgeheizt, wie Theodor Fontane beschreibt: »Mit verschwindenden Ausnahmen (einige Jünger der Internationale und der europäischen Friedensliga trugen rothe Laternen und wagten den lebensgefährlichen Ruf ›Vive la Prusse‹) war Paris einem chauvinistischen Rausch hingegeben. Zahllose Banden, von denen manche über tausend Köpfe stark waren, oft von Soldaten geführt und mit der dreifarbigen Fahne vorauf, durchzogen unter dem beständigen Rufen: ›Es lebe der Krieg! Nieder mit Bismarck!‹ die Straßen; andere Tausende, die ihnen begegneten, schlossen sich an, klatschten Beifall oder stimmten in die Marseillaise mit ein. Die Polizei ließ Alles gewähren. […] dann wurden Fackeln herbeigeholt, Andere zündeten Straßenbesen an, und diese schwingend und in die Bäume schleudernd (so daß einige Boulevard-Platanen an zu brennen fingen) kehrten die Trunkenen mit dem Morgengrauen heim.«85 In der Pariser Deputiertenkammer geht es ähnlich erregt zu. Keineswegs alle Abgeordneten sehen im Emser Vorgang einen Kriegsgrund. Ollivier gerät in eine heftige Debatte, in der vor allem Politiker der Linken scharfe Kritik an der Regierung üben. Die deutlichste Rede, immer wieder unterbrochen von stürmischen Zwischenrufen, führt jedoch kein Linker, sondern Adolphe Thiers. Der gelernte Historiker ist sicher einer der interessantesten und ambivalentesten französischen Politiker seiner Zeit. Auf der einen Seite konservativ-katholisch, Gegner des allgemeinen Wahlrechts und der Linken, Monarchist, auf der anderen Seite bis 1863 als Gegner Napoleons III. im Exil, danach Führer der liberalen Opposition, ist Thiers politisch nur schwer zu greifen. In der Kammer erklärt er, dass dieser Krieg aus den falschen Gründen geführt und ohne Rückhalt in Europa in einem Desaster für Frankreich enden werde: »Sie hatten die Hauptsache erreicht, und ein bedeutender moralischer Eindruck war erreicht. Aber, sagt man, die Kandidatur war nicht auf alle Zeiten beseitigt. Ich lege Berufung an den gesunden Menschenverstand und an das, was auf der Hand liegt: Sie werden in einigen Tagen das Urteil der ganzen Welt über ihre Politik vor Augen haben, Sie werden es in allen Blättern lesen. […] Ich sage also: es ist eine beklagenswerte Sache, daß, da die Interessen Frankreichs gesichert waren, man durch Aufreizung im Lande den Krieg unvermeidlich gemacht hat (Lärm). Man hat sich in Etikettenfragen gestürzt und der Stolz der beiden Länder ist aufeinander gestoßen. Ich will diese Tribüne nicht verlassen unter der Ermüdung, die Sie mir verursachen, indem Sie mich nicht hören wollen. Ich habe jedoch bewiesen, daß die Interessen Frankreichs sichergestellt waren und daß Sie Empfindungen geschaffen haben, woraus der Krieg hervorgegangen ist. Das ist ihr Fehler (Lärm).«86 Ollivier antwortet Thiers nur knapp: »Wir haben stets die Leiden, welche ein Krieg mit sich bringt, vor Augen gehabt, auch halten wir diejenigen für strafbar, die das Land in Abenteuer stürzen. Aber wir erklären, daß, wenn jemals ein Krieg notwendig war, so ist es der Krieg, zu welchem uns Preußen zwingt.«87 Damit ist der Krieg zwar noch nicht auf dem Papier, aber faktisch erklärt. Die Regierung gewinnt die Abstimmung über die Kriegskredite mit 245 gegen zehn Stimmen. Auch der Senat stimmt für den Krieg. Am 16. Juli vermeldet eine Delegation der gesetzgebenden Kammer und des Senats dem in seinem Schloss St. Cloud bei Paris weilenden Kaiser das Ergebnis. Napoleon dankt in einer Rede voller Selbstbetrug und Pathos: »Ich empfinde eine hohe Befriedigung am Vorabend meines Abgangs zur Armee, Ihnen für die patriotische Unterstützung, welche Sie meiner Regierung gewährt haben, zu danken. Ein Krieg ist legitim, wenn er mit der Zustimmung des Landes und der Bewilligung seiner Vertreter geführt wird. Sie haben recht, an die Worte Montesquieus zu erinnern: ›Der wahre Urheber des Krieges ist nicht der, welcher ihn erklärt, sondern der, welcher ihn notwendig macht.‹ Wir haben alles, was von uns abhing, getan, um ihn zu vermeiden, und ich kann sagen, daß es das ganze Volk ist, welches unter seinem unwiderstehlichen Drange unsere Beschlüsse diktiert hat. […] Entschlossen, mit Tatkraft die große mir anvertraute Mission zu erfüllen, habe ich den Glauben an den Erfolg unserer Waffen, denn ich weiß, daß Frankreich hinter mir steht und daß Gott Frankreich beschützt.«88 Doch anders als er es den Deputierten mitteilt, ist Napoleon weder tatkräftig noch vom Erfolg des Krieges überzeugt. Er weiß, dass eine Niederlage das Ende seiner Herrschaft bedeutet. Von schweren Koliken geplagt, kann sich der bedauernswerte Kaiser kaum aufrecht halten. Schmerzmittel rauben ihm die geistige Klarheit, die er gerade jetzt dringend benötigt und eine peinliche Blasenschwäche wird durch in seine Uniformhose gestopfte Servietten für jeden sichtbar. Dieser Kaiser hat keine Ausstrahlung und keine Autorität mehr. Zudem haben die jahrelange Günstlingswirtschaft und Korruption verhindert, dass er jetzt von wirklich fähigen Leuten beraten werden kann.
In den Tagen der sich verschärfenden Krise beginnt auch die deutsche Presse, die anfänglich etwas herablassend geschilderten Ereignisse mit Sorge und Abwehr zu kommentieren. Der Leitartikel der ›Kreuzzeitung‹ vom 13. Juli lässt an der deutschen Kampfbereitschaft keinen Zweifel: »Wir bramarbasieren nicht wie die Herren in Paris; wir halten uns den Kopf kühl; wir suchen keinen Händel. Aber wer Händel mit uns vom Zaun bricht, – er wird uns bereit finden zu energischer Abwehr.«89 Bezeichnet die ›Kreuzzeitung‹ einen denkbaren Krieg am 14. Juli noch als eine »Katastrophe«90, so hat sich die Haltung unter dem Eindruck der ›Emser Depesche‹ auch in Deutschland etwas gewandelt. Nun betrachtet ebenso Deutschland den Konflikt als eine Ehrensache. Am 16. Juli betont die ›Kreuzzeitung‹, »[…] daß der französische Botschafter die Regeln des diplomatischen Verkehrs dabei so weit außer Augen gesetzt hat, daß er sich nicht enthielt, den König in der Badekur zu stören, ihn auf der Promenade über die Angelegenheit zu interpellieren und ihm Erklärungen abringen zu wollen. […].«91 Einen Tag später, noch vor der offiziellen französischen Kriegserklärung, ist für die deutsche Presse die Entscheidung bereits gefallen. Die Meinung der ›Kreuzzeitung‹ steht in direktem Widerspruch zur Antwort Olliviers an Thiers in der Pariser Kammer: »Der Würfel ist geworfen – er wird fallen nach Gottes Willen Rathschluß. Frankreichs Uebermuth hat uns wirklich den Krieg erklärt – ein Krieg so ohne allen Grund, so frech hervorgerufen wie kaum irgend ein Krieg.«92
König Wilhelm reist am 15. Juli frühmorgens aus Bad Ems ab, um sich in Berlin der weiteren Entwicklung zu stellen. Am Vortag hatte er sich noch am Bahnhof des Kurorts von Benedetti verabschiedet und diesem wiederum bekräftigt, dass es nichts mehr zu besprechen gäbe. Als der preußische König in Berlin ankommt, eilen ihm schon Berichte über Benedettis Verhalten und die französischen Forderungen voraus. In Brandenburg erwarten der Kronprinz, Bismarck, Moltke und Roon ihren König, dessen Zug um Viertel vor neun abends in den Potsdamer Bahnhof einrollt. Dort besteigt er eine Kutsche und fährt von den Massen bejubelt in einer Art von Triumphzug durchs Brandenburger Tor, über die Prachtstraße ›Unter den Linden‹ zum königlichen Schloss. Ganz Berlin ist auf den Beinen. Bereits in den Bahnhöfen von Kassel, Göttingen und Magdeburg hatte der König kurze Reden vor patriotisch gesinnten Mengen halten müssen. ›Unter den Linden‹ werden Unterschriften für Petitionen an den König gesammelt, immer wieder werden das ›Preußenlied‹ und die dem König bis dahin unbekannte ›Wacht am Rhein‹ angestimmt. Mehrmals muss sich der König unter dem Jubel der Bevölkerung am Fenster zeigen. Am 16. Juli beschreibt die ›Kreuzzeitung‹ die Stimmung dieses Tages: »Die Stimmung in Berlin ist allgemein eine freudig erregte über die Abweisung, welche Sr. M. der König dem Grafen Benedetti hat angedeihen lassen.«93 Auch der Kronprinz Friedrich Wilhelm lässt die bewegten Ereignisse des 15. Juli in seinem Tagebuch Revue passieren: »Telegramm von Bismarck, er führe S. M. bis Brandenburg gleichzeitig mit Moltke und Roon entgegen; ich in Wildpark eingestiegen und mit. Bismarck unterwegs […] ruhiger Vortrag über die Situation, die immer ernster wird, so daß kaum Aussicht auf Beilegung; er sprach endlich einmal ohne Zooten [sic!] und Zynismen. S. M. sehr erstaunt, uns in Brandenburg zu finden. Bismarck wiederholt seinen vorher gehaltenen Vortrag. Bei Ankunft in Berlin Nachricht p. telegr. daß Ollivier den Krieg in einer Rede verkündet habe. S. M. will die rheinische Armeekorps zunächst mobilisieren, ich aber dringe auf Mobilisierung der gesamten Armee, Landwehr und Marine, was S. M. auf dem provisorischen Eisenb. Hof auch noch befiehlt. Begeisterter Empfang in den Straßen vor dem Palais.«94 Dem nüchternen König ist die nationale Begeisterung bei seiner Rückkehr nach Berlin hingegen eher unheimlich. Der Königin vertraut er brieflich an: »Mich erfüllt eine komplette Angst bei diesem Enthusiasmus.«95
In der Nacht vom 15. zum 16. Juli geht nicht nur die preußische Mobilmachungsordre an alle Standorte hinaus, König Wilhelm telegrafiert auch an Königin Augusta, die sich in Koblenz aufhält, und unterrichtet sie über die neueste Entwicklung. Diese praktische Frau fällt nicht in den patriotischen Jubel ein, sondern unternimmt erste, wichtige Schritte, um für die unvermeidlichen Nöte eines Krieges vorbereitet zu sein. Sie schreibt ihrem Mann am 16. Juli: »Um Mitternacht habe ich Dein Telegramm erhalten! So ist nun alles entschieden und das Verhängnis da, denn bei allem Aufschwung des Patriotismus ist das Los der Opfer des Kriegs wahrlich entsetzlich! […] Ich habe heute sofort Versammlung des hiesigen Hilfsvereins und des vaterländischen Frauenvereins. Du siehst, daß wir hier nicht untätig sind. Aber auch schon in den nächsten Tagen kann unsere Grenze überschritten sein, und die Kopflosigkeit könnte sich dann leicht einstellen.«96 Hilfsund Frauenvereine werden in ganz Deutschland in den kommenden Monaten einen großen Teil der Verwundetenversorgung übernehmen.
Augusta und Wilhelm schreiben sich täglich, wobei die Königin die politischen Ereignisse weiter meinungsfreudig kommentiert. Am 17. Juli fragt sie Wilhelm schnippisch, die Lächerlichkeit des Ganzen aber gut treffend: »Ist denn der spanische Thronkandidat von seiner anmutigen Alpenreise endlich heimgekehrt?«97
Am 19. Juli, dem Todestag der in Preußen wie eine Heilige verehrten Königin Luise, Mutter Wilhelms I., wird der Norddeutsche Reichstag versammelt. Eine von Johannes von Miquel vorbereitete Adresse des Reichstags an den König wird verabschiedet. Pathetisch heißt es dort: »Wir vertrauen auf Gott, der den blutigen Frevel straft. Von den Ufern des Meeres bis zum Fuße der Alpen hat das Volk sich auf den Ruf seiner einmütig zusammenstehenden Fürsten erhoben. Kein Opfer ist ihm zu schwer. Die öffentliche Stimme der zivilisierten Welt erkennt die Gerechtigkeit unserer Sache. Befreundete Nationen sehen in unserem Siege die Befreiung von dem auch auf ihnen lastenden Drucke Bonapartischer Herrschsucht und Sühne des auch an ihnen verübten Unrechts. Das deutsche Volk aber wird endlich auf der behaupteten Wahlstatt den von allen Völkern geachteten Boden friedlicher und freier Einigung finden. Ew. Majestät und die verbündeten deutschen Regierungen sehen uns wie unsere Brüder im Süden bereit. Es gilt unsere Ehre und unsere Freiheit.«98 Am 20. Juli bewilligt der Norddeutsche Reichstag umfangreiche Kriegskredite in Höhe von 120 000 000 Talern. Lediglich die sozialdemokratischen Abgeordneten August Bebel und Wilhelm Liebknecht enthalten sich der Stimme. Am 19. Juli war auch die offizielle Kriegserklärung Frankreichs als formal korrekter Nachklang der informellen Erklärung Olliviers vom 15. Juli in Berlin eingetroffen. In diesem von Le Sourd unterschriebenen Dokument werden wiederum alle schon bekannten Vorwürfe gebündelt. Als eigentlicher Kriegsgrund wird in gewundenen Worten die ›Emser Depesche‹ vorgeschoben. In plumper Wahrheitswidrigkeit wird der Sigmaringer Leopold auch hier noch als ›preußischer Prinz‹ bezeichnet: »Die Regierung Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen, indem sie den Plan, einen preußischen Prinzen auf den Thron von Spanien zu erheben, nur als ein gegen die territoriale Sicherheit Frankreichs gerichtetes Unternehmen betrachten kann, hat sich in die Notwendigkeit versetzt gefunden, von S. Majestät dem König von Preußen die Versicherung zu verlangen, daß eine solche Kombination sich nicht mit seiner Zustimmung verwirklichen könnte. Da Se. Majestät der König von Preußen sich geweigert, diese Zusicherung zu erteilen, und im Gegenteil dem Botschafter Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen bezeugt hat, daß er sich für diese Eventualität, wie für jede andere, die Möglichkeit vorzubehalten gedenke, die Umstände zu Rate zu ziehen, so hat die kaiserliche Regierung in dieser Erklärung des Königs einen Frankreich ebenso wie das allgemeine europäische Gleichgewicht bedrohenden Hintergedanken erblicken müssen. Diese Erklärung ist noch verschlimmert worden durch die den Kabinetten zugegangene Anzeige von der Weigerung, den Botschafter des Kaisers zu empfangen und auf irgendeine neue Auseinandersetzung mit ihm einzugehen. Infolgedessen hat die französische Regierung die Verpflichtung zu haben geglaubt, unverzüglich für die Verteidigung ihrer Ehre und ihrer verletzten Interessen zu sorgen, und, entschlossen zu diesem Endzweck alle durch die ihr geschaffene Lage gebotenen Maßregeln zu ergreifen, betrachtet sie sich von jetzt an als im Kriegszustande mit Preußen.«99 Betrachtet man die wilde Entschlossenheit Gramonts zu Provokation und Krieg, das Drängen der Kaiserin und Le Boeufs sowie die frühzeitige Mobilisierung, kann diese Begründung als bestenfalls unaufrichtig bezeichnet werden. Diese Zusammenhänge sind von Thiers, einem Gegner Preußens, am 15. Juli in der Pariser Kammer klar erkannt und offen benannt worden. Dieser Umstand schmälert aber nicht die Schuld Bismarcks, der mit Finten und Tricks – manche Kommentatoren halten die Redaktion des Abeken-Telegramms sogar für Verfassungsbruch durch Amtsmissbrauch – seinen alten, kriegsunwilligen König in eine Situation gebracht hat, die er unbedingt vermeiden wollte. Wilhelm ist für den Frieden sogar bereit, mit Leopolds Rückzieher eine persönliche Blamage in Kauf zu nehmen. Doch der preußische Militärapparat um Moltke und Roon will im Verein mit Bismarck den Krieg genauso wie die Protagonisten auf französischer Seite ihn herbeireden. Die ambivalenten Gefühle, die König Wilhelm in dieser Situation berührt haben müssen, erkennt seine mitfühlende und vor allem mitdenkende Gattin Augusta in ihrem Schreiben vom 16. Juli: »Welch eine Ankunft und welcher Kontrast. Die Kriegserklärung und Mobilmachung einerseits, als furchtbare Aufgabe des Monarchen; andererseits – die patriotische Begeisterung als Trost und Kräftigung für das tiefbewegte Gemüt.«100 Der Kronprinz Friedrich Wilhelm sieht dem Krieg gleichermaßen mit gemischten Gefühlen entgegen, wie er seiner Mutter am Tag der französischen Kriegserklärung schreibt: »Zu sagen habe ich nichts angesichts der furchtbaren Zeiten, denen wir entgegengehen, als daß ich Gott bitte, der gerechten Sache, die wir verteidigen müssen, seinen Beistand nicht zu entziehen. Mein Dank für Deinen lieben Brief kann demnach nicht anderes bringen als den Ausdruck des tiefsten Kummers über den unvermeidlichen Krieg, an den noch vor 8 Tagen niemand glaubte […].«101 Wie seine Mutter, sorgt sich auch der Sohn um den Vater. Im selben Brief schreibt Friedrich Wilhelm: »Ich kann nicht sagen, wie der arme Papa mich rührt und dauert, und seine ruhige und gottgegebene Stimmung mich ergreift!«102
Nüchterner als viele im Kriegstaumel schwelgende Zeitgenossen betrachten Karl Marx und Friedrich Engels die Julitage des Jahres 1870. Die beiden kommunistischen Exilanten in London und Manchester teilen die nationale Emphase in Deutschland keineswegs, sondern denken in anderen Kategorien als denen der ›Nation‹, ›Ehre‹ oder ›Rache‹. Marx wünscht dennoch einen deutschen Sieg gegen den ihm verhassten Napoleon III., allerdings hat er dabei ganz eigene Motive, wie er Engels am 20. Juli schreibt: »Die Franzosen brauchen Prügel. Siegen die Preußen, so ist die Zentralisation der state power nützlich der Zentralisation der deutschen Arbeiterklasse. Das deutsche Übergewicht wird ferner den Schwerpunkt der westeuropäischen Arbeiterbewegung von Frankreich nach Deutschland verlegen, und man hat bloß die Bewegung von 1866 bis jetzt in beiden Ländern zu vergleichen, um zu sehen, daß die deutsche Arbeiterklasse theoretisch und organisatorisch der französischen überlegen ist. Ihr Übergewicht auf dem Welttheater über die französische wäre zugleich das Übergewicht unserer Theorie über die Proudhons103 usw.«104 Engels, der in seinen ›Notes on the war‹, die ab 29. Juli 1870 in der ›Pall Mall Gazette‹ regelmäßig erscheinen, das Kriegsgeschehen für das englische Publikum kommentiert, schreibt am 28. Juli, vom deutschen Kriegsjubel angewidert, an Marx: »Der deutsche Philister scheint förmlich entzückt, daß er seiner eingeborenen Servilität jetzt ungeniert Luft machen kann.«105 Gleichzeitig sieht er in dem Krieg noch keine mögliche Gefahr für den von ihm und Marx propagierten Klassenkampf: »Glücklicherweise geht die ganze Demonstration von der Mittelklasse aus. Die Arbeiterklasse, mit Ausnahme der direkten Anhänger Schweitzers, nimmt keinen Anteil daran. Glücklicherweise ist der war of classes in beiden Ländern, Frankreich und Deutschland, so weit entwickelt, daß kein Krieg abroad das Rad der Geschichte ernsthaft rückwälzen kann.«106 Engels verweist mit der Erwähnung Johann Baptist Schweitzers, des Vorsitzenden des ›Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins‹, darauf, dass die Arbeiterklasse allerdings keineswegs einheitlich in der Ablehnung des Krieges steht. Schweitzer organisiert am 17. Juli in Berlin eine sozialdemokratische Kundgebung, die von immerhin 1000 Teilnehmern besucht worden sein soll. Ein zeitgenössischer Bericht eines Vertreters der Arbeiterklasse schildert diesen Ausbruch nationaler Emphase: »Die Befreiung der Sozialdemokraten, die Befreiung des Arbeiters von der politischen und sozialen Knechtung, sagte Dr. Schweitzer, würden durch diesen Krieg nicht beeinträchtigt, sondern in hohem Grade gefördert; der Sturz Napoleons müsse sich notwendigerweise zu einem Siege der Freiheit umgestalten.«107
Wie ist die Lage Mitte Juli außerhalb des ›Norddeutschen Bundes‹, in den süddeutschen Staaten? Am 16. Juli mobilisiert Bayern seine Streitkräfte, allerdings zeigt sich der in den Zollparlamentswahlen bezeugte Partikularismus auch hier. Viele Wehrpflichtige entziehen sich dem Ruf der Fahnen. Am 17. Juli allerdings feiert eine Menge von etwa 30 000 Menschen den König in München mit lautem Hurrageschrei und dem Absingen deutschnationaler Lieder. Am 18. Juli beantragt der bayerische Kriegsminister einen Gesetzentwurf über die Gewährung des Kriegskredits, über den am 19. Juli im Landtag zu München diskutiert wird. Für die bayerische Regierung liegt eindeutig der Bündnisfall vor. Die Sitzung ist stürmisch. Der Haushaltsausschuss, der zuvor über die Bewilligung der Kredite beraten hat, empfiehlt die Gewährung des Kredits, aber nur für die Aufrechterhaltung einer bewaffneten Neutralität. Mit diesem Entscheid ist der Skandal da. Viele Abgeordnete befürchten Kriegsfolgen für die an Frankreich grenzende Pfalz, andere schimpfen über den mangelnden Patriotismus ihrer Kollegen, im Landtag herrscht Tumult. Symptomatisch für die kritische Haltung vieler Vertreter im Bayerischen Landtag ist der Redebeitrag des Pfarrers und Abgeordneten Anton Westermayer. Theodor Fontane schildert Westermayers Rede und die Folgen: »Sein Herz, sagte er, bliebe kalt und ungerührt, wenn man immer von einem deutschen Kriege, einer deutschen Sache spreche. Die spanische Thronfrage habe mit Deutschland nichts zu schaffen; das seien bloß dynastische Interessen, die hier in Frage ständen. Auf beiden Seiten sei gefehlt worden und die Völker müßten nun für die Empfindlichkeit ihrer Fürsten bluten und sterben. Er spreche sich unter zweien Uebeln für das geringere aus. Er möchte den Pfälzern die Gräuel des Kriegs nicht zutragen (die Pfälzer Abgeordneten rufen: ›Wir scheuen sie nicht!‹). Wenn aber im Nachbarhaus ein Dieb einsteigt, so muß ich mein eigenes Haus versperren und kann dem Nachbarn keine Hilfe bringen.«108 Dieser Beitrag endet in wildem Geschrei, linke Abgeordnete springen von ihren Sitzen auf, Pfuirufe hallen durch den Saal und auch auf den Besucherplätzen macht sich Unruhe breit. Nach beschwörenden Reden des bayerischen Ministerpräsidenten und des Kriegsministers werden jedoch am Ende der Kredit und der Einsatz an der Seite Preußens bewilligt. Am 20. Juli telegrafiert König Ludwig II. von Bayern seinem preußischen Kollegen: »Mit Begeisterung werden Meine Truppen an der Seite Ihrer ruhmgekrönten Waffengenossen für deutsches Recht und deutsche Ehre den Kampf aufnehmen. Möge er zum Wohle Deutschlands und zum Heile Bayerns werden.109 Diese überschwänglichen Worte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass neben vielen Begeisterten manche Bayern nur zähneknirschend an der Seite Preußens in den Krieg ziehen. Die bayerische Ambivalenz kommt deutlich in einem Leitartikel der ›Allgemeinen Zeitung‹ aus Augsburg zum Ausdruck, in der es am 17. Juli heißt: »Und kann, darf in solcher Fragen Entscheidung ein Theil der Nation sein Herz und sein Interesse von dem anderen scheiden und den Unbeteiligten spielen? Auf beide Fragen unser entschiedenstes, entschlossenstes Nein! Dieses Nein, wünschen wir, möge Widerhall finden in jedem deutschen Herzen und Munde. Vor allem freilich im deutschen Süden, wo der Schwankenden und Zagenden genug sind […]. Das ist aber nicht süddeutsche Schuld allein; es ist leider auch, und in noch viel höherem Maß, Preußens Schuld. […] Vieles gute und tüchtige hat die Großmacht des Jahres 1866 im verflossenen Lustrum110 geschaffen und geleistet, die Herzen hat sie nicht gewonnen, und Begeisterung kann sie heute nicht verlangen, denn die kommt aus dem Herzen. Herrisches Hochfahren, theokratische Gelüste, soldatische Rohheit und Willkür, zweierlei Recht und Gewicht für Bürger und Soldat, frömmelnde Bevormundung in Kirche und Schule – das sind Eigenschaften welche die großen Massen so gut abstoßen wie den frei, besonnen und gebildet denkenden Einzelnen. […] Zürne man uns. Aber das alles mußten wir aussprechen, wir mußten zeigen daß wir nicht blind und blöde, sondern mit klarem Bewusstsein von Wesen und Lage der Dinge den furchtbaren Gang mit antreten zu welchem Europa die Lenden gürtet. Wir wiederholen – alles ist jetzt Nebensache, verschwunden und vergessen, und nur das eine steht: die ernste Pflicht mit Preußen und jedem deutschen Stamme vereint für Deutschland zu gehen.«111 Dass sich die bayerische Regierung der zweifelhaften Rolle Bismarcks beim Ausbruch des Krieges durchaus bewusst ist, zeigt ein Brief des bayerischen Gesandten in Berlin, Maximilian Joseph Pergler von Perglas, an König Ludwig II.: »Ich darf aber in Erfüllung meiner Pflicht in meiner offiziellen Berichterstattung nicht verschweigen, daß den Eingeweihten in den politischen Dingen und Verhältnissen […] nicht entgehen kann und daß auf mancher kompetenten Seite hier es lebhaft beklagt wird, daß Preußen mit Leichtsinn die Veranlassung zum Kriege geboten hat […]. Wenn Preußen nicht siegt, werden schwere Anschuldigungen gegen Bismarck erfolgen.«112
Auch in Württemberg und in Baden bleibt die Begeisterung über den Krieg eher verhalten, dennoch geht man in diesen Ländern mehr oder minder freudig mit gegen einen Feind, der die Grenzen bedroht und von dem sich viele Bürger gekränkt fühlen. Im Königreich Württemberg gibt es – wie in Bayern – ebenfalls starke antipreußische Tendenzen, wie sich bei den Zollparlamentswahlen gezeigt hatte. Württembergs König Karl I., der um die Eigenständigkeit seines Landes fürchtet, neigt eher den Strömungen zu, die auf ein gutes Verhältnis zu Frankreich bauen. Württembergs Ministerpräsident Karl Friedrich von Varnbühler hingegen taktiert und laviert zwischen den Konfliktlinien. Erst versucht er über den französischen Botschafter in Stuttgart, den Grafen Charles Raymond de Saint-Vallier, Paris davon abzubringen, aus der spanischen Thronfolgefrage eine deutsche Angelegenheit zu machen, welche die süddeutschen Staaten an die Seite Preußens und dann in ein ›kleindeutsches‹ Reich zwingen müsste. Auch er wünscht eigentlich keine ›Verpreußung‹ Württembergs. Doch bald schwankt seine Haltung und er teilt Saint-Vallier seine Sorge mit, dass der preußische König Gramonts Forderungen ablehnen werde und müsse. In Absprache mit der Regierung in Bayern sieht auch er dann in der ›Julikrise‹ den ›Casus Foederis‹ gegeben. In Württemberg strömen desgleichen nun Massen auf die Straßen und fordern in nationaler Emphase den Krieg gegen Frankreich. Die 1868 gegründete ›kleindeutsch‹ und propreußisch gesinnte ›Deutsche Partei‹ organisiert agitatorische Volksversammlungen und patriotische Unterschriftensammlungen. Der ›Schwäbische Merkur‹ bearbeitet offensiv die Öffentlichkeit im Sinne Preußens. Schließlich können sich auch die ›großdeutschen‹ und demokratischen Parteien im ›Ländle‹ dem Druck der Straße nicht mehr entgegenstellen. Nach Beratungen mit Varnbühler ordnet König Karl die Mobilmachung an und die Kriegskredite werden im Stuttgarter Landtag beinahe einstimmig verabschiedet. In einem Bericht von seiner Abschiedsaudienz am Stuttgarter Hof schildert Saint-Vallier die Verbitterung des Königs und seiner Gattin Olga, die stets Wert auf gute Beziehungen zu Napoleon III. gelegt hatten. Sie ahnen das Ende der württembergischen Freiheit. Die beiden Monarchen fühlen sich von Preußen hintergangen, von Volk und Regierung verlassen. Unter Tränen versichern Karl und Olga ihren Schmerz, nun Partei für Preußen und gegen Napoleon ergreifen zu müssen. Man scheint in Stuttgart nicht vergessen zu haben, dass es Napoleon I. war, der 1806 den Herzog Friedrich von Württemberg, Karls Großvater, erst zum Kurfürsten und dann zum König erhoben hat.
Mit Baden ist das Herrscherhaus Preußen seit dessen Hilfe bei der endgültigen Niederschlagung der Revolution im Jahr 1849 deutlich mehr verbunden als mit Württemberg. Die direkte Grenzlage zu Frankreich lässt in Baden zudem rasch Ängste vor einem französischen Überfall wach werden. So ist man während der ›Julikrise‹ in Karlsruhe einerseits geneigt, Frankreich nicht zu provozieren, erkennt aber an, dass im Kriegsfall nur an der Seite Preußens Schutz gegen Frankreich erwartet werden kann. Am 15. Juli ergeht auch in Baden der Mobilmachungsbescheid an die Dienststellen, am 21. Juli wird formell die Kriegsteilnahme beschlossen. Wie in Württemberg, sehen auch die Badener in Napoleon einen Aggressor, den sie in einer Mischung aus Empörung, banger Erwartung und patriotischer Begeisterung bekämpfen wollen. Die Warnung des unbedachten Gramont gegenüber dem bayerischen Gesandten, dass man das Großherzogtum Baden, das doch »nicht mehr als eine Zweigstelle Berlins« sei, auch auflösen könne, wird viele Badener nicht gerade für Frankreich eingenommen haben.
Im Großherzogtum Hessen hat man die Annexionen Nassaus, Kurhessen und Frankfurts sowenig wie die eigenen Abtretungen an Preußen vergessen. Reinhard Carl Friedrich Freiherr Dalwigk zu Lichtenfels, großherzoglicher Ministerpräsident, betreibt nach 1866 eine radikale und durchaus intrigant zu nennende Politik gegen Preußen. Das Großherzogtum, das, wie an anderer Stelle schon erwähnt, nur mit dem nördlichen Teil dem ›Norddeutschen Bund‹ angehört, soll nach Dalwigks Willen Teil einer französisch-österreichischen Allianz werden. 1868 bietet er der französischen Regierung bei einem Besuch der Weltausstellung sogar an, mit einem Beitritt des südlichen Teils des Großherzogtums zum ›Norddeutschen Bund‹ Frankreich einen Kriegsgrund gegen das verhasste Preußen konstruieren zu können. Im Windschatten eines solchen Krieges erhofft sich Dalwigk wohl die völlige Wiedererlangung der hessischen Freiheit. Auch die preußisch-hessische Militärkonvention von 1867, durch welche die großherzoglichen Truppen in die preußische Armee eingegliedert wurden, und den Abschluss des ›Schutz- und Trutzbündnissses‹ versucht Dalwigk 1867, nach Kräften zu unterlaufen. In der ›Julikrise‹ jedoch kann selbst Dalwigk nicht verhindern, dass die großherzoglich-hessischen Truppen als Teil der 2. deutschen Armee in den Krieg gegen Frankreich ziehen müssen.
So steht nun ganz Deutschland gegen Frankreich im Feld. Mit Bayern, Württemberg und Baden stehen jetzt drei Länder an der Seite Preußens und der norddeutschen Länder zum Kampf gegen Frankreich bereit, die nur vier Jahre zuvor noch Feinde der Hohenzollern waren. Es fällt nicht schwer, hier ein völliges Versagen der französischen Diplomatie festzustellen, die selbst Warnungen aus den süddeutschen Ländern vor einer solchen Entwicklung in den Wind geschlagen hatte. Der französische Historiker Albert Sorel schildert bereits 1875 in einer Untersuchung der diplomatischen Vorgeschichte des Krieges Gramont als ›einzigartig unfähig und kurzsichtig‹113, verlässt er sich doch vollkommen auf mehr als unsichere Annahmen. Man könnte hinzufügen, dass Gramont mit seiner ganzen Politik im Vorfeld des Krieges indirekt zum ›Geburtshelfer‹ der vereinten deutschen Nation wurde.
Betrachtet man Gramonts Verhalten vom Ergebnis seiner Bemühungen her, ist Sorels Darstellung nachvollziehbar. Auch wenn es aus Sicht der Pariser Kriegspartei logisch gewesen sein mag, einen Konflikt vom Zaun zu brechen – sei es um das Kaisertum zu retten, sei es um liberale Reformen rückgängig zu machen –, muss man sich wundern, dass Gramont diesen Krieg unter derart ungünstigen Voraussetzungen herbeiführt. Schließlich steht Frankreich ohne Verbündete gegen das ganze, national erregte Deutschland. Dazu kommt, dass auch die öffentliche Meinung in ganz Europa gegen Frankreich steht – so, wie es Adolphe Thiers am 15. Juli in der Pariser Kammer richtig vorausgesehen hatte. Am 17. Juli schreibt zum Beispiel die Zeitung ›The Daily News‹ aus London: »Von französischer Seite ist der Krieg nur Ehrsucht und Angriff, der scheußliche Kommentar der Zeit zu der großartigen Prahlerei, daß das Kaiserreich der Frieden [sei]. Der Kaiser möchte seinem Oheim nacheifern und sein Reich bis an den Rhein ausdehnen: wir können nur hoffen, daß er seines Oheims Missgeschick erleben und seine missbrauchte Gewalt in seinen blutbefleckten Händen zerplatzen sehen werde. Der 15. Juli 1870 wird in der Geschichte als ein Tag eines großen Verbrechens verzeichnet stehen.«114
Auch alle Versuche Gramonts, Verbündete zu gewinnen, sind bei Ausbruch des Krieges gescheitert. Nur unter der reichlich überheblichen Annahme, selbst ohne Verbündete gegen Deutschland bestehen zu können, da die französische Armee unbesiegbar sei, konnten Gramont, Ollivier, der Kaiser, die Kaiserin und Le Boeuf dieses Risiko eingehen. Oder glaubte man in Frankreich, Österreich und Italien kämen zur Hilfe? Mit Österreich und Italien hatte es in den Jahren 1868 und 1869 Gespräche über Bündnisverträge gegeben, die zu den sogenannten ›Monarchenbriefen‹ führten. Eine vertraglich abgesicherte Entente besteht im Jahr 1870 zwischen den Ländern jedoch nicht, obgleich ein österreichisch-französischer Bündnisvertrag im Mai 1869 vorlag, der aber nicht unterschrieben wurde. Die ›Monarchenbriefe‹ des Kaisers Franz Joseph I. von Österreich und des Königs Vittorio Emanuele II. von Italien sagen Frankreich lediglich zu, keine Verhandlungen mit Dritten zu führen, ohne zuvor Frankreichs Einverständnis eingeholt zu haben. Napoleon sieht seltsamerweise in diesen Briefen den Ausdruck einer moralischen Verpflichtung zum Beistand im Kriegsfalle – eine Sichtweise, die allerdings in Florenz – bis 1871 Hauptstadt Italiens – und Wien nicht geteilt wird. Dieses Missverständnis der Pariser Regierung ist eine Ursache für den Beschluss der ›Konfliktstrategie‹ im Ministerrat des 6. Juli 1870. Als es dann spät zu konkreten Verhandlungen mit Italien und Österreich über Bündnisse kommt, scheitern diese an übertriebenen Forderungen, Eigensüchtigkeiten, Arroganz und kommunikativer Unfähigkeit. Albert Sorel urteilt als Historiker und Zeitgenosse 1875 streng über Gramonts Fehler, alle Pläne von der ungewissen Bereitschaft Italiens und Österreichs zum Eingreifen abhängig zu machen, wenn diese erst von den raschen französischen Erfolgen überwältigt sein würden: »So ruhten alle Schlüsse des Herzogs von Gramont einzig auf seinem absoluten Vertrauen in die Überlegenheit der französischen Armee.«115 Von diesem Vertrauen, das Schicksal einer ganzen Nation abhängig gemacht zu haben, erscheint Sorel als fahrlässig.
Italien wünscht ein Durchmarschrecht durch Österreich, um in Bayern einfallen zu können. Österreich verweigert dies. Von Frankreich strebt Italien als Gegenleistung für die militärische Hilfe das Ende des französischen Schutzes für Rom und den Papst an. Rom soll an Italien angegliedert und endlich ›Capitale‹ werden. In Frankreich ist man jedoch der Meinung, Italien stehe seit 1859 in französischer Schuld und verweigert das Geschäft in der gewünschten Form. Desgleichen wünscht man in Paris keinen Ärger mit der katholischen Kirche, die schließlich einen Hauptpfeiler im System des Second Empire bildet. Gramont glaubt, sich im Vertrauen auf die eigene Armee derartige Zurückweisungen möglicher Bündnispartner leisten zu können: »Wir werden nach unseren Siegen […] mehr Verbündete haben, als wir wollen.«116 Österreich-Ungarn hingegen fürchtet die großen Sympathien vieler Deutschösterreicher für die ›deutsche Sache‹ und glaubt daneben, sich einen Krieg finanziell nicht leisten zu können. Auch die Gefahr, dass Russland bei einem Eingreifen Österreich-Ungarns seine Neutralität zugunsten Preußens aufgeben könne, erscheint dem k.u.k-Außenminister und Reichskanzler Friedrich Ferdinand von Beust als zu groß. Zar Alexander II. von Russland droht Österreich-Ungarn offen mit der Besetzung Galiziens, sollte sich Wien gegen Berlin stellen. Zum einen fühlt sich Moskau durch das 1863 in der ›Alvenslebenschen Konvention‹ ausgesprochene Hilfsangebot Preußens bei der Niederschlagung des polnischen Aufstands Berlin gegenüber moralisch verpflichtet, zum anderen fürchtet Russland für den Fall eines französisch-österreichischen Sieges eine neue Unabhängigkeitsbewegung in Polen. Schließlich ist der preußische König auch noch Onkel des Zaren, dessen Mutter Alexandra Fjodorowna, geborene Charlotte von Preußen, die ein Jahr jüngere Schwester Wilhelms I. ist.
Am 18. Juli, einen Tag vor der schriftlichen Kriegserklärung an Berlin, fordert die französische Regierung, Wien möge Italien nun mit 70 000 bis 80 000 Mann ein Durchmarschrecht gewährten, eine eigene Armee von 150 000 Mann nach Böhmen senden und weitere 200 000 bis 300 000 Soldaten zur Verfügung stellen. Als Preis lobt Paris die Revision der Kriegsergebnisse von 1866 aus. Österreich-Ungarn lehnt jedoch ab. Schließlich wahren Italien und Österreich-Ungarn lediglich eine für Frankreich wohlwollende Neutralität. Opportunistisch wollen sie den Kriegsverlauf abwarten und sich bei einer günstigen Entwicklung für Frankreich ein späteres Eingreifen vorbehalten. Die raschen Erfolge der deutschen Truppen im August 1870 machen diese Überlegungen allerdings bald hinfällig. Dass die Regierung in Paris am 15. Juli eine informelle Kriegserklärung abgibt, ohne sich des militärischen Beistands Italiens oder Österreich-Ungarns tatsächlich versichert zu haben, ist fahrlässig. Die kurzfristige Forderung an Wien, einen Tag vor der schriftlichen Kriegserklärung, als schon alles zu spät ist, Frankreich zur Seite zu springen und dafür einen geradezu fantastischen Preis anzunehmen, ist hingegen in ihrem hektischen Ungeschick nur als diplomatische Peinlichkeit zu bezeichnen. Einen abenteuerlichen, geradezu verzweifelten Plan hat Frankreich dann noch mit Dänemark, dem Verlierer von 1864. Ein französisches Landungskorps soll an der norddeutschen Küste oder in Jütland abgesetzt werden und gemeinsam mit den relativ schwachen dänischen Truppen den Krieg an die Nord- und Ostsee tragen. Nach Druck aus Russland und England, die beide dringend Neutralität empfehlen, winkt Kopenhagen dankend ab.
England schließlich, dessen Regentin Queen Victoria die Schwiegermutter des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm ist, hat sich von Frankreich seit dem Krimkrieg ohnehin entfremdet. Es steht für eine antipreußische Koalition erst gar nicht zur Debatte. Letzte englische Vermittlungsversuche zur Beilegung des Konflikts scheitern am Unwillen beider Seiten. Die kurzfristigen Bündnisverhandlungen des Herzogs von Gramont und seiner umtriebigen Diplomaten enden für Frankreich in einem bemerkenswerten Desaster.
Auch Ollivier, immerhin Leiter der Regierung, deren Außenminister Gramont nur ist, trägt an diesem Ungeschick seinen Anteil. Er verhindert nicht, dass es zum Krieg kommt, Frankreich ohne Verbündete dasteht, das Ausland überwiegend Frankreich als Aggressor ansieht und das Kaiserreich nur Wochen nach Kriegsbeginn scheitert. Er fällt dem eigenmächtigen Gramont nicht in den Arm. Es spricht Bände für seine gescheiterte Politik und seinen Anteil daran, dass der mittlerweile demissionierte Ollivier im Oktober 1870 glaubt, aus dem italienischen Exil den preußischen König brieflich um Gnade für Frankreich anbetteln zu müssen. Verzichte Wilhelm auf Eroberungen, werde ein langer und schöner Frieden herrschen, erobere er aber, drohten, so Ollivier, schwerwiegende Konsequenzen. In Olliviers weitsichtigen Worten, die sich im Jahr 1914 erfüllen sollten, zeigt sich schon deutlich die nachträgliche Bitternis des deutschen Sieges: »Wenn Sie aber unser Territorium anrühren, beginnen Sie einen neuen Dreißigjährigen Krieg. […] Werden Sie ein Eroberer, bereiten Sie eine Allianz der slavischen und lateinischen Völker gegen Preußen. […].«117
Bismarck hat später gern im Dienste seiner eigenen Legendenbildung und mit Wirkung bis in die Gegenwart darauf verwiesen, dass nur seine Redaktion des Abeken-Telegramms beim Abendessen mit Moltke und Roon den endlich glücklich herbeigeführten Kriegsgrund gebildet habe. Nur die ›Emser Depesche‹ habe nach dem Rückzug Leopolds und dem Friedenswunsch König Wilhelms seinen Kriegsplan noch retten können. Bismarcks später geäußerte Ansicht, die ›Emser Depesche‹ habe wie ein »rotes Tuch auf den ›gallischen Stier‹«118 gewirkt, überzeichnet die Rolle des Kanzlers des ›Norddeutschen Bundes‹ zumindest in diesem Punkt ein wenig. Doch auch die französische Kriegserklärung bezog sich auf die Depesche und schien Bismarck so zu bestätigen. Seine Mitverantwortung am Kriegsausbruch hat Bismarck also nie geleugnet, vielmehr war er stolz darauf.
Aber die Stimmung in der französischen Öffentlichkeit, unter den Parlamentariern wie Ministern war bereits derart aufgeheizt, gleichzeitig waren die Kriegstreiber um Eugénie so fest zum Waffengang entschlossen, dass es der ›Emser Depesche‹ nicht mehr wirklich bedurft hätte. Die ursprüngliche Version des Abeken-Telegramms hätte vermutlich die gleichen Emotionen ausgelöst, da hier die Abweisung des Botschafters durch den König ebenfalls nur zu deutlich wurde. Die Wirkung der ›Emser Depesche‹ war daher weniger im Hinblick auf Frankreich als auf die süddeutschen Staaten von Bedeutung und darin liegt Bismarcks eigentliche ›Leistung‹. Der offene Versuch der Ehrverletzung des preußischen Königs, der forsche Auftritt Benedettis und die nationalistische Arroganz, die aus Gramonts Forderungen sprach, waren eine Beleidigung aller Deutschen oder wurden von vielen zumindest als solche aufgefasst. Mit dem Vorgang von Bad Ems und der Veröffentlichung der Depesche kippte die Stimmung in den süddeutschen Staaten. Hatte man bei den Zollparlamentswahlen 1868 vor allem in Württemberg und Bayern noch sehr deutlich Skepsis gegenüber Preußen zum Ausdruck gebracht, wollte man nun auch dort ›Satisfaktion‹. Preußen war nun nicht mehr isoliert, sondern wusste sich von einer Welle patriotischer Begeisterung getragen, die, wie in der Adresse des Reichstags vom 19. Juli mit Recht formuliert, von der Nord- und Ostsee bis zu den Alpen, vom Rhein bis an die Memel reichte.
Die ›Emser Depesche‹ gab so beiden Seiten eine glaubwürdige Argumentation für die Notwendigkeit eines Krieges an die Hand. Anders als weite Teile der Öffentlichkeit in beiden Ländern, die tatsächlich glaubten, für die jeweils beleidigte nationale Ehre in den Krieg ziehen zu müssen, waren sich Gramont und Bismarck über die wahren Hintergründe vollständig im Klaren. Hätten die nationalistisch bewegten Franzosen im Juli 1870 gewusst, wie hoch der Preis sein würde, den sie ab August für ihre Erregung zahlen würden, hätten sie vielleicht gezögert, sich zum Spielball der Mächtigen machen zu lassen. Auch manche badische oder preußische Familie sollte noch die Opfer kennenlernen, welche die nationale Einheit ihnen abverlangen würde. Die Verluste der Jahre 1870 und 1871 sollten jene von 1864 und 1866 weit in den Schatten stellen.
Die Chronisten beider Seiten bemühten sich in der Folge, den Kriegsausbruch als ein patriotisches Fest voller Begeisterung und Emphase darzustellen. Das aber war für den Juli 1870 genauso propagandistisch überzogen wie später für den August 1914. Sicher gab es den tagelangen Krawall auf den Straßen von Paris und den begeisterten Empfang König Wilhelms in Berlin. Ebenso in Süddeutschland wogte die Welle antifranzösischer Empörung. Aber man darf den veröffentlichten Meinungen während der Ereignisse und den Darstellungen nach dem Krieg nicht uneingeschränkt Glauben schenken – sie sind häufig bewusst verzerrt oder übertrieben. Reife Familienväter mit Verantwortung für Frau und Kinder, Bauern in Sorge um Feld und Vieh, Industrie- oder Hilfsarbeiter, Tagelöhner, die mit einer eventuellen Verwundung als Invaliden keine Anstellung mehr finden, ziehen niemals begeistert in einen Krieg – sie wissen, was auf dem Spiel steht. Der Mob, der sich auf den Straßen in einen nationalen Rausch grölt, ist 1870 wie 1914 derselbe: junge Männer ohne Familie und meist ohne berufliche Verantwortung und Lebenserfahrung, Angestellte, Schüler, Studenten. Sie glauben, in ein Abenteuer aus Männlichkeitsbeweisen und Heldentum zu ziehen. Mit ihnen laufen aber auch die alten Männer über die Straßen, welche die Jugend ins Feld brüllen, damit sie ihnen, den Biertischstrategen, die nationalen Lorbeeren nach Hause holen möge. Die meisten wehrpflichtigen deutschen Männer ziehen 1870 aus Pflichterfüllung und mit dem ernsten Bewusstsein der Gefahr in den Krieg. Die nationale Sache mag vielen, vor allem den Gebildeten und politisch nationalliberal eingestellten Städtern, am Herzen liegen, das eigene Leben ist aber sicher den meisten wichtiger. An den Mantelschößen dieser Männer hängen beim Ausmarsch keine Heldenbräute, sondern verzweifelte Mütter, Ehefrauen, Schwestern, Brüder und Kinder.