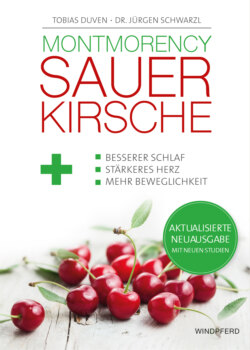Читать книгу Montmorency Sauerkirsche - Tobias Duven - Страница 9
ОглавлениеHistorischer Rückblick
Ursprung und Verbreitung
Schon in der Antike wurde die Sauerkirsche als schmackhafte und nahrhafte Obstsorte geschätzt, deren Ursprung in den kleinasiatischen Küstengebieten des Schwarzen Meeres lag. Unter Alexander dem Großen brachten Soldaten die Kirsche nach Griechenland und Italien. Von dort verbreiteten die Römer die Steinfrucht dann über die Alpen nach Mitteleuropa ins Land Germanien, u. a. an den Bodensee. Darauf deuten Kirschkerne hin, die man dort bei Ausgrabungen von Römerlagern und Pfahlbauten fand. Schließlich verdankt die Kirsche den Römern ihre Verbreitung und Kultivierung bis nach Nordeuropa. Es ist anzunehmen, dass der Kirschbaum früher hauptsächlich in den Gärten und Anlagen von Fürsten und Adligen kultiviert wurde. Erst seit Ende des 18. Jahrhunderts unterscheidet man übrigens zwischen Süß- und Sauerkirschen.
Begründer der Medizin
Eine der wohl ältesten Überlieferungen zur Anwendung der Kirsche stammt von der griechischen Insel Kos. Hier soll niemand Geringerer als Hippokrates Kirschen zur Behandlung von Epilepsie verordnet haben.
Traditionelle Anwendung
Seit Urzeiten dienen Kirschen den Menschen sowohl als Nahrungs- als auch als Heilmittel. Hildegard von Bingen (1098 – 1179) beschrieb schon vor 900 Jahren in ihren Aufzeichnungen therapeutische Ansätze zur Heilung mit Kirschen. Überliefert ist z. B. die Anwendung einer Kirschkernsalbe auf Basis von Bärenfett bei Neurodermitis, entzündlichen Geschwüren und Schuppenflechte. Gleichzeitig fanden speziell die Früchte, Stiele und Kerne der Sauerkirsche bei Haut- und Erkältungskrankheiten, Rheuma, Gicht, Blutarmut, Verstopfung, Magenschmerzen, Skrofulose und Parodontitis volksmedizinische Verwendung. Die Schößlinge der Sauerkirsche setzte man z. B. als Mixtur gegen Skrofulose in Rotwein oder Zucker an und ergänzte diesen Sud mit Walnussblättern. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war der Einsatz der Sauerkirsche in der Heilkunde von großer Bedeutung.
Aus der Sauerkirsche hergestellter Kirschsirup diente schon in der Antike als Arzneimittelträger und zur Geschmacksverbesserung von Heilmitteln. Neben innerlicher Einnahme fand der Sirup auch äußerlich als Einreibemittel bei Gicht, Rheuma und Herzbeschwerden Anwendung. Allgemein galt früher der Syrupus Cerasum (Weichselsaft) als ein kühlendes und durststillendes Getränk bei hitzigem Fieber. Es sollte wirksam bei Durchfällen sein und ihm wurde große harntreibende Kraft zugeschrieben. Die fett-, salz- und eiweißarmen Früchte wurden speziell bei Herz- und Gefäßerkrankungen als Krankendiät verordnet. Mit den gedörrten Früchten stillte man den Durchfall und die Ruhr. Aus den zerstoßenen, dann vergorenen Früchten wurde durch Destillation das „Schwarzwälder Kirschwasser“ (ca. 48 % Ethanol) hergestellt.
Seit der Antike ist man sich der heilenden Wirkung von Kirschen bewusst.
Kirschkernkissen
In Kissen eingenäht, die man im Ofen erhitzen oder im Gefrierschrank kühlen kann, werden die Kerne zur lokalen Wärme- oder Kältetherapie genutzt. Auch zur Hand- oder Fußmassage eignen sich solche Kissen hervorragend.
In der Volksheilkunde wurden die Kirschstiele (syn. Sauerkirschstiele), Stipides Cerasorum (syn. Stipides Cerasi acidi, Pedunculi Cerasorum), als Diuretikum, Stopfungsmittel und bei Blasenentzündung sowie als Bestandteil von Entfettungstees angewendet. Sie ergaben einen guten schleimlösenden Brusttee. Die getrockneten Stiele sollten als Brusttee bei Bleichsucht getrunken werden. Die Abkochung der Stiele (Infus, wässriger Pflanzenauszug) wurde bei Bleichsucht, kindlichem Katarrh und Husten geschätzt. Ebenfalls wurde diese Aufbereitung als harntreibend und stopfend bei Durchfällen empfohlen.
Die getrockneten Sauerkirschblätter, Folia Cerasi, halfen volksmedizinisch bei Blutarmut und Bleichsucht. Ein Aufguss von Blättern und Blüten mit Honig versüßt galt als altes Volksheilmittel gegen Lungenerkrankungen. Die Blätter wurden früher übrigens auch als Tabakersatz verwendet bzw. dienten als Streckungsmittel für echten Tabak.
Der in Wein aufgelöste Kirschgummi (Harz), Gummi Cerasorum, war ein altes Mittel gegen chronischen Husten und bei Steinleiden. Das betraf auch die Aufbereitung als Abkochung. In Essig zerlassen, wurde er auf räudige Körperstellen und gegen Kopfschuppen aufgetragen.
Das fette Öl der Fruchtkerne (Kirschkernöl) fand wiederum als Speiseöl Verwendung. Aus dem Holz der Kirsche wurden früher wie heute edle Möbel hergestellt.
Die Wiederentdeckung als Heilfrucht im 20. und 21. Jahrhundert
Die Sauerkirsche erfährt derzeit in der naturheilkundlichen Anwendung ein zunehmendes Comeback. Ihre besonderen gesundheitlichen Eigenschaften waren lange in Vergessenheit geraten. Das änderte sich in den 1950er-Jahren schlagartig, als Ärzte im Plantagenstaat Michigan/USA eine verblüffende Beobachtung im saisonal bedingten Krankenstand machten. Zur Erntezeit der Montmorency-Sauerkirsche verringerten sich die Arztbesuche in jedem Jahr überproportional. Das betraf vor allem jene Patienten mit chronischen Schmerzen und Gelenksentzündungen.
Die medizinische Anwendung der Sauerkirsche feiert heutzutage ein Comeback.
Vor diesem Hintergrund erhielt die Sauerkirsche wieder wissenschaftliches Interesse. Ab den 1960er-Jahren spiegelte sich dies in der Zahl der Veröffentlichungen über das Profil ihrer Inhaltsstoffe und in Erfahrungsberichten zur gezielten gesundheitlichen Anwendung wider. Dann, ab den 1990er-Jahren, wurde über den gesundheitlichen Wert einzelner Inhaltsstoffe sowie deren Zusammenspiel und präventiven Nutzen bei typischen Krankheitsbildern unserer heutigen Zeit intensiver geforscht. Dabei standen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und Stoffwechselstörungen im Vordergrund. Damit bekamen die überlieferten volksmedizinischen Anwendungen früherer Zeiten ihre wissenschaftliche Bestätigung und fanden schließlich schulmedizinisches Interesse. Vor allem betrifft dies die Verwendung des Fruchtsaftes, obwohl auch die anderen Pflanzenteile über relevante Wirkstoffe verfügen. Für den Saft der Sauerkirsche spricht besonders, dass er sich wirkungsverstärkend als Konzentrat aufbereiten lässt. Allerdings muss beachtet werden, dass die Inhaltsstoffe in ihrer anteiligen Menge sehr sortenabhängig sind, wie das exemplarische Beispiel der Montmorency-Sauerkirsche noch zeigen wird.
Symbolische Bedeutung der Kirsche
Die Kirsche steht im Volksmund als Symbol für Liebe und Erotik. Neben dem Apfel und der Traube ist die Kirsche das Symbol der Verlockung und der Sünde – die verbotene Frucht. Meistens stellen die Interpretationen eine Verbindung zur Weiblichkeit her, die auf die Rundungen der Kirschen Bezug nimmt. Dunkelrote Kirschen symbolisieren besonders Fruchtbarkeit, während gepflückte Kirschen als Zeichen des Verlustes der Jungfräulichkeit und der Unschuld gelten. In einigen mediterranen Ländern steht der Kirschbaum für den Baum der Erkenntnis und die Kirsche für die paradiesische Frucht.
Die Kirsche besitzt auch eine lange symbolische Geschichte.
Japanische Kirschsymbolik
In Japan ist die weltbekannte Kirschblüte eine Zeit der Schönheit und Reinheit, des Aufbruchs und der Vergänglichkeit, sie ist der Beginn des Frühlings. Diese Zeit wird traditionell als die wichtigste des Jahres angesehen. Die Japaner sagen, alte Kirschbäume blühen eindrucksvoller. Somit wird diese Zeit auch mit Weisheit und Erfahrung assoziiert. Die Frucht selbst wird mit Selbstfindung und Selbstopferung in Verbindung gebracht und häufig in Zusammenhang gestellt mit dem Leben der Samurai, die sich selbst überwinden und opfern, um zu ihrem eigentlich Kern, ihrer eigentlichen Bestimmung vordringen zu können. So wie man das Fleisch der Kirsche zerdrücken oder zerbeißen muss, um zu ihrem Kern zu kommen.