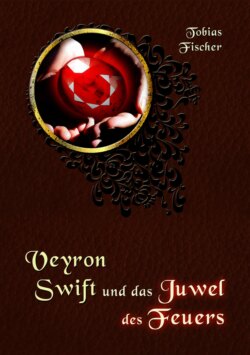Читать книгу Veyron Swift und das Juwel des Feuers - Tobias Fischer - Страница 4
2. Kapitel: Professor Daring
ОглавлениеAm nächsten Morgen wachte Tom auf und hoffte, dass sich das nächtliche Abenteuer in der Pathologie nur als Traum entpuppte. Immerhin: Er konnte sich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie er überhaupt ins Bett gekommen war. Bedeutete das, dass er die Ereignisse von letzter Nacht wirklich nur geträumt hatte?
Er stand auf, machte sich frisch, zog sich an und ging hinunter in die Küche. Mrs. Fuller hatte um diese Zeit meistens schon das Frühstück hergerichtet – oder wegen ihrer Erkrankung wohl diesmal Veyron. Der Gedanke an dessen Scharade in der Pathologie ließ sofort wieder die Wut in Tom hochkochen. Er war immer noch sauer auf Veyron. Nur ungern wollte er ihm heute über den Weg laufen. Doch genau wie befürchtet saß sein Pate noch am Tisch und studierte eine Zeitung. Veyron hatte wirklich eine Menge Zeitungen abonniert, an die vierzig verschiedene. Er stapelte sie jeden Morgen auf dem Küchentisch und schuf so eine kleine Barriere zwischen sich und Tom. Tom hatte den Küchentisch noch nicht ganz erreicht, als Veyron die erste Zeitung auch schon achtlos zu Boden fallen ließ und die oberste vom Stapel griff. Er blätterte bis zu den Tratsch- und Kuriositäten-Spalten – etwas anderes interessierte ihn nicht – und las ein paar Sekunden. Mit einem ärgerlichen Zischen warf er auch diese Zeitung zu Boden. Sofort nahm er die Nächste zur Hand. Dieses sonderbare Gebaren wunderte Tom inzwischen nicht mehr, wo er letzte Nacht selbst erlebt hatte, wie verrückt Veyron Swift tatsächlich war.
Übellaunig brummelte Tom: »Morgen«, bevor er sich an den Tisch setzte. Er nahm sich einen fast vollständig verkohlten Toast und beschmierte ihn mit Zitronenmarmelade.
Veyron sagte gar nichts, blätterte kommentarlos in der Zeitung und ignorierte ihn. Tom bekam ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hätte er ihn gestern Nacht doch keinen Spinner heißen sollen – auch wenn’s der Wahrheit entsprach. »Das, was ich gestern Nacht gesagt hab, tut mir leid«, murmelte er. Veyron schwieg ihn weiter an, in die Zeitung vertieft. Toms schlechtes Gewissen wurde immer größer. »Es tut mir wirklich leid. Aber ich war so furchtbar wütend, weil Sie und Jane mich auf den Arm genommen haben.« Er begann zu lächeln. »Aber es war schon cool, da unten in dem alten Labor. Ein richtiges Abenteuer.«
Veyron sagte immer noch nichts. Er warf die Zeitung auf den Boden und holte sein Smartphone aus der Hosentasche. Was tat er da? Offenbar studierte er den Wetterbericht. Toms schlechtes Gewissen schlug allmählich in Zorn um. Er begann zu verstehen, wieso Jane solche Schwierigkeiten mit diesem Menschen hatte. Der Kerl ist das reinste Aas, dachte er verärgert. Ganz klar: Noch heute Nacht würde er seine Sachen packen und abhauen. Zunächst zu Jane. Vielleicht brauchte sie nach der Trennung von Michael ein wenig Gesellschaft.
»Hast du schon von diesem Wetterphänomen über dem Atlantik gehört? Blitze am Himmel ohne Gewitterwolken. Einige Piloten haben davon berichtet, aber die Satelliten melden nichts Ungewöhnliches. Kurios, nicht wahr? Und so treffend, da die erste Beobachtung in den gleichen Zeitraum fällt wie die Schlachtung von Mr. Falthinghams Pferden. Ich müsste mich schon gewaltig irren, wenn zwischen diesem Wetterphänomen und unserem Pferde fressenden und Köpfe abbeißenden Ungeheuer kein Zusammenhang besteht. Was meinst du dazu?«, fragte Veyron plötzlich, ohne Tom dabei anzuschauen.
Aus Zorn wurde schlagartig Verwirrung. Etwas verdattert gestand Tom, dass er sich nicht sonderlich für Nachrichten interessierte, schon gar nicht fürs Wetter.
Veyron schnaubte verächtlich. »Pubertäre Ignoranz! Zum Glück war ich in deinem Alter nicht so. Du musst die Augen aufmachen, Tom! Wir sind umgeben von einer plötzlichen Häufung unnatürlicher Vorkommnisse, die alle in den gleichen Zeitraum fallen. Ich versuche gerade, eine Theorie zu entwickeln, die einen Zusammenhang zwischen all diesen Ereignissen herstellt.«
Tom rutschte nervös auf dem Stuhl hin und her. Okay, Blitze ohne Gewitter mochten vielleicht sonderbar sein. Ihm wollte auch keine mögliche Erklärung dazu einfallen, aber er war immerhin erst vierzehn und kein studierter Wissenschaftler.
»Glauben Sie wirklich, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt? Dass Vampire, Drachen und was weiß ich noch alles für Wesen, echt existieren?«, fragte er vorsichtig.
Veyron legte das Smartphone beiseite und schaute Tom eindringlich an. »Ich glaube es nicht, ich weiß es. Ich sehe ein, dass unser kleiner Ausflug letzte Nacht wohl ein wenig zu viel für dein Fassungsvermögen war. Darum will ich dir die Geschichte von Anfang an erzählen: Alles begann vor acht Jahren. Ich studierte gerade im zweiten Semester Psychologie, als ich einen sehr interessanten jungen Mann kennenlernte. Er war ebenfalls Student und zufällig an der gleichen Universität in Oxford wie ich. Sein Name war Floyd Ramer. Du hast vielleicht schon von ihm gehört.«
Tom brauchte nicht lange nachzudenken. »Sie meinen doch nicht etwa den Floyd Ramer, den Milliardär? Es hieß, er wäre spurlos verschwunden, vor etwa sieben oder acht Jahren. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war damals an der Schule und auch zu Hause das Thema. So was vergisst man nicht.«
»Genau den meine ich. Ramer war so sagenhaft wohlhabend, dass er zu den vermögendsten Leuten der Welt zählte, wahrscheinlich war er sogar der reichste Mensch überhaupt. Es gab zumindest nichts, was er sich nicht für Geld kaufen konnte. Das zeigte er uns Kommilitonen damals auch. Die Mädchen liebten ihn beziehungsweise sein Geld. Jeden Abend Party, jeden Abend in einem anderen Palast. Damit meine ich echte Paläste, keine Nobelhotels, sondern richtige Schlösser und Burgen im Besitz von Fürsten und Königen. Jeden Morgen mit dem Lamborghini zur Uni, stets mit neuen Designerklamotten, Manschettenknöpfen aus purem Gold und Armbanduhren aus Diamant und Platin. Er war ein Angeber in einer Größenordnung, wie es ihn auf der Welt kein zweites Mal gegeben hat oder jemals wieder geben wird.
Heute glauben viele, dass er seinen Reichtum nur deshalb so demonstrativ nach außen trug, weil er in Wahrheit depressiv war. Nach seinem spurlosen Verschwinden vor acht Jahren gab sich die Polizei schließlich damit zufrieden, dass er vermutlich Selbstmord begangen hatte. Seine Leiche wurde nie gefunden.
Sein Verschwinden machte mich neugierig, denn ich kannte Ramer und war mit den Theorien der ganzen Armee von Polizeipsychologen nicht einverstanden, die sich plötzlich aus allen Teilen der Welt zu Wort meldeten. Ramer hatte niemals irgendwelche Antidepressiva genommen und zeigte auch sonst keine Symptome von Depression. Keine plötzlichen Stimmungsschwankungen, kein Überforderungsgefühl, keine Melancholie und vor allem: keinerlei Selbstzweifel. Nein, depressiv war Floyd Ramer auf gar keinen Fall. Aber gelangweilt. Ich würde sogar sagen, dass er der gelangweilteste Mensch war, der je auf Erden lebte. Ich verbrachte einige Zeit mit ihm – außerhalb der Partys, da wir uns beide sehr für griechische Mythologie interessierten. Wir besuchten gemeinsam verschiedene Kurse, und in den Pausen führten wir sehr erhellende Diskussionen. Ich erinnere mich gut daran, dass er dem Alltag nicht viel abgewinnen konnte. Er fand so ziemlich alles langweilig: Politik, Wissenschaft, Gesellschaftsleben. Alles war für ihn so furchtbar normal.
›Wie langweilig die Menschheit ist, Veyron. So einfach, so gewöhnlich, so durchschnittlich. Es stimmt, was meine Mutter immer sagt: Seit die Menschen allein über die Erde herrschen, ist es trist und still geworden. Und je länger sie das tun, umso langweiliger wird die Welt. Es gibt nicht einmal mehr richtige Könige, nur noch ein paar verarmte Monarchen von Volkes Gnaden, besser gesagt von des Finanzministers Gnaden. Er bestimmt die Höhe der Apanage anstelle des Königs. Wo sind sie hin, die absoluten Regenten mit ihren Prunkbauten für die Ewigkeit? Verschwunden, weggefegt und entsorgt. Stattdessen herrschen jetzt die Nullen im Parlament. Alles nur Phrasendrescher. Kein Wunder, dass die Menschen da alle eingeschläfert werden. Langweilig, langweilig, langweilig. Ich wünschte, ich könnte endlich an diesen anderen Ort gehen, wo noch was los ist, wo man als König noch was zählt‹, das sagte er. Und er wiederholte es oft, bei allen möglichen Gelegenheiten. Ich glaube, das Einzige auf der Welt, das Floyd Ramer nicht langweilig fand, war Party feiern. Eines Tages war er plötzlich verschwunden.«
»Ein seltsamer Vogel. Der Typ hatte ja echt einen Schatten«, meinte Tom. Schnell nahm er sich noch einen Toast, bevor er kalt wurde.
Veyron schenkte ihm ein zustimmendes Lächeln. »Stimmt. Er war ein seltsamer Vogel, verrückt, aber nicht geistesgestört. Da muss man einen Unterschied machen. Sein Verschwinden ließ mich jedenfalls eigene Nachforschungen anstellen. Mir ging dieser Satz: ›Ich wünschte, ich könnte endlich an diesen anderen Ort gehen‹ nicht mehr aus dem Kopf. Ich war davon überzeugt, dass er nicht das Jenseits meinte, wie von den Psychologen angenommen. Dazu musst du wissen, dass Floyd Ramer kein frommer Mensch war. Er glaubte nicht, dass Gott oder ein Jenseits existierten, hielt diese Einstellung vielmehr für antiquiert und für einen modernen Menschen nicht mehr zeitgemäß. Somit war er der gleichen Meinung wie ich, dass der Tod endgültig ist. Als ob man einem Radio den Stecker zieht. Daher kam eine Jenseitssehnsucht als Grund seines Verschwindens nicht infrage. Ich war sicher, dass er tatsächlich einen realen, anderen Ort meinte, zu dem er zu gelangen hoffte – materiell, nicht spirituell.
Daher nahm ich mit der Polizei Kontakt auf und überzeugte Inspektor Gregson davon, dass ich mir Privataufzeichnungen Ramers genauer durchsehen durfte – hinter dem Rücken des Nachlassverwalters, welcher von der Ramer-Stiftung bezahlt wurde und von Anfang an sehr abweisend und überhaupt nicht kooperativ war. Ich suchte in den Aufzeichnungen nicht nach Hinweisen auf Depressionen, wie es die Psychologen taten – womit wir wieder beim Thema des faulen Gehirns wären –, sondern nach Hinweisen auf diesen anderen Ort. Und es gab sie zuhauf. In Briefen an seinen Vater erwähnte er mehrmals das Wort ›Elderwelt‹ oder ›andere Seite der Welt‹. Er gab diesem anderen Ort verschiedene Namen. Aber noch interessanter war der Hinweis an einer Stelle, dass er gern wieder dorthin zurückkehren würde. Er erbat sich von seinem Vater die Erlaubnis, noch einmal durch den Durchgang zu gehen, bevor er studieren musste. Sein Vater verweigerte es ihm mit der Begründung, dass die Zeit noch nicht reif für ihn wäre, an jenen ›anderen Ort‹ zurückzukehren. Also war Ramer schon dort gewesen. Dieser andere Ort, diese ›Elderwelt‹, musste demnach wirklich existieren. Und der Weg dorthin führte durch einen Durchgang.
Ich suchte lange vergeblich nach diesem Durchgang, denn leider gaben Ramers Aufzeichnungen nicht preis, wie dieser Durchgang beschaffen war oder funktionierte.«
Tom überlegte kurz. »Also glauben Sie, dass Ramer durch einen Durchgang nach Elderwelt gereist ist und dort glücklich und zufrieden lebt?«
Veyron zuckte mit den Schultern. »Da könnte ich nur spekulieren, und ich spekuliere nicht gern, ohne handfeste Fakten in der Hand zu halten. Ich habe jedoch keinen Zweifel, dass Ramer Elderwelt lebend und sicher erreicht hat. Viel faszinierender fand ich allerdings die anderen Teile von Ramers Aufzeichnungen. Er beschrieb Elderwelt nie, aber er zog in einer Korrespondenz einen Vergleich mit einem erfundenen Reich, das John Rashton in seinen Fantasy-Romanen beschrieben hat.
Ramer schrieb: ›Eigentlich müsste der alte Rashton es besser gewusst haben. Seine Darstellung dieser anderen Welt ist viel zu romantisch und zu stark idealisiert. Ich frage mich, ob er sie wirklich so wahrgenommen hat, als er dort war.‹
Von da an war ich überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Also kaufte ich alles, was Rashton jemals geschrieben hatte, auch sämtliche Werke über die Werke Rashtons. Bitte hol mir doch rasch eines der Bücher, Tom.«
Tom, inzwischen völlig im Bann von Veyrons Bericht, schnippte mit den Fingern, sprang auf und eilte hinüber ins Wohnzimmer. Es war nicht schwer, die Werke Rashtons zu finden, denn Veyron hatte alle Bücher alphabetisch geordnet. Er nahm das dickste Buch heraus, ein altes Exemplar, aus dem viele lose Seiten hingen. Zahlreiche zusätzliche Zettel steckten darin. Es war so dick, dass es jemand mit einem Ledergürtel verschnürt hatte, um alles zusammenzuhalten. Er kehrte mit seiner Beute in die Küche zurück und legte das zerfledderte Werk auf den Stapel Zeitungen.
»Die Stein-des-Feuers-Trilogie. Teil eins: ›Die Weiße Königin‹. Teil zwei: ›Der Schatz der Zwerge‹. Teil drei: ›Krieg in Elfenland‹«, las Tom vom Einband ab. »Ich hatte mal damit angefangen, bin aber nie weiter als bis Seite 100 gekommen.«
Veyron seufzte enttäuscht. »Dann hast du was verpasst. Die Sprache Rashtons ist wunderschön zu lesen. Ich glaube nicht, dass heute jemand in England lebt, der unsere Sprache noch so kunstvoll benutzen kann. Aber ich studierte seine Bücher nicht deswegen, sondern durchsuchte sie nach brauchbaren Daten über Elderwelt. Ich saugte jedes kleine Fitzelchen Information in mich auf. Leider wurde das Buch dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen, wie du sehen kannst. Es ist mir aber auch heute noch eine Quelle bei Nachforschungen über fremde Wesen aus Elderwelt.«
Tom setzte sich wieder hin und konnte sich einer gewissen Ehrfurcht gegenüber diesem alten, zerfledderten Wälzer nicht erwehren. »Okay, Rashton war Ihr Wegweiser, aber Sie hatten ja immer noch keine Beweise für die Existenz Elderwelts oder einen Hinweis darauf, wie man dorthin gelangen kann«, sagte er.
Veyron nickte eifrig. Er nahm einen hastigen Schluck Kaffee, bevor er weitersprach. »Mir blieb keine andere Wahl, als meine Theorien praktisch zu überprüfen. Rashton war leider das Ende der Informationskette. Allein Ramers Bemerkungen haben mich auf diese Spur geführt, welche die Werke jedes anderen Fantasy-Autors ausschloss. Allein mit Büchern kam ich nicht weiter. Also annoncierte ich auf meiner Website, bot meine Dienste als Berater für Geisterheimsuchungen und andere unerklärliche Fälle an. Lange Zeit passierte gar nichts, doch schließlich kamen meine ersten Klienten. Ich hörte mir ihre Geschichten an und glich die gewonnenen Informationen auf Übereinstimmungen mit Rashtons Werken ab. Du musst wissen, dass Rashton Orte und Wesen sehr detailliert beschrieben hat. Sogar Stammbäume von Herrscherlinien, Landkarten und kulturhistorische Essays über die in seinen Romanen vorkommenden Geschöpfe verfasste er.
Neunzig Prozent meiner Klienten schickte ich wieder nach Hause. Ihre Geschichten waren nichts weiter als Einbildungen und Spinnereien. Denen konnte ich nicht helfen, das konnten nur Therapeuten. Lediglich ein einziger Fall erwies sich als interessant: Mr. Pete Tweed, der Inhaber eines Schrottplatzes, beklagte sich, dass er seit gut einer Woche von Kobolden heimgesucht würde. Sie klauten alle funktionstüchtigen Apparate und richteten dabei ein heilloses Chaos an. Tweeds Beschreibung der Kobolde deckte sich mit denen Rashtons. Sogar das Verhalten und die Beschreibung der Kobold-Sprache waren mit der Rashtons identisch.
Also legte ich mich auf die Lauer, genau darauf achtend, von den sensiblen Kobold-Sinnen nicht aufgespürt zu werden. Sie können im Dunkeln hervorragend sehen, noch besser riechen und auch ausgezeichnet hören. Die ersten Versuche erwiesen sich als Fehlschläge. Sie hatten mich offenbar ausgemacht und die Flucht ergriffen. Doch ich wurde vorsichtiger. Schließlich war ich imstande, die Kerle mit eigenen Augen zu beobachten.
Kobolde zählen zur Familie der Schrate, allesamt boshafte, menschenartige Kreaturen, denen auch die Orks angehören. Sie sind kurz gewachsen, krummbeinig, mit hässlichen Gesichtern und fahlen Augen. Als ich sie einmal gestellt hatte, konnte ich allerdings gegen diese Geschöpfe nicht viel ausrichten. Ich musste tatenlos zusehen, wie sie eine Menge Schrott zusammenrafften und spurlos mit ihrer Beute verschwanden – vermutlich zurück zu einem geheimen Durchgang nach Elderwelt, jenem Ort, den Rashton einst mit so schönen Worten beschrieben hat und zu dem Floyd Ramer gegangen war.
Dieses Erlebnis ließ mich weitere Spuren ungewöhnlicher Wesen suchen. Ich stieß vor drei Jahren auf die Vampire von Surrey, drei Brüder, die einige abscheuliche Morde begangen haben. Inspektor Gregson hielt mich für einen Verrückten, als ich ihm meine Theorie vortrug, genau wie Willkins und die anderen vom Revier. Inzwischen tun sie das nicht mehr. Wahrscheinlich wegen der Vampire und ihres unschönen Abgangs im Sonnenlicht. Hmm. Vielleicht doch eher wegen des Trolls, den ich vor zwei Jahren aufspürte? Er hatte die Nachbarschaft von Woking terrorisiert und dort mit Vorliebe Bäume ausgerissen und Scheiben eingeschlagen, ganz zu schweigen von den drei Opfern, die er aufgefressen hat. Oder wegen der Kobolde, die in Notting Hill Autos anzündeten – wahrscheinlich dieselbe Bande, die schon Tweeds Schrottplatz geplündert hatte. Dieses Abenteuer endete in einer üblen Schießerei, es floss eine Menge Koboldblut. Es ist übrigens schwarz, falls dich mal jemand danach fragen sollte.«
Tom starrte Veyron an. Er suchte nach einem Anzeichen, dass er erneut veralbert wurde, oder dass Veyron irgendwie anderweitig verrückt war. Jane hatte gestern Nacht jedoch nicht gelacht, ebenso wenig Dr. Strangley. Einen dermaßen Verrückten würde die Polizei sicherlich nicht frei herumlaufen lassen. Also blieb nur ein einziger Schluss übrig: Alles, was Veyron Swift gesagt hatte, musste die Wahrheit sein. Toms Aufregung kehrte zurück. Für einen Moment suchte er nach den richtigen Worten. »Wow. Cool«, war alles, was er herausbrachte.
Das rang Veyron ein Lächeln ab. »Ja, das war damals auch meine erste Reaktion«, meinte er. Sein Lächeln wurde noch breiter, nicht wegen der Anerkennung, die er von Tom erfuhr, sondern wegen der Textnachricht, die soeben auf seinem Smartphone erschien. Ich hab was Interessantes für Sie. Dury Manor, Library Street, Brentford. Gregson.
Er zeigte die Nachricht Tom, der vor Aufregung die Tischkante umkrallte. Etwas Tee schwappte über den Tassenrand, weil er dabei die Tischdecke verzog.
»Bist du also für ein weiteres Abenteuer bereit, Tom?«, fragte Veyron.
Tom sprang sofort vom Stuhl, so heftig, dass Teller und Tassen beinahe fliegen lernten. »Jederzeit, Sir!«
Sie riefen ein Taxi, ein klassisches Black Cab, da Veyron kein Auto besaß, und im Nu befanden sie sich auf dem Weg nach Brentford. Ihr Ziel war ein großes Anwesen mit einem sehr üppigen, gepflegten Garten voller uralter Bäume. Mittendrin stand Dury Manor, ein sakral anmutendes Gutsherrenhaus aus rotem Backstein, alt und verwittert.
Am Eingang wurden sie von Jane empfangen, die sie sofort hineinführte. Das Innere des Hauses war auf sehr altmodische Weise eingerichtet, aber Tom fand es dennoch recht gemütlich. Überall große Plüschmöbel und Ohrensessel, orientalische Teppichböden und Holz getäfelte Wände. Von den Decken hingen eiserne Kronleuchter. Nirgendwo ein Schimmer der Moderne. Wer auch immer hier wohnte, er mochte die heutige Welt nicht und schwelgte in der Vergangenheit des frühen 20. Jahrhunderts, als England noch ein Empire war. An den Wänden hingen Gemälde verschiedener – wahrscheinlich bedeutender – Personen, die Tom jedoch alle nicht kannte.
Veyron ging voraus, führte Tom durch die Absperrungen der Polizei, und sie gelangten zu Gregson, der im Wohnzimmer schon auf sie wartete. Der Inspektor, der sein silbergraues Haar in militärisch strenger Bürstenfrisur trug, kaute auf einem Kugelschreiber herum, während seine wachen Augen den Tatort abtasteten.
»Ah, Gregson, der beste Mann vom CID. Was haben Sie für mich?«, fragte Veyron mit einer Selbstverständlichkeit, als würde er die Ermittlungen leiten und nicht der Inspektor.
»Sieht nach Mord aus. Kommen Sie rein, Veyron. Der arme Kerl liegt noch im Arbeitszimmer«, erwiderte Gregson.
Sie verließen das Wohnzimmer durch eine Seitentür und betraten das Arbeitszimmer, das in Toms Augen wie ein zweites Wohnzimmer aussah (auch hier wieder bequeme Plüschmöbel), nur dass zusätzlich noch ein kleiner Schreibtisch in der Mitte des Raumes stand. Dahinter lag ein älterer Mann zusammengekrümmt auf dem Boden. Das gutmütige, runde Gesicht des Toten, das von schneeweißem Haar umrahmt wurde, machte Tom betroffen. Er wirkte, als sei er nett gewesen, etwa so, wie er sich immer seinen Großvater vorgestellt hatte. Der wohlgenährte Leib des Mannes steckte in einem altmodischen Tweed-Anzug. Eine weinrote Weste spannte sich über einem weißen Hemd. Seine Gesichtszüge waren nicht schmerzverzerrt, sondern wirkten auf seltsame Art und Weise friedlich. Nichts hätte auf einen Mord hingedeutet, befände sich nicht auf Höhe seines Herzens ein faustgroßer, pechschwarzer Fleck.
»Professor Lewis Daring, 83 Jahre alt, ehemaliger Oxfordprofessor. Von vorne erstochen. Die Klinge ging durch die Brust, mitten durch sein Herz, und hinten wieder raus. Jane …« Gregson drehte sich zu der Polizistin um. Jetzt erst entdeckte er Tom, der wie gebannt vor der Leiche stand. Veyron hatte sich inzwischen gebückt und untersuchte den Toten von allen Seiten. Gregson schüttelte verärgert den Kopf. »Veyron, das geht zu weit! Sie können keine Kinder an einen Tatort mitnehmen! Warum besorgen Sie ihm keinen Ferienjob? Was macht er hier überhaupt?«, schimpfte er.
Tom biss sich auf die Lippe. Am liebsten hätte er sich irgendwo versteckt.
»Er hat einen Ferienjob, und zwar bei mir. Tom ist mein Assistent, und soeben assistiert er mir«, antwortete Veyron im beiläufigen Tonfall.
Gregson stellte das jedoch nicht zufrieden. »Bei Ihnen? Sie haben gar keinen echten Beruf, Sie werden nicht einmal bezahlt!«, konterte er zornig.
Veyron schenkte ihm einen genervten Blick. »Ich bin finanziell unabhängig, für Tom ist gesorgt, das wissen Sie genau. Was soll diese Zeitverschwendung? Hier wurde ein Mord begangen. Darauf sollten wir uns konzentrieren!«
Gregson atmete tief durch und fuhr sich mit der Hand über die gerunzelte Stirn. »Tom ist aber nicht finanziell unabhängig! Irgendwann wird er allein Geld verdienen und seinen Mann stehen müssen. Wie soll ihm das gelingen ohne eine Vorstellung davon, wie es im echten Leben läuft? Für einen Vierzehnjährigen ist das, was Sie hier machen, keine Alternative. Constable Willkins, bringen Sie den Jungen raus. Er hat hier nichts verloren!«
Jane drehte Tom an der Schulter herum und erklärte ihm halblaut, während sie ihn aus dem Raum dirigierte, dass Gregson recht hätte und es klüger wäre, draußen zu warten. Es sei überhaupt ein Fehler gewesen, hierherzukommen.
Veyron riss das Hemd des Professors auf und stieß einen jauchzenden Schrei der Begeisterung aus. Jane und Tom hielten inne, und auch Gregson schenkte ihm wieder seine ganze Aufmerksamkeit.
»Sehen Sie nur: kein Blut! Die Stichwunde ist sowohl an der Ein- wie auch der Austrittsstelle kauterisiert. Man riecht es, verbranntes Fleisch. Mit was auch immer der arme Mann durchbohrt wurde, es muss glühend heiß gewesen sein. Zeitpunkt des Todes dürfte zwischen ein und zwei Uhr morgens liegen, ausgehend vom momentanen Stadium der Totenstarre.«
Gregson bestätigte das. Der Gerichtsmediziner war zu demselben Schluss gelangt. Veyron tastete Darings Leiche von oben bis unten ab, fasste ihm in die Hosen- und Westentaschen. Er untersuchte die Taschenuhr des Professors, danach die Brille, die Daring vom Gesicht gerutscht war.
»Der Professor war körperlich in bester Verfassung, er hatte keine zittrigen Hände und besaß für sein Alter ein hervorragendes Augenlicht. An der Uhr finden sich keinerlei Kratzer von Fingernägeln, die Brillengläser sind nur hauchdünn. Hinzu kommen ausgeprägte Muskeln an Armen und Beinen. Ich fürchte, mein lieber Inspektor, wir sind hier keinem gewöhnlichen Mörder auf der Spur. Der Professor war ein starker, kerngesunder Mann, sicherlich kein wehrloses Opfer«, schlussfolgerte er.
Gregson stimmte brummend zu. »Deswegen habe ich Sie ja auch hergerufen. Daring wurde von einer langen, etwa fünf Zentimeter breiten Klinge durchbohrt, vermutlich ein Schwertstich, aber der Gerichtsmediziner hat so etwas noch nie gesehen.«
Veyron unterzog die Stichwunde einer intensiven Untersuchung. »Zweifelsohne eine zweischneidige Klinge, vermutlich über einen Meter lang. Wurde eine entsprechende Waffe im Haus gefunden? Ich würde es allerdings bezweifeln«, sagte er mit erstaunlicher Gelassenheit.
»Doch«, konterte Gregson, »wir wissen, dass sich ein Schwert im Besitz des Professors befand. Es hing oben in seinem Lesezimmer, ist allerdings verschwunden. Eine sehr sonderbare Waffe, wie ich sie noch nie gesehen habe. Es gibt ein Foto von Daring und seinem Vater, oben im Schlafzimmer. Darauf kann man das Schwert in seiner Halterung gut erkennen.« Er schnippte mit den Fingern.
Sofort eilte ein junger Sergeant los, nur um ein paar Augenblicke später mit besagtem Bild zurückzukehren. Unverzüglich reichte er es an Veyron, der es prüfend musterte.
Auf der Aufnahme toasteten zwei ältere Herren, ein etwas jüngerer Daring und sein schon recht betagter Vater, mit Champagnergläsern der Kamera zu. Hinter ihnen hing besagtes Schwert an der Wand. Es war eine wunderschöne, elegante Waffe, die Klinge lang und schmal, fast wie ein Rapier. Der Griff wurde von einem verschnörkelten Korb eingefangen. Das Auffälligste war jedoch ein Muster aus blauen Edelsteinen, welches der Schmied in die Klinge eingearbeitet hatte.
»Dieses Schwert ist der einzige fehlende Gegenstand im ganzen Haus. Das hat uns die Haushälterin des Professors bereits bestätigt. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um die Mordwaffe handelt und der Täter diese im Lauf der Flucht weggeworfen hat. Meine Leute suchen deshalb jetzt die nähere Umgebung ab. Ich bin sicher, wir werden sie spätestens morgen gefunden haben«, sagte Gregson.
Veyron winkte ab. »Das war nie und nimmer die Tatwaffe. Die Klinge ist nicht bereit genug für die Stichwunde des Professors. Sie sagten, das Schwert sei verschwunden?«
Er reichte das Bild an Tom, doch Jane riss es ihm sofort aus den Händen. »Fingerabdrücke!«, schimpfte sie. »Das ist als Beweis jetzt ruiniert!«
Gregson überging ihr Gezeter und nickte Veyron zu. »Im ganzen Haus unauffindbar. Glauben Sie, es war Raubmord? Orks vielleicht oder wieder Kobolde?«
»Nein, auf gar keinen Fall. Kobolde oder Orks hätten hier eine Verwüstung hinterlassen. Beachten Sie: keine Anzeichen von Folter oder anderer Gewalt, nirgendwo die Spur eines Kampfes. Keine zerbrochenen Möbel, Vasen oder Gläser. Was noch viel beängstigender ist: nirgendwo ein Ofen, in dem man eine Klinge zum Glühen hätte bringen können. Die Tatwaffe muss demnach ein magisches Schwert sein, das von allein zu glühen oder gar zu brennen anfängt. Ich denke, das hier ist etwas ganz Neues; es übersteigt alles, mit dem wir es in den letzten acht Jahren zu tun hatten«, schlussfolgerte Veyron. Er schnippte mit den Fingern und blickte in die Runde ratloser Polizistengesichter. »Zusatzfrage: Warum sollte jemand, der sich im Besitz eines Zauberschwerts befindet, sich die Mühe machen und hier einbrechen, nur um ein anderes Schwert zu stehlen? Das ergibt keinen rechten Sinn. Für das Verschwinden von Darings Schwert muss es also eine andere Erklärung geben. Unsere Probleme sind ein Flammenschwert und dessen Inhaber«, mahnte er.
Tom bekam es ein wenig mit der Angst zu tun. Der Gedanke, dass da irgendwo in London ein Unhold unterwegs war, der ein Zauberschwert bei sich trug, behagte ihm gar nicht.
Veyron untersuchte den Schreibtisch, öffnete die Schubladen und blätterte den Terminkalender und die Korrespondenz des Professors durch. Gregson sah ihm dabei nur neugierig zu, während Willkins ungehalten die Arme verschränkte. Tom machte es sich derweil auf einem nahen Plüschsofa gemütlich. Ihn hatten die Erwachsenen fürs Erste vergessen. Zum Glück! So konnte er nun in Ruhe alles beobachten.
»Sarah Burrows, unsere Geköpfte von letzter Nacht, war Darings Sekretärin. Dass alle beide durch außernatürliche Kräfte ums Leben kamen, ist besorgniserregend. Es muss eine Verbindung geben. Die kann nur Folgende sein: Der Professor war im Besitz von Informationen, die für den Mörder eine Gefahr bedeuteten. Informationen, die der Professor an jemanden weitergeben wollte. Darum musste Miss Burrows sterben. Sie war für die Korrespondenz des Professors zuständig, vereinbarte Termine und erledigte allen geschäftlichen Schreibkram. Für unseren Täter war es nur logisch, anzunehmen, dass sie diese brisanten Nachrichten auch nach Darings Tod an Darings Kontakte weitergeben würde. Daring besitzt keinen Computer, nirgendwo im ganzen Haus. Und wenn man sich hier so umsieht, wusste er mit moderner Elektronik wohl auch nichts anzufangen. Er tippte noch immer – vollkommen anachronistisch – auf einer Schreibmaschine. Also war er auch bei der Übermittlung von Nachrichten auf die althergebrachten Methoden angewiesen.
Unser Täter wusste das. Deshalb tötete er Miss Burrows in der Hoffnung, die brisante Nachricht abzufangen. Das arme Mädchen war jedoch gar nicht in ihrem Besitz. Also war als Nächstes Daring an der Reihe. Offenbar war er für den Mörder die größere Gefahr, weswegen er nicht wieder seine Riesenbestie einsetzte, sondern diesmal selbst Hand anlegte. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wen der Professor eigentlich warnen wollte – und weswegen. Eventuell können wir das nächste potenzielle Opfer unseres Freundes mit dem Flammenschwert – ich nenne ihn jetzt mal Joe – identifizieren und warnen«, schlussfolgerte Veyron blitzschnell. Er schloss die Schubladen wieder und sah sich weiter um.
Gregson und Jane schenkten sich ratlose Blicke. Tom schaute neugierig zu, wie Veyron mit nervös herumzuckenden Händen den Schreibtisch durchsuchte, als wären seine Finger Fühler, die – Sensoren gleich – in der Lage waren, von allein das Gesuchte aufzuspüren.
»Woher wissen Sie, dass er jemanden warnen wollte? Vielleicht hat Flammenschwert-Joe die Quelle der Gefahr mit dem Mord an Daring bereits zum Schweigen gebracht«, meinte Gregson.
Veyron schüttelte nur den Kopf. Nacheinander deutete er auf das Arbeitszimmer, die Wände, die Vitrinen, die Plüschmöbel und zuletzt auf den toten Professor. »Schauen Sie sich um: Nichts ist zerstört, nichts aufgebrochen und durchwühlt. Alles wurde feinsäuberlich so belassen wie vor dem Mord. Ich stelle mir das Ganze so vor: Joe verschafft sich Zugang zum Haus. Wahrscheinlich weiß der Professor bereits, dass er kommen wird, hat es aus dem grausamen Tod seiner Sekretärin geschlossen. Joe fürchtet die Stärke des Professors, darum muss er diese Tat selbst ausführen. Niemand sonst hätte Aussicht auf Erfolg und in engen Räumen kann er seine Bestie ja schlecht einsetzen. Doch der Professor ist gewarnt und erwartet seinen Feind im Arbeitszimmer. Er sitzt hinter dem Schreibtisch, begrüßt Joe, als dieser hereinkommt, und informiert ihn, dass es zu spät ist. Die brisante Information wurde bereits weitergegeben. Joe packt die Wut, denn seine Machenschaften drohen zu scheitern. Er ist ein böswilliger Kerl, der – wie seine Kreatur – zu schrecklicher Gewalt neigt. Die arme Miss Burrows könnte das sicher bestätigen, säße ihr der Kopf noch auf den Schultern. Joe zieht sein Schwert, sticht es dem Professor durchs Herz. Daring hat den Tod jedoch erwartet; er leistet keine Gegenwehr. Wahrscheinlich weiß er, dass er Joe nicht gewachsen ist. Er ist allerdings zuversichtlich, dass jemand anderes Joe zur Strecke bringen wird – mit der Information, die er rechtzeitig weiterleiten konnte.
Joe dagegen erkennt, dass er einen Fehler begangen hat, einen entscheidenden Fehler. Die Zeit läuft ihm davon. Er ahnt, wen der Professor benachrichtigt hat. Es kann nur ein ausgesprochen kleiner Zirkel von Leuten sein, von Joe längst ausgespäht und beobachtet. Er bricht auf, verlässt unverzüglich das Haus des Professors, ohne die Akten zu durchwühlen oder weitere Zerstörung anzurichten. Er muss schnell handeln, seine Pläne sind in Gefahr.«
Alle waren still, als Veyron seine Ausführungen beendete. Gregson rieb sich gestresst die Augen. »Selbst wenn Sie mit Ihren Annahmen recht haben, fehlt uns noch immer jegliche Spur zum Täter. Darings Mörder hat nirgendwo Finger- oder Fußabdrücke hinterlassen. Wir können nicht einmal seine nächsten potenziellen Opfer warnen. Wem Daring diese brisanten Informationen gegeben haben könnte, wissen wir nicht«, meinte er ein wenig vorwurfsvoll.
Veyron ließ sich davon jedoch kaum in seiner Begeisterung für den Fall bremsen. Er nahm einfach eines der Notizbücher des Professors zur Hand und schlug es auf.
Gregson stöhnte aufgebracht. »Sie sollen doch am Tatort nichts verändern! Und schon gar nichts anfassen!«
Veyron zuckte in gleichgültiger Geste mit den Schultern. »Ein unwichtiger Einwand, mein lieber Gregson. Viel wichtiger ist dagegen ein Blick in den Terminkalender. Der verrät uns nämlich einiges. Professor Daring traf sich in den letzten zwei Wochen nur mit sehr wenigen Leuten, zumeist ehemaligen Professorenkollegen oder Vertretern von Universitäten. Allerdings taucht in diesem Terminkalender immer wieder ein Name auf, der mir regelrecht ins Auge sticht: Nagamoto Tatsuya. Daring rief ihn in den letzten zwei Wochen öfter an. Das ist zweifellos unser Mann«, meinte er lapidar und klappte den Terminkalender des Professors wieder zu.
»Sie wissen jetzt, wer oder was der Mörder ist. Er ist nicht von dieser Welt, also werden Sie ihn kaum in London ausfindig machen. Geschweige denn, dass Ihre lächerlichen Schusswaffen für ihn eine Gefahr sein würden. Der Kerl rennt mit einem Flammenschwert herum, und er besitzt die Kontrolle über ein Monster, das einem den Kopf abbeißt. Wenn ich mich nicht irre, befindet sich Flammenschwert-Joe in diesem Moment auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort ist nämlich der Sitz der Energreen Corporation.«
»Einen Moment!«, protestierte Jane. »Was hat die Energreen Corporation damit zu tun? Woher wollen Sie überhaupt wissen, dass Nagamoto Darings Kontakt ist? Es könnte auch jeder andere aus dem Kalender sein.«
Veyron seufzte enttäuscht und drückte sich für einen Moment mit Daumen und Zeigefinger die Augenlider zu. »Willkins, Willkins, Willkins … Da fällt mir spontan Tolkien ein: Am besten, Sie gehen wieder ins Bett, Ihr Verstand schläft nämlich noch! Nagamoto Tatsuya, oder Tatsuya Nagamoto – wenn Ihnen die europäische Schreibung seines Namens geläufiger sein sollte – ist der stellvertretende Vorsitzende eines Energiekonzerns, der Energreen Corporation. Die verkaufen Strom aus Solar-, Wind- und Wasserkraft. Ich habe davon in der Zeitung gelesen, weil Energreen eine feindliche Übernahme durch einen Hedge Fonds droht, Borgin & Bronx, wenn ich mich recht erinnere. Nagamoto ist also nicht gerade der typische Gesprächspartner für einen alten Bücherwurm wie Daring, der sich vornehmlich für Kunst, germanische und keltische Mythen und gutes Essen interessiert. Haben Sie etwa noch keinen Blick auf die Bücher geworfen, die hier überall in den Vitrinen stehen? Mit Energiewirtschaft hatte Daring wirklich nichts am Hut. Warum also taucht in seinen Aufzeichnungen ständig ein Energiemanager auf? Ganz klar: Weil Nagamoto Darings Vertrauter ist. Damit ist er unser Mann! Vergessen Sie außerdem diese Blitzerscheinungen am Himmel nicht.«
Jane und Gregson schauten sich verblüfft an, und dann zu Tom, der jedoch in ratloser Geste mit den Schultern zuckte. Veyron atmete tief durch und verdrehte entnervt die Augen. Vermutlich konnte er nicht fassen, wie sechs Augen und drei Gehirne gleichzeitig so wenig begriffen. Er zückte sein Smartphone und tippte wie verrückt darauf herum, während er in ungeduldigem Tonfall und mit rasender Geschwindigkeit sprach. »Diese seltsamen, gewitterfreien Blitze, die seit vierzehn Tagen unregelmäßig von verschiedenen Piloten beobachtet wurden. Seit ihrem ersten Auftauchen über dem Atlantik telefonierte Daring ständig mit Nagamoto. Sie konferierten darüber. Im Terminkalender steht es eindeutig. Nagamoto. Wegen Blitzerscheinungen. Steht da überall. Haben Sie das übersehen? Ist Nagamoto Meteorologe? Nein, er verkauft Solarstrom und hat Betriebswirtschaft studiert. Das verrät mir seine Vita auf der Energreen-Homepage. Vielleicht sollten Sie besser alle wieder ins Bett gehen.«
Gregson hob beruhigend die Hände. Er ging zu Veyron und klopfte ihm anerkennend auf den Rücken. »Schon gut, schon gut. Sie haben gewonnen. Gute Arbeit, wirklich. Also, Nagamoto ist unser Mann. Was haben Sie jetzt vor?«
Als Antwort darauf eilte Veyron nach draußen, packte im Vorbeigehen Tom und zog ihn hinter sich her. »Ich fliege nach New York – und zwar auf der Stelle. Tom kommt mit mir. Sie können derweil nach einem riesigen, insektenähnlichen Wesen Ausschau halten. Fragen Sie die Bauern in Londons Norden. Da haben einige gewiss was Ungewöhnliches gesehen oder gehört. Wahrscheinlich haben die gedacht, sie seien verrückt. Lassen Sie Ihre Leute mit schweren Waffen ausrüsten, das Ding ist riesig und sehr gefährlich. Damit meine ich nicht einen dummen Troll. Widerstehen Sie außerdem der Versuchung, vorschnell mit Nagamoto Kontakt aufzunehmen. Wir wissen nicht, ob seine Leitung abgehört wird. Jedes Wort von Ihnen könnte unserem Gegner einen Vorteil verschaffen und Nagamoto gefährden. Ich werde ihn selbst aufsuchen und Sie dann auf dem Laufenden halten. Derweil können Sie die anderen Kontakte aus seinem Terminkalender abklappern – auch wenn das wahrscheinlich nichts bringen wird. Aber Vorschriften sind Vorschriften. Also dann, weiter geht’s mit Schwung!«
Kurz darauf saßen Tom und Veyron wieder in einem Black Cab und fuhren in Richtung Flughafen. Tom beklagte, dass er keinerlei Gepäck dabeihatte, noch nicht einmal was zum Anziehen. Für Veyron war dies das geringste Problem. Sie würden sich am Flughafen das Nötigste für den Überflug besorgen und sich Ersatzkleidung in New York kaufen. Tom war einverstanden, bis ihm in den Sinn kam, dass er überhaupt kein Geld besaß.
Veyron winkte jedoch ab. »Keine Sorge, ich bezahle alles. Hauptsache, wir kommen baldmöglichst nach New York. Wir könnten jetzt wirklich ein sehr schnelles Flugzeug gebrauchen. Zu dumm, dass es davon kaum welche gibt. Flammenschwert-Joe hat mindestens fünf Stunden Vorsprung. Garantiert hat er die erste Maschine genommen und den Atlantik inzwischen zur Hälfte überquert. Wir werden ihn nicht mehr einholen. Mit etwas Glück ist Nagamoto vorgewarnt und wird Vorsichtsmaßnahmen treffen«, sagte er, lehnte sich zurück und verfiel wieder in sein stilles Grübeln.
Wer konnte erahnen, welche Gedanken durch sein Gehirn schossen, wie viele Theorien und Möglichkeitsvarianten er gleichzeitig ersann, überprüfte und wieder verwarf? Zumindest ist es in seinem Kopf nicht langweilig, dachte Tom mit einer Mischung aus Respekt und Ehrfurcht. Er hatte England noch nie in seinem Leben verlassen, und morgen wäre er mit einem Mal in New York. Das kam alles ein bisschen plötzlich und erschien ihm sehr abenteuerlich.
Veyron erriet seine Gedanken (vermutlich las er sie einfach Toms besorgtem Gesichtsausdruck ab). Er lächelte beruhigend. »Wir sind rechtzeitig bis Schulanfang wieder zurück, das versichere ich dir. Falls es dennoch Verspätungen gibt, werde ich Willkins benachrichtigen.«
Tom grinste vor Begeisterung von einem Ohr zum anderen. »Eigentlich sind Sie gar nicht so übel, wenn man Sie mal ein bisschen näher kennt«, meinte er.
Veyron seufzte. »Lass das nicht Willkins wissen. Du könntest dich da bei ihr glatt unbeliebt machen. Ich versuche lediglich, effizient zu sein, Tom. Effizienz bedeutet in vielen Fällen Geschwindigkeit. Und deshalb kann ich es mir nicht leisten, auf die Gefühle anderer Menschen großartig Rücksicht zu nehmen. Darauf zu achten, wer durch welches Wort wann und wie beleidigt wird, ist Zeitverschwendung und bringt uns alle in der Sache nicht voran. Wie du siehst, drängt die Zeit, wenn Leben in Gefahr sind. Ich hoffe, Willkins wird das eines Tages verstehen, und du ebenfalls. Deshalb nehme ich dich auf dieses Abenteuer mit. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich auf dich verlassen kann, wenn’s darauf ankommt.«
Tom glühte vor Verlegenheit und wusste gar nicht, was er jetzt sagen sollte.
Veyron gestattete sich ein kleines, spitzbübisches Lächeln, griff in seine Manteltasche und kramte darin herum. »Hier, ein kleines Geschenk«, sagte er und hielt Tom einen weißen Briefumschlag hin. Das Kuvert zierten lediglich ein paar Worte am unteren rechten Eck. Mit kunstvollen, geschwungenen Buchstaben, per Hand geschrieben, stand dort eine Adresse.
»Was ist das?«
»Korrespondenz von Professor Daring.«
»An die Weiße Königin«, las Tom vor und blickte verdutzt zu Veyron. »Haben Sie das etwa vom Tatort mitgehen lassen?«, fragte er erschrocken.
Veyron blieb ihm die Antwort schuldig, aber die Wahrheit war ja offensichtlich. »Mach ihn auf, er ist nicht verschlossen.«
Tom öffnete den Umschlag und holte einen sauber zusammengelegten Briefbogen heraus. Er faltete ihn auseinander und glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. Das Papier war vollkommen leer. »Ist ja komisch. Warum steckt Daring ein leeres Blatt ins Kuvert?«, fragte er und reichte das Papier an Veyron.
Der hielt es gegen die Scheibe und untersuchte es genau. »Sehr teures Papier, wie es in keinem normalen Büro verwendet wird. Darauf schreibt man keine Geschäftsbriefe; der Adressat muss also jemand Besonderes sein, jemand, den Daring tief verehrt hat. Allein schon die Qualität des Papiers ist Liebesbeweis genug.« Er drückte das Blatt an die Scheibe und ging mit seinen Augen ganz nah heran, kratzte mit dem Fingernagel über das Dokument. »Es wurde beschrieben. Mit Zaubertinte, würde ich spontan sagen. Ich kann feine Linien ausmachen, die wohl Buchstaben sind. Sehr wahrscheinlich eine geheime Botschaft für die Weiße Königin, wer immer das sein mag. Sicher der Deckname für Darings Geheimkontakt, eventuell Nagamoto oder jemand anderes. Wenn wir wieder zu Hause sind oder sonst irgendwo Zugang zu einem chemischen Labor haben, werden wir sie genau untersuchen und herausfinden, wie man diese Tinte wieder sichtbar macht«, sagte Veyron, faltete das Papier zusammen und reichte es zurück an Tom. »Das ist sehr wichtig, Tom. Bewahre den Brief gut auf, trage ihn immer bei dir. Sehr wahrscheinlich hängen Menschenleben davon ab, eventuell sogar noch weitaus mehr. Ich bin überzeugt, dass wir gerade dabei sind, eine riesige Verschwörung aufzudecken.«
Tom steckte den Brief zurück in den Umschlag und verwahrte ihn sicher in der Innentasche seiner Jacke. Gerade wollte er Veyron versichern, dass niemand außer dem Tod ihm diesen Brief abnehmen könnte, als sein Patenonkel auch schon wieder das Wort ergriff.
»Ich habe es Gregson nicht gesagt, aber ich konnte noch mehr Hinweise in der Korrespondenz des Professors finden. Sagt dir das Juwel des Feuers etwas?«
Tom schüttelte den Kopf. »Noch nie gehört. Klingt wertvoll. Wissen Sie mehr? Natürlich wissen Sie mehr, Sie wissen immer mehr.«
Veyron lachte kurz, lehnte sich zurück und dachte kurz nach. »Ich fürchte, ich kann mich nur auf das berufen, was Rashton dazu in seinen Büchern schrieb. Vor langer Zeit gab es in Elderwelt einmal sieben magische Juwelen. Sie wurden die Nuyenin-Steine genannt. Zwei Juwelen dienten dem Wissen und dem Leben, vier den Elementen, darunter das besagte Juwel des Feuers. Dann gab es noch einen Meisterstein, durch den die Kraft aller gebündelt werden konnte. Ihre Macht war verheerend. Armeen konnte man mit ihnen vernichten, Seen austrocknen und sogar Berge einstürzen lassen. Länder wurden verwüstet und ganze Völker ausgelöscht. Soweit die Überlieferungen vollständig sind, gab es keine schrecklichere Macht in Elderwelt«, erklärte Veyron schließlich.
Tom schnappte nach Luft und krallte sich in den Filz der Sitzbank. »Was ist mit den Juwelen geschehen?«, fragte er aufgeregt.
»Sie galten als verschollen – bis heute. Offenbar sind jetzt Spuren davon aufgetaucht. Zumindest war es dem Professor sehr wichtig, mehr darüber zu erfahren. Ich bin davon überzeugt, dass Flammenschwert-Joe hinter den gleichen Informationen her ist. Nach allem, was wir von diesem Schurken wissen, sollte uns der Gedanke nicht gefallen, dass er das Juwel des Feuers zuerst findet. Nein, das müssen wir auf jeden Fall verhindern.« Veyron tauchte wieder in die undurchschaubare Welt seiner Gedanken ab. Mit starren Augen blickte er aus dem Fenster und nahm seine Umwelt nicht mehr weiter wahr.
Eine Stunde später befanden sich bereits auf dem Weg nach New York.