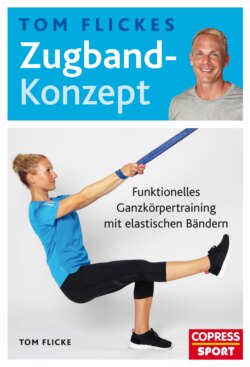Читать книгу Tom Flickes Zugband-Konzept - Tom Flicke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zugbandkonzept vs. Gerätetraining
ОглавлениеUnterschiede zwischen Zugbandkonzept und Gerätetraining zeigen sich vor allem bei
1.der Messbarkeit des Widerstands,
2.dem ansteigenden Spannungswiderstand und damit auch gelenkschonenden Bewegungsausführung,
3.der Alltagstauglichkeit und
4.dem koordinativen Anspruch
der Übungen.
Der erste und augenscheinlichste Unterschied ist sicherlich, dass beim Gerätetraining die bewältigte Last klar messbar ist. Für viele Fitnessbegeisterte ist es sehr wichtig, ein in Kilogramm ausgedrücktes Feedback zu erhalten, um sich mit den Trainingspartnern zu vergleichen bzw. ihre eigenen Fortschritte festzustellen. Das Zugband bietet diesen messbaren Erfolg nicht, auch wenn selbstverständlich ein Unterschied in der aufgewendeten Kraftleistung in Abhängigkeit von der Wahl des Bands und vom Abstand zur Fixierung erkennbar ist.
Mittlerweile geben einige Hersteller von Zugbändern auch Referenzwerte für die zu überwindende Kraft in Pfund bzw. Kilogramm für das jeweilige Band an, die aber immer noch sehr ungenau sind.
Um die eigentlich aufgewendete Kraft zu bestimmen, muss die Dehnung des Bands betrachtet werden. Das abgebildete Kraft/Widerstand-Dehnungs-Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der entwickelten Kraft in Abhängigkeit der Dehnung für die Zugbänder (REVOLVE) der Firma FLEXVIT™.
Dabei wird deutlich, dass die Kraftentwicklungskurven aller Zugbänder mit zunehmender Dehnung einen mehr oder weniger stark ausgeprägten exponentiellen Verlauf aufweisen. Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, dass sich die Kraftentwicklungskurven jeweils auf einen Strang des Zugbands beziehen. Da sämtliche Übungen aber mindestens zwei nebeneinander befindliche Stränge erfordern, muss die entwickelte Kraft also verdoppelt werden. Wenn das aneinanderliegende Zugband z. B. beim beidarmigen Latzug in der Mitte noch einmal geteilt wird, also vier Stränge des Zugbands parallel arbeiten, muss zur Ermittlung der in der Endposition aufgewendeten Kraft der abgelesene Kraftwert in Kilogramm folglich vervierfacht werden.
Dieser Zusammenhang soll am Beispiel des Butterfly Reverse mit dem blauen Zugband noch einmal verdeutlicht werden. In der Ausgangsposition beträgt die Länge des Zugbands ohne Spannung, d. h. in unserem Fall der Abstand zwischen den beiden Handkanten, ca. 70 cm. Diese 70 cm sollen im Folgenden 100 Prozent entsprechen. In der Endposition beträgt der Abstand zwischen den Handkanten ca. 140 cm, d. h. wir haben einen Längengewinn des Zugbands von ca. 100 Prozent erreicht. Diese 100-Prozent-Dehnung bedeutet wiederum gemäß Kraft/Widerstands-Dehnungs-Diagramm einen Kraftaufwand von ca. 9 kg in der Endposition für einen Strang des blauen Zugbands. Verdoppeln wir also den Wert, können wir festhalten, dass in der Endposition mit ca. 18 kg an beiden Enden, d. h. an beiden Schultern gearbeitet wurde. Das schwarze Band hätte in der Endposition sogar einen Kraftaufwand von ca. 22 kg bedeutet.
Kraftentwicklung beim Butterfly Reverse
Hieraus leitet sich der zweite Unterschied ab, nämlich der ständig ansteigende Spannungswiderstand während der Übungsausführung. In Abhängigkeit von der Bewegungsamplitude mit dem Zugband muss sich der Trainierende gegen einen ständig größer werdenden Widerstand behaupten. Beim klassischen Gerätetraining hingegen bleibt ein einmal eingestelltes Gewicht während der gesamten Bewegungsausführung gleich. Dieser Unterschied ist sicherlich der entscheidende Vorteil gegenüber dem Gerätetraining, weil das Muskelpotenzial maximal ausgeschöpft wird. Genau wie bei der Kette, die nur so stark wie ihr schwächstes Glied sein kann, gibt es bei jeder Übung einen bestimmten Gelenkwinkel, bei dem der Muskel die geringste Kraft entfaltet. Dieser sogenannte »Weak Point« kann als limitierender Faktor gesehen werden, da er das maximale Gewicht vorgibt, das bei einer Übung verwendet werden kann. Und zwar unabhängig davon, dass nach dem Überwinden dieses Punktes deutlich höhere Kraftwerte entfaltet werden könnten.
Weak Point beim Bizeps-Curl
Betrachten wir nun die Bewegungsamplitude beim klassischen Bizeps-Curl. Bei diesem wird der Weak Point erreicht, wenn sich der Unterarm in einer waagrechten Position befindet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zu diesem Zeitpunkt die Schwerkraft und der Hebel über dem Unterarm am stärksten wirken. Ist dieser Punkt einmal überwunden, könnte der Armbeuger – theoretisch – auch deutlich höhere Kraftwerte erreichen. Zur maximalen Ausschöpfung des Kraftpotenzials müssten sich also ab diesem Weak Point die Gewichte sukzessive erhöhen, was durch die ansteigende Widerstandsentwicklung beim Zugbandtraining stets gegeben ist und das Training dadurch auch besonders gelenkschonend macht.
Der dritte und der vierte Unterschied resultieren daraus, dass der Trainierende die Bewegungsrichtung – im Unterschied zum klassischen Gerätetraining – aufgrund der Schwerkraftunabhängigkeit selbst bestimmen kann. Weil Bewegungen den Körper im Alltag wie im Sport überwiegend mehrdimensional beanspruchen, eignet sich das Zugbandkonzept stets als alltagstaugliches und sportartspezifisches Training. Durch diesen Zugewinn an Freiheit, verknüpft mit der Mehrdimensionalität der Bewegungen, ist offensichtlich, dass dem Trainierenden immer auch eine koordinative Komponente abverlangt wird.
Beim Zugbandtraining handelt es sich um ein mehrgelenkiges und mehrdimensionales Training mit erhöhtem koordinativem Anspruch, das immer auch Rumpfkraft zur Stabilisierung der Bewegungen erfordert. Außerdem trägt es durch die stetige Widerstandszunahme während der Übungsausführung der Tatsache Rechnung, dass die Gelenke mit kleiner werdendem Gelenkwinkel größere Kraftwerte entwickeln können. Die Muskeln bekommen quasi während der gesamten Bewegungsausführung die optimalen Wachstumsreize gesetzt.
Mehrgelenkig bedeutet, dass bei der Übungsausführung mehrere Gelenke involviert sind. Beispielsweise sind beim engen Rudern sowohl das Ellenbogen- als auch das Schultergelenk involviert, während beim einfachen Bizeps-Curl nur das Ellenbogengelenk betroffen ist. Beim Bizeps-Curl handelt es sich daher um eine eingelenkige Übung.
Am nächsten kommt dem Zugbandtraining in seiner Komplexität noch das Schlingentraining. Wie beim Zugbandtraining handelt es sich hierbei um ein funktionelles Ganzkörpertraining, bei dem der Trainierende durch verschiedenste stabile bzw. labile Ausgangspositionen den koordinativen Anspruch der Bewegung vorgibt. Die hauptsächlichen Unterschiede beider Trainingsformen liegen zum einen in der benötigten Aufhängung beim Schlingentraining und zum anderen in der »Einstellung« der Intensität.
Das Schlingentraining bedingt immer einen Haken, einen Baum oder eine Tür als Befestigungspunkt. Daraus ergibt sich ein kleiner Flexibilitätsvorteil zugunsten des Zugbandtrainings. Die Intensität wird beim Zugbandtraining durch den Widerstand des Zugbands und den Abstand zur Fixierung bestimmt, während beim Schlingentraining die Intensität durch das eigene Körpergewicht, das in die Übung eingebracht wird, verändert werden kann. Je nachdem, in welchem Winkelgrad die Übung ausgeführt wird, erhöht oder verringert sich letztlich die Intensität.
Insgesamt erfüllen beide Trainingsformen alle funktionellen Ansprüche und können als gegenseitige Bereicherung gesehen werden.
Funktionelles Ganzkörpertraining mit dem Schlingentrainer
Welche Trainingsform letztlich zum größeren Erfolg führt, lässt sich nicht grundsätzlich beantworten, da dieser vor allem von der Zielstellung abhängig ist. Alle Trainingsformen haben ihre Vorzüge und Nachteile. Das klassische Gerätetraining bietet Anfängern vor allem den Vorteil, dass mögliche Abweichungen von der korrekten Bewegungsausführung minimiert werden, weil das Gerät die Bewegungsrichtung vorgibt. Daneben nutzen vor allem Bodybuilder die geführten Bewegungen an den Maschinen, um den Muskel in seiner isolierten Bewegung maximal zu erschöpfen und damit einen größtmöglichen Hypertrophie- und Kraftgewinn zu erzielen. In diesem Zusammenhang muss ehrlicherweise gesagt werden, dass der Einsatz von Zugbändern zur Entwicklung von Maximalkräften besonders der großen Muskeln in den Beinen, in der Brust oder im Rücken seine Grenzen findet. Es ist kaum realistisch, bei Kniebeugen ein Zusatzgewicht von 150 kg mit einem Zugband zu simulieren. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch Trainierende, die unabhängig von ihrem Trainingsziel Eisen und Geräte einfach bevorzugen.
Sowohl die funktionellen mehrdimensionalen Trainingsformen als auch das klassische, überwiegend eindimensionale Gerätetraining haben aufgrund ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen ihre Daseinsberechtigung. Beide Trainingsformen sollten weniger als Konkurrenz, sondern vielmehr je nach Zielsetzung als gegenseitige Ergänzung gesehen werden.