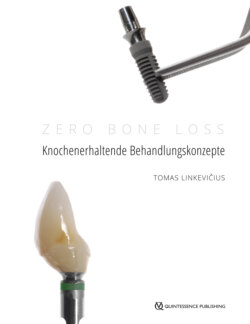Читать книгу Zero Bone Loss: Knochenerhaltende Behandlungskonzepte - Tomas Linkevičius - Страница 13
Оглавление3
INSERTIONSTIEFE
Die Insertionstiefe ist ein wichtiges Konzept, um eine Situation ohne Knochenverlust zu erreichen. Fälschlicherweise besteht die Annahme, dass alle Implantate auf derselben Höhe in den Knochenkamm gesetzt werden können. Tatsächlich hängt die Insertionstiefe aber vom Implantatdesign ab. Die wichtigsten erhältlichen Implantatdesigns sind Standardverbindungen (ohne Platform-Switching), Implantate auf Gewebeniveau (Tissue-Level-Implantate) und Implantate mit Platform-Switching (Abb. 3-1). Wie bereits in Kapitel 2 besprochen, sollte ein Implantat auf Gewebeniveau mit poliertem Hals immer oberhalb des Knochenkamms platziert werden, sodass nur die raue Oberfläche zur Osseointegration mit dem Knochen Kontakt hat. Implantate auf Knochenniveau (Bone-Level-Implantate) können hingegen unterschiedlich tief gesetzt werden: (1) auf Knochenhöhe (krestal), (2) suprakrestal oder (3) subkrestal (Abb. 3-2).
Abb. 3-1 (a) Ein Implantat auf Knochenniveau ohne Platform-Switching. (b) Ein Implantat auf Gewebeniveau. (c) Ein Implantat auf Knochenniveau mit Platform-Switching.
Abb. 3-2 Die verschiedenen möglichen Positionen für Implantate auf Knochenniveau ohne Platform-Switching: (a) krestal, (b) suprakrestal und (c) subkrestal (nicht empfohlen). Diese Positionen sind auch bei Implantaten mit Platform-Switching möglich (s. Abb. 3-7).
Implantate auf Knochenniveau ohne Platform-Switching
Es wurde gezeigt, dass Implantate auf Gewebeniveau suprakrestal gesetzt werden sollten, damit der Mikrospalt und der polierte Hals keinen Kontakt mit dem Knochen haben. Weniger klar ist jedoch, welche Position für Implantate auf Knochenniveau ohne Platform-Switching am besten ist. Bei krestaler Platzierung ist der Mikrospalt nicht vom Knochen isoliert, sodass es zum Knochenverlust kommt (Abb. 3-3). Bei suprakrestaler Platzierung bekommt ein Teil der rauen Oberfläche Kontakt mit dem Weichgewebe. Ein altes litauisches Sprichwort lautet: „Jeder Stock hat zwei Enden.“ Das bedeutet, dass man bei der Lösung eines Problems darauf achten muss, sich kein neues Problem zu schaffen, das womöglich schwerwiegender ist als das Ausgangsproblem. Während die suprakrestale Position eines Implantats ohne Platform-Switching die korrekte Lage des Mikrospalts mit sicherem Abstand zum Knochen gewährt, kann sie zu unerwarteten Weichgewebeproblemen führen, da die Implantatoberfläche gegenüber dem periimplantären Weichgewebe exponiert ist. Die raue Oberfläche ist für die Osseointegration gedacht und in einigen Studien führte die Exposition der rauen Oberfläche tatsächlich häufiger zu einer Periimplantitis1–4. Einige der aktuellen Behandlungsverfahren der Periimplantitis umfassen eine Glättung der Implantatoberfläche5,6. Einige Tierstudien legen nahe, dass durch eine Mikroanrauung des Implantathalses eine bessere Befestigung der Weichgewebe erreicht werden könnte, klinische Evidenz gibt es dazu aber noch nicht7,8. Andererseits ist für poliertes Titan eine sehr gute Weichgewebeverträglichkeit belegt9. Dies alles wirft die Frage auf, wie Implantate auf Knochenniveau ohne Platform-Switching aufgebaut sein sollten.
Abb. 3-3 Klinisches Beispiel dafür, wie unterschiedliche Positionen von Implantaten auf Knochenniveau ohne Platform-Switching die Knochenstabilität beeinflussen. (a) Subkrestal (links) und suprakrestal (rechts) gesetzte Implantate. (b) Das subkrestale Implantat wurde sofort mit einer Einheilkappe versehen. Beim suprakrestalen Implantat erfolgte eine Weichgewebeaugmentation. (c) Naht. (d) Der abgeheilte Alveolarkamm 2 Monate nach der Implantation. (e) Röntgenaufnahme nach der Implantation. Wegen der subkrestalen Position des distalen Implantats liegt der Mikrospalt 2 mm subkrestal, während der Mikrospalt am mesialen Implantat etwa 1 mm suprakrestal liegt. (f) Knochenverlust am subkrestalen Implantat mit fortschreitender Bildung der biologischen Breite. (g) Knochenverlust am subkrestalen Implantat (links) und stabiler Knochen am suprakrestalen Implantat (rechts) nach der Restauration.
Sie sollten idealerweise einen bis zu 1,0 mm langen polierten Hals besitzen und so gesetzt werden, dass sich dieser polierte Anteil oberhalb des Knochens befindet (Abb. 3-4 bis 3-6). In dieser Höhe liegt der Mikrospalt über dem Knochen und die raue Oberfläche des Implantathalses ist nicht exponiert. Wie bereits erwähnt, ist die Position des Mikrospalts über dem Knochenkamm wichtig, weil so die bakterielle Mikroleckage weit genug vom Knochen entfernt ist. Wenn die Implantat-Abutment Verbindung oberhalb des Knochens liegt, ist ihre Stabilität auch nicht mehr so entscheidend, als wenn sie sich näher am Knochen befindet. Daher kann auch eine Verbindung ohne Konus verwendet werden.
Abb. 3-4 Die korrekte Position eines Implantats ohne Platform-Switching liegt etwa 1 mm über dem Knochen. Das vertikale Weichgewebe sollte jedoch hoch genug sein, um ein gutes Ergebnis sicherzustellen. Korrekte (a) und unzureichende (b) Länge des polierten Halses.
Abb. 3-5 Zwei verschiedene Implantate ohne Platform-Switching mit unterschiedlich langem poliertem Hals. Ein polierter Hals von weniger als 0,5 mm ist zu kurz und verhindert den Effekt des Mikrospalts auf das Knochengewebe nicht.
Abb. 3-6 Setzen eines Implantats auf Knochenniveau ohne Platform-Switching. Die ImplantatAbutment-Verbindung verbleibt suprakrestal, aber die raue Oberfläche ist exponiert. Das Implantat sollte tiefer gesetzt werden, sodass nur der polierte Hals suprakrestal liegt.
Bei einem Implantat ohne Platform-Switching mit einem sehr dünnen (< 0,5 mm) oder ohne polierten Hals hat das Weichgewebe bei suprakrestaler Implantatposition Kontakt mit der rauen Implantatoberfläche. Zwar gibt es Belege dafür, dass eine leicht angeraute Oberfläche (d. h. eine gelaserte, mikroraue Oberfläche) am Abutment oder Implantathals für die Befestigung des Bindegewebes gut sein kann7,8, sehr raue Implantatoberflächen, die für den Knochenkontakt vorgesehen sind, sollten jedoch nicht suprakrestal liegen9.
Außerdem muss der polierte Hals von Implantaten ohne Platform-Switching komplett suprakrestal liegen, da er sonst einen Knochenverlust auslösen kann. Bei ästhetischen Bedenken sollte ein Implantat auf Knochenniveau mit Platform-Switching und Konusverbindung gewählt werden, während Implantate mit polierten Anteilen gemieden werden sollten.
Implantate auf Knochenniveau mit Platform-Switching
Auch Implantate auf Knochenniveau mit Platform-Switching können theoretisch in verschiedener Höhe im Knochen gesetzt werden (suprakrestal, krestal oder subkrestal; Abb. 3-7). Da das Platform-Switching den Knochenverlust reduziert, kann das Implantat logischerweise krestal gesetzt werden. Diese Implantatposition wird von den meisten Implantatherstellern empfohlen, weshalb die meisten Behandler vermutlich automatisch annehmen, dass sie am besten ist. Natürlich kann ein Implantat auf Knochenhöhe gesetzt werden, aber nur, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind – so sollte die Dicke der Weichgewebe mindestens 3 mm betragen. Bei einer nicht idealen biologischen Umgebung sollten jedoch andere Implantatpositionen in Betracht gezogen werden.
Abb. 3-7 Verschiedene Positionen von Implantaten mit Platform-Switching bezogen auf das Knochenniveau. (a) Krestale Position. (b) Suprakrestale Position (allgemein nicht empfohlen). (c) Subkrestale Position. Es handelt sich dabei um die gleichen Positionen, die auch für Implantate auf Knochenniveau ohne Platform-Switching möglich sind (s. Abb. 3-2).
Ebenfalls möglich ist eine subkrestale Implantatposition. Allgemein empfehlen nur wenige Hersteller, wie die Firmen Dentsply Sirona (Ankylos) und Bicon, eine subkrestale Platzierung ihrer Implantate. Ein Problem bei der subkrestalen Platzierung ist, dass der Mikrospalt tiefer in den Knochen gelangt, sodass die bakterielle Leckage eine Knochenresorption auslösen kann. Tatsächlich können auch nicht alle Implantate mit Platform-Switching subkrestal gesetzt werden. Ebenso wie bei der krestalen Position müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein (s. Kap. 5). Abhängig vom System ist es in der Regel sicherer, Implantate mit Platform-Switching und stabiler Implantat-AbutmentVerbindung subkrestal zu setzen. Je tiefer das Implantat in den Knochen gesetzt wird, umso wichtiger ist die Stabilität der Verbindung (s. Kap. 5). Empfohlen wird eine Tiefe von höchstens 3 mm subkrestal (Abb. 3-8).
Abb. 3-8 Verschiedene subkrestale Positionen von Implantaten mit Platform-Switching und einer Konusverbindung: 1 mm subkrestal (a), 2 mm unter dem Knochenniveau (b) und etwa 3 mm tief (c). Eine Tiefe von 3 mm wird nur für Implantate mit Morse-Taper-Verbindung empfohlen.
Implantate mit Platform-Switching sollten nicht suprakrestal gesetzt werden, weil die raue Implantatoberfläche dann Kontakt mit dem Weichgewebe hat. Diese Implantate wurden so entworfen, dass sie auf Knochenniveau oder darunter funktionieren. Manchmal entsteht jedoch eine Situation, in der ein Teil der Implantatoberfläche gegenüber dem Weichgewebe exponiert wird (Abb. 3-9). In diesem Fall liegt ein Dilemma vor: Ist es besser, die Implantatoberfläche mit einem Knochentransplantat abzudecken und alles so zu lassen oder Weichgewebe bzw. Weichgewebeersatzmaterial zu transplantieren?
Abb. 3-9 Der Implantathals ist nach dem Setzen bukkal exponiert.
Als Daumenregel gilt, dass bei Erfüllung aller folgenden Kriterien keine Knochenaugmentation erforderlich ist (Abb. 3-10):
Das Implantat ist nur teilweise exponiert. Meistens handelt es sich um die bukkale Oberfläche, da bei der Knochenresorption in der Regel die bukkale Knochenwand abgebaut wird. Es gilt die Regel, dass das Implantat mesiodistal und lingual von Knochen umgeben sein sollte.
Nur bis zu 1 mm der Implantatoberfläche ist exponiert. Bei einer stärkeren Exposition besteht die Möglichkeit, dass die Implantatoberfläche gegenüber der Mundhöhle exponiert wird, sodass das Risiko für eine Periimplantitis steigt.
Das Weichgewebe muss ausreichend dick sein: d. h. Dicke der Weichgewebe ≥ 3 mm, Breite der keratinisierten befestigten Gingiva ≥ 4 mm bukkolingual und Dicke der horizontalen befestigten Gingiva 2 mm.
Abb. 3-10 (a) Suprakrestale Position der bukkalen Implantatoberfläche. (b) Transplantation von Bindegewebe. (c) Aufgrund der dicken befestigten Gewebe war keine Knochenaugmentation indiziert.
Sofern diese Kriterien erfüllt sind, muss zwar Weichgewebe transplantiert werden, um das Infektionsrisiko auszuschalten, aber eine Knochenaugmentation ist nicht indiziert.
Bei kurzen klinischen Kronen sollten Implantate subkrestal gesetzt werden, um ein zu steiles und breites Emergenzprofil zu umgehen (Abb. 3-11). Nur Implantate mit Platform-Switching sollten subkrestal gesetzt werden. Weitere Implantatmerkmale, die Voraussetzungen für eine sichere subkrestale Platzierung sind, werden in Kapitel 5 besprochen.
Abb. 3-11 (a bis c) In dieser Situation ist aufgrund der kurzen Kronen eine subkrestale Position indiziert. Bei einem weiter koronal gesetzten Implantat wäre das Emergenzprofil zu steil geworden, sodass vermutlich ein Knochenverlust eingetreten wäre. Der Einfluss des Emergenzprofils wird in Kapitel 16 besprochen.
Implantate auf Gewebeniveau
Der letzte zu besprechende Implantattyp sind Implantate auf Gewebeniveau (Tissue-Level-Implantate), die durch die Länge des polierten Halses definiert sind. Sobald ein Implantat einen polierten Hals mit einer Länge von mindestens 1,8 mm besitzt, gilt es als Implantat auf Gewebeniveau. Für diese Implantate gelten hinsichtlich einer korrekten Platzierung andere Regeln. Zu ihren Besonderheiten gehört der doppelte Mikrospalt. Dabei liegt ein Mikrospalt an der Implantat-Abutment-Verbindung und der andere an der Schrägfläche des polierten Halses, an der sich später der Restaurationsrand befindet (Abb. 3-12). Inwieweit besteht hier ein Unterschied zu den Implantaten auf Knochenniveau, da doch der Mikrospalt in beiden Fällen über dem Knochen liegt? Bei Implantaten auf Gewebeniveau hat das Weichgewebe Kontakt mit dem polierten Anteil und das Weichgewebesiegel wird beim Abschrauben der Einheilkappe nicht beschädigt.
Abb. 3-12 Dieses Implantat auf Gewebeniveau ist ungewöhnlich, weil die Krone mit dem verbreiterten Hals verbunden ist. Dadurch liegt der Mikrospalt am Rand der Verbreiterung, d. h. näher am Knochen und nicht an der Implantat-Abutment-Verbindung.
Allerdings hat eine Verbindung auf einer schrägen Fläche wiederum bestimmte Nachteile, die sich bei der Restauration bemerkbar machen. Wird ein Implantat auf Gewebeniveau zu tief gesetzt, kommt es durch den Kontakt des polierten Anteils mit Knochen zum Knochenverlust. Gleichzeitig kann auch zu viel Weichgewebe vorliegen, sodass ein Impingement die Verbindung während des Aufschraubens oder der Zementierung der Restauration erschwert. Das Weichgewebe kann sogar die Passung der Krone auf dem Abutment und der schrägen Fläche des Implantathalses verhindern. Viele Behandler sind sich dieser Probleme überhaupt nicht bewusst. Die Lösung solcher Schwierigkeiten besteht darin, Implantate auf Gewebeniveau korrekt zu platzieren, sodass der polierte Anteil oberhalb des Knochens bleibt. Somit hat der Knochenverlust bei falsch gesetzten Implantaten auf Gewebeniveau drei Ursachen: (1) Knochenkontakt des polierten Anteils, (2) Knochenkompression durch den schrägen Hals und (3) Probleme bei der Restauration, wie Zementreste oder Weichgewebempingement (Abb. 3-13 und 3-14).
Abb. 3-13 (a) Dieses Implantat wurde zu tief gesetzt. Der polierte Hals und der Mikrospalt liegen unterhalb des Knochenniveaus. Dadurch wird es nicht nur zu Knochenverlust kommen, sondern auch das Anpassen der Abformkappen und der Krone auf dem Implantat ist erschwert. (b) Auch dieses Implantat auf Gewebeniveau wurde zu tief gesetzt, weil der Mikrospalt den Knochen berührt. Für die Restauration entstehen zunächst keine Probleme, aber nachdem sie eingegliedert ist, wird ein Knochenverlust entstehen. (c) Dies ist die korrekte Insertionstiefe für ein Implantat auf Gewebeniveau. Der gesamte polierte Anteil liegt suprakrestal.
Abb. 3-14 Klinisches Beispiel und Folgen eines zu tief gesetzten Implantats auf Gewebeniveau. (a) Der polierte Anteil liegt zu tief im Knochen. (b) Durch das Einheilen mit gedecktem poliertem Anteil wird die verbreiterte Verbindung im Gewebe versenkt. (c) Position des Implantats im Knochen. (d) Der Knochen am polierten Anteil beginnt mit dem Remodeling. (e) Die Restauration ist nicht vollständig eingesetzt und es finden sich Zementreste, was den Knochenverlust weiter vorantreibt (s. Kap. 12).
Restaurationsmaterial
Die Wahl des Implantattyps (auf Knochenniveau ohne Platform-Switching, auf Knochenniveau mit Platform-Switching oder auf Gewebeniveau) bestimmt auch die Wahl des Restaurationsmaterials. Es hat beispielsweise keinen Sinn, ein Implantat auf Gewebeniveau mit einer 2,8 mm langen maschinierten Oberfläche mit einer zirkonoxidbasierten Restauration zu versorgen, weil das Weichgewebe Kontakt mit dem Implantat und nur geringen oder keinen Kontakt mit der Oberfläche der Zirkonoxidrestauration hat. Es ist natürlich möglich, in diesen Fällen trotzdem Zirkonoxid zu verwenden, weil es u. a. eine geringere Plaque-Akkumulation aufweist. Ist Zirkonoxid jedoch wegen seines Effekts auf das Weichgewebe das beste Rehabilitationsmaterial, sollte es mit einem Implantat auf Knochenniveau kombiniert werden (Abb. 3-15).
Abb. 3-15 Die Zeichnung zeigt aus prothetischer Sicht den Unterschied zwischen Implantaten auf Gewebeniveau (links) und auf Knochenniveau (rechts). Wenn ein Implantat auf Gewebeniveau mit einer zirkonoxidbasierten Restauration versorgt wird, entsteht nur ein geringer Kontakt zwischen dem Gewebe und dem Zirkonoxid.
Bei Implantaten auf Knochenniveau befindet sich ein Teil der Restauration so tief im Gewebe, dass es zur Adhäsion von periimplantärem Gewebe kommt. Diese Überlegung ist wichtig, weil sie ebenso wie die Wahl des Implantattyps und -designs die Wahl der Restauration beeinflusst, während die Eigenschaften der Restauration wiederum die Stabilität und Gesundheit der periimplantären Gewebe und des Implantatsystems insgesamt beeinflussen. Daher muss der Zahnarzt sowohl mit den unterschiedlichen prothetischen als auch Implantatoptionen vertraut sein und verstehen, welche Restauration zu welchem Implantat passt. Bei Implantaten auf Knochenniveau ohne Platform-Switching heften einige Gewebe am Implantathals an, der 0,5 bis 1,0 mm lang sein sollte, und einige an der Restauration. Darum ist die Wahl des Restaurationsmaterials bei Implantaten auf Knochenniveau wichtiger als bei Implantaten auf Gewebeniveau (Abb. 3-16). Implantate auf Knochenniveau mit Platform-Switching haben einen besonderen Vorteil: Sie geben dem Zahnarzt Freiheit, bei der Restauration verschiedene Materialien für den periimplantären Gewebekontakt auszuwählen.
Abb. 3-16 Aus prothetischer Sicht ist der klinische Unterschied zwischen Implantaten auf Gewebe- und auf Knochenniveau offensichtlich. (a) Bei einem Implantat auf Knochenniveau hat das Weichgewebe Kontakt mit der Restauration. (b) Kontakt zwischen Weichgewebe und der Zirkonoxidrestauration. (c) Ein Implantat auf Gewebeniveau ist vollständig von Weichgewebe umgeben. (d) Das Weichgewebe hat auf gesamter Höhe nur Kontakt mit dem polierten Titanhals. (e und f) Das für die Restauration zur Verfügung stehende Weichgewebe unterscheidet sich erheblich zwischen dem Implantat auf Gewebeniveau (links) und dem Implantat auf Knochenniveau (rechts).
Zusammenfassung
Implantate auf Knochenniveau ohne Platform-Switching sollten einen etwa 1 mm langen maschinierten Hals besitzen und leicht suprakrestal gesetzt werden, damit der Mikrospalt und die damit einhergehenden Bakterien Abstand zum Knochen haben. In dieser Position ist die Stabilität der Implantat-Abutment-Verbindung weniger wichtig. Bewegungen sind nicht so verheerend für den Knochen, weil sie in einem sicheren vertikalen Abstand auftreten.
Implantate mit Platform-Switching können auf oder unter Knochenniveau gesetzt werden. Die Tiefe hängt von der Stabilität der Implantat-Abutment-Verbindung ab.
Implantate auf Gewebeniveau müssen so gesetzt werden, dass der polierte Implantathals vollständig aus dem Knochen ragt. Abhängig von der vertikalen Dicke der Weichgewebe kann die Verwendung von Implantaten auf Gewebeniveau die Wahl des prothetischen Materials für die Restauration einschränken.
Literatur
1.Berglundh T, Gotfredsen K, Zitzmann NU, Lang NP, Lindhe J. Spontaneous progression of ligature induced peri-implantitis at implants with different surface roughness: An experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res 2007;18:655–661.
2.Lang NP, Berglundh T; Working Group 4 of Seventh European Workshop on Periodontology. Periimplant diseases: Where are we now?—Consensus of the Seventh European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2011;38(suppl 11):178–181.
3.Esposito M, Ardebili Y, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: Different types of dental implants. Cochrane Database Syst Rev 2014;(7): CD003815.
4.Teughels W, Van Assche N, Sliepen I, Quirynen M. Effect of material characteristics and/or surface topography on biofilm development. Clin Oral Implants Res 2006;17(suppl 2):68–81.
5.Heitz-Mayfield LJ, Mombelli A. The therapy of periimplantitis: A systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29(suppl):325–245.
6.Keeve PL, Koo KT, Ramanauskaite A, et al. Surgical treatment of periimplantitis with non-augmentative techniques Implant Dent 2019;28(2):177–186.
7.Ketabi M, Deporter D. The effects of laser microgrooves on hard and soft tissue attachment to implant collar surfaces: A literature review and interpretation. Int J Periodontics Restorative Dent 2013;33:e145–e152.
8.Nevins M, Kim DM, Jun SH, Guze K, Schupbach P, Nevins ML. Histologic evidence of a connective tissue attachment to laser microgrooved abutments: A canine study. Int J Periodontics Restorative Dent 2010;30:245–255.
9.Abdallah MN, Badran Z, Ciobanu O, Hamdan N, Tamimi F. Strategies for optimizing the soft tissue seal around osseointegrated implants. Adv Healthc Mater 2017;6. doi:10.1002/adhm.201700549.