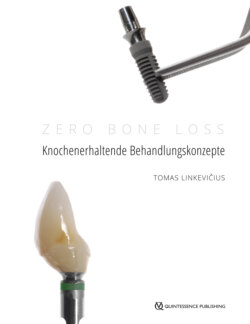Читать книгу Zero Bone Loss: Knochenerhaltende Behandlungskonzepte - Tomas Linkevičius - Страница 9
ОглавлениеEinführung in die knochenerhaltenden Behandlungskonzepte
Ich beginne mit den ersten Fragen, die ich auch in meinen Kursen und Vorträgen stelle: Stellen Sie an den Implantaten, die Sie setzen und restaurieren, einen krestalen Knochenverlust fest? Sind Sie hier, weil Sie verstehen wollen, warum das manchmal passiert? Die meisten Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, bejahen diese Fragen: An vielen der von ihnen gesetzten Implantate zeigt sich ein gewisser Knochenverlust. Es handelt sich einfach um ein wichtiges Problem, das in jeder Praxis beobachtet werden kann. Allerdings muss ein krestaler Knochenverlust nicht zwangsläufig auftreten. Aus diesem Gedanken heraus entwickelte ich knochenerhaltende Behandlungskonzepte, also Protokolle, die den Status „kein Knochenverlust“ erreichen.
Kein Knochenverlust. Das ist möglich, und zwar nicht nur Monate nach der prothetischen Versorgung, sondern auch Jahre nach Abschluss der Behandlung. Abbildung 1 zeigt einen außergewöhnlichen Fall mit genau den Ergebnissen, die wir immer anstreben. Die Fragen dazu sind klar: Warum war die Behandlung in diesem Fall so erfolgreich? Was können wir tun, um solche herausragenden Ergebnisse zu erzielen?
Abb. 1 (a) Oberkieferimplantat im Jahr 2013. (b) Derselbe Patient im Jahr 2018.
Letztere Frage möchte ich mit diesem Buch beantworten, und zwar mithilfe von Konzepten aus zwei Bereichen: der klinischen Praxis und der wissenschaftlichen Forschung, die allerdings für sich genommen jeweils gewissen Einschränkungen unterliegen.
Klinische Praxis
In vielen Büchern werden sehr erfolgreiche klinische Ergebnisse präsentiert, die aber oft nur auf den Erfahrungen der Autorinnen oder Autoren beruhen. Die Ergebnisse sind zwar großartig, wenn aber nur ein einzelner Praktiker sie beschreibt, heißt das nicht, dass die Leser ähnliche Ergebnisse erreichen werden. Als Erklärung hört man dann meist nur: „Bei mir funktioniert es.“ Die Leser versuchen den Ergebnissen nachzueifern, und lassen sich von suboptimalen Ergebnissen entmutigen. Meistens geben sich die Leser oder Kursteilnehmer selbst die Schuld und zweifeln an ihrer Fähigkeit, moderne Behandlungsverfahren durchzuführen. Unter Referenten gibt es dafür den Begriff geschönte Forschung. Dabei schaffen es nur die guten Ergebnisse in den Vortrag, Komplikationen und andere Erfahrungen kommen in der Darstellung des Gesamtbilds nicht mehr vor.
Wissenschaftliche Forschung
Oft wird die strenge Wissenschaft von der klinischen Welt nicht so recht ernst genommen, weil sie als zu abgehoben oder einfach als langweilig betrachtet wird. Ideal ist natürlich eine evidenzbasierte dentale Implantologie, die jedoch nur selten erreicht wird, weil es tatsächlich sehr schwierig ist, klinische Studien korrekt und ohne Bias durchzuführen. Weitere Probleme sind die immer strengeren ethischen Vorgaben und die zunehmend fehlende Bereitschaft der Patienten, an einer klinischen Studie teilzunehmen. All dies zusammengenommen erschwert es, die Zustimmung von Ethikkommissionen zu bekommen und klinische Studien durchzuführen. Mittlerweile ist die schlimmstmögliche Situation entstanden, in der Wissenschaftler und Kliniker einander zunehmend mit Misstrauen begegnen. Daher lassen sich tatsächliche Erfolge nur mit Behandlungsverfahren erzielen, die auf klinischer Evidenz beruhen und mit entsprechender Logik und technischen Fähigkeiten durchgeführt werden.
Zusammenführung von Wissenschaft und Klinik
In diesem Buch sollen Wissenschaft und Klinik zusammengeführt werden. Damit erhält der Praktiker genau das, was er benötigt, nämlich klinische Verfahren, die durch solide klinische Evidenz gestützt sind. Das war der Grundgedanke bei der Entwicklung der Knochenerhaltende Behandlungskonzepte.
Einmal äußerte ein Kollege, dass es unmöglich sei, Implantate zu setzen, ohne dass ein gewisser Knochenverlust eintreten werde. Dem habe ich natürlich zugestimmt, aber ich erklärte weiter, dass wir unser Bestes geben müssen, um den Knochenverlust abzustellen. Dabei machen wir große Fortschritte, denn in einer der Studien wurde ein krestaler Knochenverlust von nur 0,2 mm ermittelt – das ist fast Null1!
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich der Knochen mithilfe verschiedener Implantatsysteme, Implantatoberflächen, Implantat-Abutment-Verbindungen und prothetischer Lösungen stabilisieren lässt (Abb. 2). Dies ist sogar mit oder ohne Platform-Switching möglich. Für eine erfolgreiche Behandlung müssen jedoch auch die chirurgischen und prothetischen Aspekte sowie die biologischen und mechanischen Grundlagen der implantologischen Behandlung bekannt sein. Mit jedem der Implantatsysteme können sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Behandlungen durchgeführt werden (Abb. 3). Daher kann das Implantatdesign nicht der einzige Faktor sein, der zur krestalen Knochenstabilität beiträgt. Mit fast jedem Implantatsystem lässt sich ein Zustand ganz ohne Knochenverlust erreichen, aber manche Systeme sind etwas arbeitsintensiver und setzen mehr Fachwissen voraus als andere. Der Behandler muss mit dem gewählten Implantatsystem, einschließlich der spezifischen Stärken und Einschränkungen, gut vertraut sein. Dies ist der Weg zum Erfolg (Abb. 4).
Abb. 2 Knochenerhaltende Behandlungskonzepte mit verschiedenen Implantaten. (a) Straumann-Tissue-Level-Implantat (Fa. Straumann). (b) Conelog-Implantat (Fa. Camlog Biotechnologies). (c) V3-Implantat (Fa. MIS Implants Technologies). (d) Fa. BioHorizons: Tapered-Implantat. (e) Fa. Straumann: Bone-Level-Implantat.
Abb. 3 Stabilität des krestalen Knochens (a) und Knochenverlust (b) bei demselben Implantattyp.
Abb. 4 Langzeitbeobachtung (7 Jahre) eines Implantats, das nach einem Behandlungskonzept ohne Knochenverlust gesetzt und restauriert wurde. (a) Vor der Restauration im Jahr 2011. (b) Implantat mit Restauration im Jahr 2012. (c) Implantatstatus 3 Jahre nach der Behandlung im Jahr 2014. (d) Im Jahr 2017 ist ein Knochenzuwachs am Implantat erkennbar.
Das Ergebnis einer implantologischen Behandlung hängt von der Stabilität des krestalen Knochens ab, die als Schlüsselfaktor bestimmt, ob eine Behandlung zu einem Erfolg oder Misserfolg wird. Daher zielen alle in diesem Buch vorgestellten Techniken und Konzepte darauf ab, die Intaktheit des Knochens zu bewahren. Dabei werden nicht nur die wichtigsten Einflussfaktoren der Knochenstabilität ermittelt, sondern es wird dargestellt, wie die vielen Faktoren zusammenwirken und wie dieses Zusammenwirken die Knochenstabilität beeinflusst.
Die vorgestellten Techniken und Konzepte werden jeweils von wissenschaftlichen Studien gestützt, von denen die überwiegende Mehrzahl klinische Studien sind. Gemeinsam haben mein Team und ich in vielen hochangesehenen zahnmedizinischen Fachzeitschriften mehr als 20 Artikel veröffentlicht, z. B. in The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, Clinical Oral Implants Research und The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry (Tab. 1). Die klinischen und Laborverfahren, die wir anwenden und empfehlen, basieren auf klinischer Evidenz. Wir bauen also nicht nur auf unsere eigenen klinischen Erfahrungen, sondern unsere Protokolle basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Indem wir Wissenschaft und Praxis zusammenführen, machen wir dieses Buch und seine Konzepte zu etwas Besonderem. Außergewöhnlich für alle in diesem Buch beschriebenen Fälle ist weiterhin, dass alle klinischen und In-vitro-Studien in einer privaten Praxis durchgeführt wurden. Üblicherweise finden klinische Studien an Universitäten statt, aber mein Team entwickelte ein spezielles System, das die Praxis mit den Universitäten verbindet und unter enger Führung zur Wissensvermehrung bei der dentalen Implantologie beiträgt.
Tabelle 1 Liste der veröffentlichten Studien, die knochenerhaltende Behandlungskonzepte stützen
Ich möchte betonen, dass dieses Buch nicht nur auf klinischen Befunden und Fallberichten basiert, sondern sich überwiegend auf kontrollierte klinische und sorgfältig geplante In-vitro-Studien stützt. Sich nur auf Einzelfallberichte zu berufen, kann recht gefährlich sein. So wird in Einzelfallberichten der Einsatz von Kofferdam als sichere Option zur Reduktion von Zementresten empfohlen2. Eine kontrollierte klinische Studie kam jedoch zu genau entgegengesetzten Ergebnissen3. Im Jahr 2011 entwickelten und veröffentlichten wir eine einfache und zuverlässige Technik zur Evaluation von Zementresten nach der Zementierung4. Bei dieser Technik wird eine Krone mit einem Zugangsloch in der Okklusalfläche einzementiert, das mit Komposit verschlossen wird, damit der Zement während der Zementierung nicht hineingelangt und die Restauration gemeinsam mit dem Abutment entfernt werden kann. Bei der Durchführung dieser Technik stellten wir fest, dass Kofferdam Zementreste nicht verhindern kann (Abb. 5).
Abb. 5 Kofferdam kann Zementreste in der klinischen Praxis nicht zuverlässig verhindern. (a und b) Implantat mit Abutment und Kofferdam. (c) Die Krone wird zementiert. (d) Kofferdam und Krone werden entfernt. (e) Zementrest auf der Oberfläche, der Kontakt mit den periimplantären Geweben hat. (f) In den periimplantären Geweben finden sich keine Zementreste.
Dies unterstreicht die Tatsache, dass Fallberichte subjektiv sind und den Meinungen der Autoren ähneln, was bei der Teilnahme an Kursen, dem Besuch von Vorträgen und dem Lesen von Lehrbüchern bedacht werden muss. Wichtig ist letztlich das Evidenzniveau, das von In-vitro- bis hin zu randomisierten Studien reicht (Abb. 6). Das niedrigste Evidenzniveau haben Tierstudien und In-vitro-Studien, deren Ergebnisse daher nicht direkt auf die klinische Praxis übertragen werden können. Manche Experimente können nur an Tieren durchgeführt werden, aber dabei muss eben berücksichtigt werden, dass beispielsweise die Heilung bei Hunden acht Mal schneller voranschreitet als bei Menschen. Somit sollten die Ergebnisse von Studien am Hundemodell immer als bestmögliches Szenario betrachtet werden. Oft ist jedoch zu beobachten, dass Tierstudien herangezogen werden, um klinische Protokolle zu stützen, und das ist verkehrt. In-vivo-Studien sollten nur dann als Anhalt herangezogen werden, wenn noch keine klinischen Studien vorliegen. Als Beispiel dafür dient die pharmazeutische Industrie. Würden Sie ein Medikament anwenden, das nur an Tieren getestet und niemals klinisch evaluiert wurde? Selbstverständlich nicht, und deswegen ist immer auf die Evidenzhierarchie zu achten. Auch Fallberichte haben darin ihren Platz. Ein einfacher Fallbericht kann zwar wichtiger sein als eine strikte Tierstudie, aber wir können uns beim klinischen Vorgehen nicht nur auf Behandlungsfälle stützen. Daher ist die Abwägung von Evidenz wichtig und Fallberichte dienen als Ausgangspunkt beim Aufbau der wissenschaftlichen Begründung eines Konzepts.
Abb. 6 Die Evidenzhierarchie. Wichtig ist, dass sich Expertenmeinungen und Fallberichte lediglich auf den Plätzen acht und sieben befinden.
Zusammenfassend besteht unser Grundkonzept also darin, wissenschaftliche Evidenz und solide klinische Logik gegeneinander abzuwägen, um den Patientinnen und Patienten das bestmögliche Behandlungsergebnis zu ermöglichen.
Aufbau des Buchs
Dieses Buch besteht aus zwei Teilen: Chirurgie und Prothetik. Dieser Aufbau ist der realen klinischen Behandlung nachempfunden, da zunächst die Implantation und anschließend die prothetische Restauration erfolgt. Im chirurgischen Teil wird erklärt, wie ein stabiler krestaler Knochen erzeugt wird. Hierbei sind verschiedene Faktoren wichtig, wie die vertikale Weichgewebedicke, das Implantatniveau, die Position des polierten Implantathalses sowie die Art der Implantat-Abutment-Verbindung. Allerdings bleiben die ausgezeichneten chirurgischen Ergebnisse nicht lange erhalten, wenn das Implantat nicht mit einer korrekten Restauration versorgt wird. Daher werden die prothetischen Konzepte, die die Stabilität des periimplantären krestalen Knochens erhalten, hier ebenfalls vorgestellt (Teil II).
Literatur
1.Linkevičius T, Puišys A, Steigmann M, Vindašiūtė E, Linkevičienė L. Influence of vertical soft tissue thickness on crestal bone changes around implants with platform switching: A comparative clinical study. Clin Implant Dent Relat Res 2015;17:1228–1236.
2.Seo CW, Seo JM. A technique for minimizing subgingival residual cement by using rubber dam for cement- retained implant crowns. J Prosthet Dent 2017;117:327–328.
3.Andrijauskas P, Alkimavičius J, Zukauskas S, Linkevičius T. Clinical effectiveness of rubber dam and gingival displacement cord with copy abutment on reducing residual cement for cement-retained implant crowns. Clin Oral Implants Res 2018;29(suppl 17):77.
4.Linkevičius T, Vindašiūtė E, Puišys A, Pečiulienė V. The influence of margin location on the amount of undetected cement excess after delivery of cement-retained implant restorations. Clin Oral Implants Res 2011;22:1379–1384.