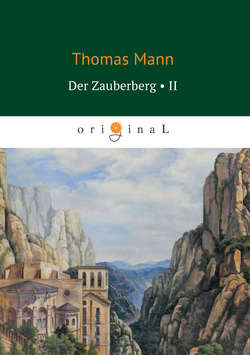Читать книгу Der Zauberberg. Volume 2 - Томас Манн, Thomas Mann - Страница 2
Sechstes Kapitel
Veränderungen
ОглавлениеWas ist die Zeit? Ein Geheimnis, – wesenlos und allmächtig. Ei-ne Bedingung der Erscheinungswelt, eine Bewegung, verkop-pelt und vermengt dem Dasein der Körper im Raum und ihrer Bewegung. Wäre aber keine Zeit, wenn keine Bewegung wäre? Keine Bewegung, wenn keine Zeit? Frage nur! Ist die Zeit eine Funktion des Raumes? Oder umgekehrt? Oder sind beide iden-tisch? Nur zugefragt! Die Zeit ist tätig, sie hat verbale Beschaffen-heit, sie "zeitigt". Was zeitigt sie denn? Veränderung! Jetzt ist nicht damals, hier nicht dort, denn zwischen beiden liegt Bewegung. Da aber die Bewegung, an der man die Zeit mißt, kreis-läufig ist, in sich selber beschlossen, so ist das eine Bewegung und Veränderung, die man fast ebensogut als Ruhe und Still-stand bezeichnen könnte; denn das Damals wiederholt sich be-ständig im Jetzt, das Dort im Hier. Da ferner eine endliche Zeit und ein begrenzter Raum auch mit der verzweifeltsten Anstren-gung nicht vorgestellt werden können, so hat man sich entschlossen, Zeit und Raum als ewig und unendlich zu "denken", – in der Meinung offenbar, dies gelinge, wenn nicht recht gut, so doch etwas besser. Bedeutet aber nicht die Statuierung des Ewigen und Unendlichen die logisch-rechnerische Vernichtung alles Begrenzten und Endlichen, seine verhältnismäßige Redu-zierung auf null? Ist im Ewigen ein Nacheinander möglich, im Unendlichen ein Nebeneinander? Wie vertragen sich mit den Notannahmen des Ewigen und Unendlichen Begriffe wie Ent-fernung, Bewegung, Veränderung, auch nur das Vorhandensein begrenzter Körper im All? Das frage du nur immerhin!
Hans Castorp fragte so und ähnlich in seinem Hirn, das gleich bei seiner Ankunft hier oben zu solchen Indiskretionen und Quengeleien sich aufgelegt gezeigt hatte und durch eine schlimme, aber gewaltige Lust, die er seitdem gebüßt, vielleicht besonders dafür geschärft und zum Querulieren dreist gemacht worden war. Er fragte sich selbst danach und den guten Joachim und das seit undenklichen Zeiten dick verschneite Tal, obgleich er ja von keiner dieser Stellen irgend etwas einer Antwort Ähn-liches zu gewärtigen hatte, – schwer zu sagen, von welcher am wenigsten. Sich selbst legte er solche Fragen eben nur vor, weil er keine Antwort darauf wußte. Joachim seinerseits war zur Teilnahme daran fast gar nicht zu gewinnen, da er, wie Hans Castorp es eines Abends auf französisch gesagt hatte, an nichts dachte als daran, im Flachlande Soldat zu sein und mit der bald sich nähernden, bald foppend wieder ins Weite schwindenden Hoffnung darauf in einem nachgerade erbitterten Kampfe lag, den durch einen Gewaltstreich zu beenden er sich neuerdings geneigt zeigte. Ja, der gute, geduldige, rechtliche und so ganz auf Dienstlichkeit und Disziplin gestellte Joachim unterlag em-pörerischen Anwandlungen, er begehrte auf gegen die "Gaffky-Skala", jenes Untersuchungssystem, wonach im Laboratorium drunten, oder dem "Labor", wie man gewöhnlich sagte, der Grad erkundet und bezeichnet wurde, in welchem ein Patient mit Bazillen behaftet war: ob diese nur ganz vereinzelt oder un-zählbar massenhaft in dem analysierten Probestoff sich vorfan-den, das bestimmte die Höhe der Gaffky-Nummer, und auf diese eben kam alles an. Denn völlig untrüglich drückte sie die Genesungschance aus, mit der ihr Träger zu rechnen hatte; die Zahl der Monate oder Jahre, die jemand noch würde zu ver-weilen haben, war unschwer danach zu bestimmen, angefangen von der halbjährigen Stippvisite bis hinauf zu dem Spruche "Le-benslänglich", der zeitlich genommen oft genug nun wieder nur allzu wenig besagte. Gegen die Gaffky-Skala denn also em-pörte Joachim sich, offen kündigte er ihrer Autorität den Glau-ben, – nicht ganz offen, nicht gerade gegen die Oberen, aber doch gegen seinen Vetter und sogar bei Tisch. "Ich habe es satt, ich lasse mich nicht länger zum Narren haben", sagte er laut, und das Blut stieg ihm in das tief gebräunte Gesicht: "Vor vier-zehn Tagen hatte ich Gaffky Nr. 2, eine Bagatelle, die besten Aussichten, und heute Nr. 9, bevölkert geradezu, von der Ebene nicht mehr die Rede. Da soll doch der Teufel klug daraus werden, wie es mit einem steht, es ist nicht zum Aushalten. Oben auf Schatzalp liegt ein Mann, ein griechischer Bauer, sie haben ihn aus Arkadien hergeschickt, ein Agent hat ihn hergeschickt, – ein aussichtsloser Fall, es ist galoppierend bei ihm, jeden Tag kann man den Exitus erwarten, aber nie im Leben hat der Mann Bazillen im Sputum gehabt. Dagegen der dicke belgische Hauptmann, der gesund abging, als ich ankam, war Gaffky Nr. 10 gewesen, nur so gewimmelt hatte es bei ihm, und dabei hat-te er bloß eine ganz kleine Kaverne gehabt. Gaffky kann mir gestohlen werden! Ich mache Schluß, ich reise nach Hause, und wenn es mein Tod ist!" So Joachim; und alle waren schmerzlich betreten, den sanften, gesetzten jungen Menschen in solchem Aufruhr zu sehen. Hans Castorp konnte nicht umhin, bei Joachims Drohung, er werde alles hinwerfen und ins Flachland ab-reisen, an gewisse Äußerungen zu denken, die er auf französisch von dritter Seite vernommen. Aber er schwieg; denn sollte er dem Vetter seine eigene Geduld als Muster vorhalten, wie Frau Stöhr es tat, die Joachim wirklich ermahnte, nicht so lästerlich aufzutrotzen, sondern sich in Demut zu schicken und sich ein Beispiel an der Treue zu nehmen, mit welcher sie, Karoline, hier oben ausharre und es sich willenszäh versage, in ihrem Heim zu Cannstatt als Hausfrau zu schalten und zu walten, um dereinst ihrem Mann ein völlig und gründlich genesenes Eheweib in ih-rer Person zurückzuerstatten? Nein, das mochte Hans Castorp denn doch nicht, zumal er seit dem Faschingsfest vor Joachim ein schlechtes Gewissen hatte, – das heißt: sein Gewissen sagte ihm, Joachim müsse in dem, worüber sie nicht sprachen, wovon Joachim aber zweifellos wußte, etwas wie Verrat, Desertion und Treulosigkeit sehen, und zwar in Hinsicht auf ein Paar runder brauner Augen, eine schwach begründete Lachlust und ein Ap-felsinenparfüm, deren Einwirkungen er täglich fünfmal ausge-setzt war, vor denen er aber streng und anständig seine Augen auf den Teller niederschlug … Ja, noch in dem stillen Wider-streben, mit dem Joachim seinen Spekulationen und Aspekten über die "Zeit" begegnete, glaubte Hans Castorp etwas von die-ser militärischen Sittsamkeit, die einen Vorwurf für sein Gewissen enthielt, zu spüren. Was aber das Tal, das dick verschneite Wintertal betraf, an das Hans Castorp von seinem vorzüglichen Liegestuhl aus ebenfalls seine übersinnlichen Fragen richtete, so standen seine Zinken, Kuppen, Wandlinien und braungrünrötlichen Wälder schweigend in der Zeit, umwoben von still fließender Erdenzeit bald leuchtend im tiefen Himmelsblau, bald qualmverhüllt, bald diamanthart glitzernd in Mondnachtzauber, – bald rötlich angeglüht in der Höhe von scheidender Sonne, aber immer im Schnee, seit sechs undenklichen, wenn auch huschartig vergangenen Monaten, und alle Gäste erklärten, sie könnten den Schnee nicht mehr sehen, er widere sie, schon der Sommer habe ihren Ansprüchen in dieser Richtung genügt, aber nun Schneemassen tagein, tagaus, Schneehaufen, Schnee-polster, Schneehänge, das gehe über Menschenkraft, sei Mord für Geist und Gemüt. Und sie setzten farbige Brillen auf, grüne, gelbe und rote, wohl auch um die Augen zu schonen, doch mehr noch fürs Herz.
Tal und Berge im Schnee seit sechs Monaten schon? Seit sie-ben! Die Zeit schreitet fort, während wir erzählen, – unsere Zeit, die wir dieser Erzählung widmen, aber auch die tief vergangene Zeit, Hans Castorps und seiner Schicksalsgenossen dort oben im Schnee, und sie zeitigt Veränderungen. Alles war auf dem be-sten Wege, sich zu erfüllen, wie Hans Castorp es am Faschings-tage auf dem Heimwege von "Platz" zum Zorne Herrn Settem-brinis mit raschen Worten vorweggenommen hatte: nicht gera-de, daß schon die Sonnenwende in unmittelbarer Aussicht gewesen wäre, aber Ostern war durch das weiße Tal gezogen, der April schritt vor, der Blick auf Pfingsten war frei, bald würde der Frühling anbrechen, die Schneeschmelze, – nicht aller Schnee würde schmelzen, auf den Häuptern im Süden, in den Felsschründen der Rhätikonkette im Norden blieb immerdar welcher liegen, von dem zu schweigen, der auch allsommermo-natlich einfallen, aber nicht liegen bleiben würde; doch unbe-dingt verhieß die Umwälzung des Jahres entscheidende Neu-erungen binnen kurzem, denn seit jener Fastnacht, in der Hans Castorp sich von Frau Chauchat einen Bleistift geliehen, ihr spä-ter denselben auch wieder zurückgegeben und auf Wunsch etwas anderes dafür empfangen hatte, eine Erinnerungsgabe, die er in der Tasche trug, waren nun schon sechs Wochen verflos-sen, – doppelt so viele, als Hans Castorp ursprünglich hatte hier oben bleiben wollen.
Sechs Wochen verflossen in der Tat seit dem Abend, da Hans Castorp die Bekanntschaft Clawdia Chauchats gemacht hatte und dann so viel später auf sein Zimmer zurückgekehrt war, als der dienstfromme Joachim auf das seine; sechs Wochen seit dem folgenden Tage, der Frau Chauchats Abreise gebracht hatte, ihre Abreise für diesmal, ihre vorläufige Abreise nach Daghestan, ganz östlich über den Kaukasus hinaus. Daß diese Abreise vor-läufiger Art, nur eine Abreise für diesmal sein solle, daß Frau Chauchat wiederzukehren beabsichtigte, – unbestimmt wann, aber daß sie einmal wiederkommen wolle oder auch müsse, des besaß Hans Castorp Versicherungen, direkte und mündliche, die nicht in dem mitgeteilten fremdsprachigen Dialog gefallen waren, sondern folglich in die unsererseits wortlose Zwischenzeit, während welcher wir den zeitgebundenen Fluß unserer Erzäh-lung unterbrochen und nur sie, die reine Zeit, haben walten las-sen. Jedenfalls hatte der junge Mann jene Versicherungen und tröstlichen Zusagen erhalten, bevor er auf Nr. 34 zurückgekehrt war; denn am folgenden Tage hatte er kein Wort mehr mit Frau Chauchat gewechselt, sie kaum gesehen, sie zweimal von wei-tem gesehen: beim Mittagessen, als sie in blauem Tuchrock und weißer Wolljacke, unter dem Schmettern der Glastür und lieb-lich schleichend noch einmal zu Tische gegangen war, wobei ihm das Herz im Halse geschlagen und nur die scharfe Bewa-chung, die Fräulein Engelhart ihm zugewandt, ihn gehindert hatte, das Gesicht mit den Händen zu bedecken; – und dann nachmittags 3 Uhr, bei ihrer Abreise, der er nicht eigentlich bei-gewohnt, sondern der er von einem Korridorfenster aus, das den Blick auf die Anfahrt gewährte, zugesehen hatte.
Der Vorgang hatte sich abgespielt, wie Hans Castorp ihn während seines Aufenthaltes hier oben schon manchmal sich hatte abspielen sehen: der Schlitten oder Wagen hielt an der Rampe, Kutscher und Hausknecht schnürten die Koffer auf, Sa-natoriumsgäste, Freunde dessen, der, genesen oder nicht, um zu leben oder zu sterben, die Rückreise ins Flachland antrat, oder auch nur solche, die den Dienst schwänzten, um das Ereignis auf sich wirken zu lassen, versammelten sich vorm Portal; ein Herr im Gehrock von der Verwaltung, vielleicht sogar die Ärzte stellten sich ein, und dann kam der Abreisende heraus, – strah-lenden Angesichtes meist und huldvoll die neugierig Umste-henden und Zurückbleibenden grüßend, mächtig belebt für den Augenblick durch das Abenteuer … Diesmal nun war es Frau Chauchat gewesen, die herausgekommen war, lächelnd, den Arm voller Blumen, in langem, rauhem, mit Pelz besetztem Reisemantel und großem Hut, begleitet von Herrn Buligin, ih-rem konkaven Landsmann, der ein Stück Weges mit ihr reiste. Auch sie schien freudig erregt, wie jeder Abreisende es war, – nur durch den Lebenswechsel, ganz unabhängig davon, ob man mit ärztlicher Einwilligung reiste oder nur aus verzweifeltem Überdruß, auf eigene Gefahr und mit schlechtem Gewissen den Aufenthalt unterbrach. Ihre Wangen waren gerötet, sie plauderte beständig, wahrscheinlich russisch, während man ihre Knie mit einer Pelzdecke umwickelte … Nicht nur Frau Chauchats Landsleute und Tischgenossen, sondern auch zahlreiche andere Gäste waren zur Stelle gewesen, Doktor Krokowski hatte kernig lächelnd seine gelben Zähne im Barte gezeigt, noch mehr Blumen hatte es gegeben, die Großtante hatte Konfekt, "Konfäktchen" wie sie zu sagen pflegte, das heißt russische Marmelade, gespendet, die Lehrerin hatte dort gestanden, der Mannheimer, – dieser in einiger Entfernung, trübe spähend, und seine leid-vollen Augen waren am Hause emporgeglitten, wo sie Hans Castorp am Korridorfenster gewahrt und trübe auf ihm verweilt hatten … Hofrat Behrens hatte sich nicht gezeigt; offenbar hatte er sich von der Reisenden schon bei anderer, privater Gele-genheit verabschiedet … Dann hatten unter dem Winken und Rufen der Umstehenden die Pferde angezogen, und auch Frau Chauchats schräge Augen hatten nun, während die Vorwärtsbe-wegung des Schlittens ein Zurücksinken ihres Oberkörpers ge-gen das Polster bewirkt hatte, noch einmal lächelnd die Front des Berghof-Hauses überflogen und während des Bruchteils einer Sekunde auf Hans Castorps Antlitz verweilt … Bleich war der Zurückbleibende auf sein Zimmer geeilt, in seine Loggia, um den Schlitten von hier aus noch einmal zu sehen, der mit Geklingel die Anfahrtstraße hinab gegen "Dorf" hingeglitten war, hatte sich dann in seinen Stuhl geworfen und aus der Brusttasche die Erinnerungsgabe gezogen, das Pfand, das diesmal nicht in bräunlichroten Holzschnitzeln, sondern in einem dünn gerahmten Plättchen, einer Glasplatte bestand, die man gegen das Licht halten mußte, um etwas an ihr zu finden, – Clawdias Innenporträt, das ohne Antlitz war, aber das zarte Ge-bein ihres Oberkörpers, von den weichen Formen des Fleisches licht und geisterhaft umgeben, nebst den Organen der Brust-höhle erkennen ließ …
Wie oft hatte er es betrachtet und an die Lippen gedrückt in der Zeit, die seitdem verflossen war, indem sie Veränderung ge-zeitigt hatte! Gewöhnung zum Beispiel an ein Leben hier oben in räumlich weiter Abwesenheit Clawdia Chauchats hatte sie gezeitigt, und zwar geschwinder, als man hätte denken sollen: die hiesige Zeit war ja besonders danach geartet und außerdem zu dem Zwecke organisiert, Gewöhnung zu zeitigen, wenn auch nur Gewöhnung daran, daß man sich nicht gewöhnte. Der klir-rende Knall zu Beginn der fünf übergewaltigen Mahlzeiten war nicht mehr zu gewärtigen und trat nicht mehr ein; anderswo, in ungeheurer Entfernung, ließ Frau Chauchat nun Türen zufallen, – eine Wesensäußerung, die mit ihrem Dasein, ihrer Krankheit auf ähnliche Art vermengt und verbunden war wie die Zeit mit den Körpern im Raum: vielleicht war das ihre Krankheit, und nichts weiter … Aber war sie unsichtbar-abwesend, so war sie doch zugleich auch unsichtbar-anwesend für Hans Castorps Sinn, – der Genius des Ortes, den er in schlimmer, in ausschreitungsvoll süßer Stunde, in einer Stunde, auf die kein friedliches kleines Lied des Flachlandes paßte, erkannt und besessen hatte, und dessen inneres Schattenbild er auf seinem seit neun Mona-ten so heftig in Anspruch genommenen Herzen trug.
In jener Stunde hatte sein zuckender Mund in fremder Spra-che und in der angeborenen so manches Ausschreitungsvolle halb unbewußt und halb erstickt gestammelt: Vorschläge, Aner-bietungen, tolle Entwürfe und Willensvorsätze, denen alle Billi-gung mit Fug und Recht versagt geblieben war, – so, daß er den Genius über den Kaukasus begleiten, ihm nachreisen, ihn an dem Orte, den die freizügige Laune des Genius sich zum näch-sten Domizil erwählen werde, erwarten wolle, um sich niemals mehr von ihm zu trennen, und andere UnVerantwortlichkeiten mehr. Was der schlichte junge Mann mitgenommen hatte aus dieser Stunde tiefen Abenteuers, war eben nur das Schat-tenpfand gewesen und die dem Range des Wahrscheinlichen sich nähernde Möglichkeit, daß Frau Chauchat zu einem vierten Aufenthalt hierher zurückkehren werde, früher oder später, wie die Krankheit, die ihr Freiheit gab, es fügen würde. Aber ob früher oder später, – Hans Castorp, so hatte es auch beim Abschied wieder geheißen, werde dann unbedingt "längst weit fort" sein; und der geringschätzige Sinn dieser Prophezeiung wäre noch schwerer erträglich gewesen, wenn man nicht hätte bedenken können, daß gewisse Dinge nicht prophezeit werden, damit sie eintreten, sondern damit sie nicht eintreten, gleichsam im Sinn der Beschwörung. Propheten dieser Art verhöhnen die Zukunft, indem sie ihr sagen, wie sie sich gestalten werde, damit sie sich schäme, sich wirklich so zu gestalten. Und wenn der Genius ihn, Hans Castorp, im Laufe des mitgeteilten Gesprächs und au-ßerhalb seiner einen "joli bourgeois au petit endroit humide" genannt hatte, was etwas wie die Übersetzung der Redensart Settembrinis vom "Sorgenkind des Lebens" gewesen war, so fragte es sich eben, welcher Bestandteil dieser Wesensmischung sich als stärker erweisen würde: der bourgeois oder das andere .. . Auch hatte der Genius nicht in Betracht gezogen, daß er selbst ja verschiedentlich abgereist und wiedergekommen war und daß auch Hans Castorp im rechten Augenblick würde wiederkommen können, – obgleich er ja freilich überhaupt nur deshalb noch immer hier oben saß, damit er nicht wiederzukommen brauchte: das war ausdrücklich, wie bei so vielen, der Sinn seines Verweilens.
Eine spöttische Prophezeiung vom Faschingsabend war einge-troffen: Hans Castorp hatte eine schlechte Fieberlinie gehabt, in steiler Zacke, die er mit einem Gefühl von Festlichkeit einge-zeichnet, war seine Kurve damals emporgestiegen und, nach ei-nigem Absinken, als Hochplateau fortgelaufen, das sich, nur leicht gewellt, dauernd über der Ebene des bisher Gewohnten hielt. Es war eine Übertemperatur, deren Höhe und Hartnäckig-keit nach des Hofrats Aussage zu dem lokalen Befund in kei-nem rechten Verhältnis stand. "Sind eben doch vergifteter, als man Ihnen zutrauen sollte, Freundchen", sagte er. "Na, greifen wir mal zu den Injektionen! Das wird Ihnen anschlagen. In drei, vier Monaten sind Sie wie der Fisch im Wasser, wenn es nach dem Unterfertigten geht." So kam es, daß Hans Castorp nun zweimal die Woche, am Mittwoch und Sonnabend gleich nach der Morgenmotion, sich im "Labor" drunten einzufinden hatte, um seine Einspritzung entgegenzunehmen.
Beide Ärzte verabfolgten dies Heilmittel, bald dieser, bald jener, aber der Hofrat tat es als Virtuos, mit einem Schwung, indem er beim Einstich zugleich abdrückte. Übrigens kümmerte er sich nicht um die Stelle, wohin er stach, so daß der Schmerz zuweilen des Teufels war und der Punkt noch lange brennend verhärtet blieb. Ferner wirkte die Injektion stark angreifend auf den Gesamtorganismus, erschütterte das Nervensystem wie eine Gewaltleistung sportlicher Art, und das zeugte für die ihr inne-wohnende Kraft, die sich auch darin bekundete, daß sie unmit-telbar, für den Augenblick, die Temperatur sogar erhöhte: so hatte der Hofrat es vorausgesagt, und so geschah es denn auch, gesetzmäßig und ohne daß es an der vorausgesagten Erschei-nung etwas zu beanstanden gab. Die Prozedur war rasch abgetan, war man nur erst einmal an der Reihe; im Handumdrehen hatte man sein Gegengift unter der Haut, sei es des Schenkels oder Armes. Ein paarmal aber, wenn der Hofrat sich eben auf-gelegt und vom Tabak nicht getrübt zeigte, kam es anläßlich der Injektion doch zu einem kleinen Gespräch mit ihm, das Hans Castorp etwa wie folgt zu lenken wußte:
"Ich denke noch immer gern an unsere gemütliche Kaffeestunde damals bei Ihnen, Herr Hofrat, voriges Jahr im Herbst, wie sich das zufällig so machte. Gerade noch gestern, oder ist es schon etwas länger her, habe ich meinen Vetter daran erin-nert …"
"Gaffky sieben", sagte der Hofrat. "Letztes Ergebnis. Der Junge will und will sich nun mal nicht entgiften. Und dabei hat er mich noch nie so getirrt und geplagt wie neuerdings, daß er weg will und einen Schleppsäbel haben, der Kindskopf Zetert mir über seine fünf Vierteljährchen vor, als ob es Äonen wären, die er sich um die Ohren geschlagen. Weg will er, so oder so, – sagt er es zu Ihnen auch? Sie sollten ihm mal ins Gewissen re-den, von Ihnen aus, und das mit Nachdruck! Das Mannsbild geht Ihnen in die Binsen, wenn es vorzeitig Ihren gemütvollen Nebel schluckt, da oben rechts. So ein Eisenfresser braucht nicht viel Hirnschmalz zu haben, aber Sie als der Gesetztere, der Zivi-list, der Mann bürgerlicher Bildung, Sie sollten ihm den Kopf zurechtsetzen, bevor er Dummheiten macht."
"Tu' ich, Herr Hofrat", antwortete Hans Castorp, ohne die Führung fahren zu lassen. "Tu' ich öfters, wenn er so aufmuckt, und denke ja auch, er wird Räson annehmen. Aber die Beispie-le, die man vor Augen hat, sind ja nicht immer die besten, das ist das Schädliche. Immer kommen Abreisen vor, – Abreisen ins Flachland, eigenmächtig und ohne wahre Befugnis, aber es ist eine Festivität, als ob es eine echte Abreise wäre, und hat was Verführerisches für schwächere Charaktere. Zum Beispiel neu-lich … wer ist denn neulich noch abgereist? Eine Dame, vom Guten Russentisch, Madame Chauchat. Nach Daghestan, wie er-zählt wurde. Nun, Daghestan, ich kenne das Klima nicht, es ist am Ende weniger ungünstig als oben am Wasser. Aber Flachland ist es doch in unserem Sinn, wenn es vielleicht auch gebir-gig ist, geographisch genommen, ich bin da nicht so beschlagen. Wie will man denn da nun leben, unausgeheilt, wo die Grund-begriffe fehlen und niemand von unserer Ordnung hier oben weiß und wie es zu halten ist mit Liegen und Messen? Übrigens will sie ja ohnedies wiederkommen, hat sie mir gelegentlich mitgeteilt, – wie kamen wir überhaupt auf sie? – Ja, damals tra-fen wir Sie im Garten, Herr Hofrat, wenn Sie sich erinnern, das heißt Sie trafen uns, denn wir saßen auf einer Bank, ich weiß noch auf welcher, genau könnt' ich sie Ihnen bezeichnen, auf der wir saßen und rauchten. Will sagen, ich rauchte, denn mein Vetter raucht ja unbegreiflicherweise nicht. Und Sie rauchten auch gerade, und wir offerierten uns gegenseitig noch unsere Marken, wie mir eben wieder einfällt, – Ihre Brasil hat mir aus-gezeichnet geschmeckt, aber man muß damit umgehen wie mit jungen Pferden, glaub ich, sonst stößt einem was zu, wie Ihnen damals nach den beiden kleinen Importen, als Sie mit wogendem Busen abtanzen wollten, – da es gut gegangen ist, kann man ja lachen. Von Maria Mancini hab ich mir übrigens neulich wieder ein paar hundert Stück aus Bremen verschrieben, ich hänge doch sehr an dem Erzeugnis, es ist mir nach jeder Rich-tung sympathisch. Nur allerdings, die Verteuerung durch Zoll und Porto ist ziemlich empfindlich, und wenn Sie mir nächstens noch was Beträchtliches zulegen, Herr Hofrat, so bin ich im-stande und bekehre mich schließlich zu einem hiesigen Kraut, – man sieht in den Fenstern ganz schöne Sachen. Und dann durf-ten wir Ihre Bilder sehen, ich weiß es wie heute, und hatte den größten Genuß davon, – geradezu perplex war ich, was Sie mit der Ölfarbe riskieren, ich würd' es mich nie unterstehen. Da sa-hen wir ja auch Frau Chauchats Porträt mit seiner erstrangig ge-malten Haut, – ich darf wohl sagen, ich war begeistert. Damals kannte ich das Modell noch nicht, nur vom Ansehen, dem Na-men nach. Seitdem, ganz kurz vor ihrer diesmaligen Abreise, habe ich sie ja noch persönlich kennengelernt."
"Was Sie sagen!" erwiderte der Hofrat, – ebenso, wenn die Rückbeziehung erlaubt ist, wie er erwidert hatte, als Hans Castorp ihm vor seiner ersten Untersuchung mitgeteilt, daß er übrigens auch etwas Fieber habe. Und weiter sagte er nichts.
"Doch, ja, das habe ich", bestätigte Hans Castorp. "Erfahrungsgemäß ist es gar nicht so leicht, hier oben Bekanntschaften zu machen, aber mit Frau Chauchat und mir hat es sich in letzter Stunde doch noch getroffen und arrangiert, gesprächsweise sind wir uns …" Hans Castorp zog die Luft durch die Zähne ein. Er hatte die Spritze empfangen. "Fff!" machte er rückwärts. "Das war sicher ein hochwichtiger Nerv, den Sie da zufällig getroffen haben, Herr Hofrat. Oh, ja, ja, es schmerzt höllenmäßig. Danke, etwas Massage verbessert die Sache … Gesprächsweise sind wir uns näher gekommen."
"So! – Na?" machte der Hofrat. Er fragte kopfnickend, mit jemandes Miene, der eine sehr lobende Antwort erwartet und in die Frage zugleich die Bestätigung des zu erwartenden Lobes aus eigener Erfahrung legt.
"Ich nehme an, daß es mit meinem Französisch etwas geha-pert hat", wich Hans Castorp aus. "Woher soll ich's am Ende auch haben. Aber im rechten Augenblick fliegt einem ja man-ches an, und so ging es denn mit der Verständigung doch ganz leidlich."
"Glaub' ich. Na?" wiederholte der Hofrat seine Aufforderung. Von sich aus fügte er hinzu: "Niedlich, was?"
Hans Castorp, den Hemdkragen knüpfend, stand mit ge-spreizten Beinen und Ellbogen, das Gesicht zur Decke gewandt.
"Es ist am Ende nichts Neues", sagte er. "An einem Badeort leben zwei Personen oder auch Familien wochenlang unter demselben Dach, in Distanz. Eines Tages machen sie Bekanntschaft, finden aufrichtiges Gefallen aneinander, und zugleich stellt sich heraus, daß der eine Teil im Begriffe ist, abzureisen. So ein Bedauern kommt häufig vor, kann ich mir denken. Und da möchte man nun doch wenigstens Fühlung wahren im Leben, voneinander hören, das heißt per Post. Aber Frau Chau-chat…"
"Tja, die will wohl nicht?" lachte der Hofrat gemütlich.
"Nein, sie wollte nichts davon wissen. Schreibt sie Ihnen denn auch nie zwischendurch, von ihren Aufenthaltsorten?"
"I, Gott bewahre", antwortete Behrens. "Das fällt doch der nicht ein. Erstens aus Faulheit nicht, und dann, wie soll sie denn schreiben? Russisch kann ich nicht lesen, – ich kauderwelsche es wohl mal, wenn Not an den Mann kommt, aber lesen kann ich kein Wort. Und Sie doch auch nicht. Na, und Französisch oder auch Neuhochdeutsch miaut das Kätzchen ja allerliebst, aber schreiben, – da käme sie in die größte Verlegenheit. Die Ortho-graphie, lieber Freund! Nein, da müssen wir uns schon trösten, mein Junge. Sie kommt ja immer mal wieder, von Zeit zu Zeit. Frage der Technik, Temperamentssache, wie gesagt. Der eine hält dann und wann Abreise und muß immer wiederkommen, und der andere bleibt gleich so lange, daß er nie wiederzukom-men braucht. Wenn Ihr Vetter jetzt abreist, das sagen Sie ihm nur, so kann es leicht sein, daß Sie seinen solennen Wiederein-zug noch hier erleben."
"Aber Herr Hofrat, wie lange meinen Sie denn, daß ich …" "Daß Sie? Daß er! Daß er nicht so lange untenbleiben wird, wie er hier oben war. Das meine ich für meine treuherzige Person, und das ist mein Auftrag an Sie für ihn, wenn Sie so freundlich sein wollen."
Ähnlich mochte wohl so ein Gespräch verlaufen, pfiffig ge-lenkt von Hans Castorp, wenn das Ergebnis auch nichtig bis zweideutig gewesen war. Denn was das betraf, wie lange man bleiben müsse, um die Wiederkehr eines vor der Zeit Abgerei-sten zu erleben, war es zweideutig gewesen, in Hinsicht auf die Entschwundene aber gleich null. Hans Castorp würde nichts von ihr hören, solange das Geheimnis von Raum und Zeit sie trennte; sie würde nicht schreiben, und auch ihm würde keine Gelegenheit gegeben sein, es zu tun … Warum denn auch übri-gens, hätte es sich anders verhalten sollen, wenn er es wohl überlegte? War es nicht eine recht bürgerliche und pedantische Vorstellung von ihm gewesen, daß sie einander schreiben müß-ten, während ihm doch ehemals zumute gewesen war, als sei es nicht einmal nötig oder nur wünschenswert, daß sie miteinan-der sprächen? Und hatte er denn auch etwa mit ihr "gesprochen", im Sinne des gebildeten Abendlandes, an ihrer Seite am Fa-schingsabend, oder nicht vielmehr fremdsprachig im Traum ge-redet, auf wenig zivilisierte Weise?
Wozu denn also nun schreiben, auf Briefpapier oder An-sichtskarten, wie er sie manchmal nach Hause ins Flachland richtete, um über die Schwankungen der Untersuchungsergebnisse zu berichten? Hatte Clawdia nicht recht, sich vom Schreiben entbunden zu fühlen, kraft der Freiheit, welche die Krank-heit ihr gab? Sprechen, schreiben, – eine hervorragend humanistisch-republikanische Angelegenheit in der Tat, Angelegen-heit des Herrn Brunetto Latini, der das Buch von den Tugenden und Lastern schrieb und den Florentinern Schliff gab, sie das Sprechen lehrte und die Kunst, ihre Republik nach den Regeln der Politik zu lenken …
Damit fielen Hans Castorps Gedanken denn auf Lodovico Settembrini, und er errötete, wie er damals errötet war, als der Schriftsteller unvermutet sein Krankenzimmer betreten hatte, unter plötzlicher Erleuchtung desselben. An Herrn Settembrini hätte Hans Castorp ja ebenfalls seine Fragen, die übersinnlichen Rätsel betreffend, richten können, wenn auch nur im Sinne der Herausforderung und der Quengelei, nicht in der Erwartung, von dem Humanisten, dessen Trachten den irdischen Lebensin-teressen galt, Antwort darauf zu erhalten. Aber seit der Fa-schingsgeselligkeit und Settembrini s bewegtem Abgang aus dem Klaviersalon waltete zwischen Hans Castorp und dem Ita-liener eine Entfremdung, die auf das schlechte Gewissen des ei-nen, sowie auf die tiefe pädagogische Verstimmung des andern zurückzuführen war und dahin wirkte, daß sie einander mieden und wochenlang kein Wort zwischen ihnen gewechselt wurde. War Hans Castorp noch ein "Sorgenkind des Lebens" in Herrn Settembrinis Augen? Nein, er war wohl ein Aufgegebener in den Augen dessen, der die Moral in der Vernunft und der Tu-gend suchte … Und Hans Castorp verstockte sich gegen Herrn Settembrini, er zog die Brauen zusammen und warf die Lippen auf, wenn sie einander begegneten, während Herrn Settembrinis schwarz glänzender Blick mit schweigendem Vorwurf auf ihm ruhte. Dennoch löste diese Verstocktheit sich sofort, als der Literat nach Wochen, wie gesagt, zum erstenmal wieder das Wort an ihn richtete, wenn auch nur im Vorüberstreifen und in Form mythologischer Anspielungen, zu deren Verständnis abendländische Bildung gehörte. Es war nach dem Diner; sie trafen in der nicht mehr zufallenden Glastür zusammen. Settembrini sagte, den jungen Mann überholend und von vornher-ein im Begriff, sich gleich wieder von ihm zu lösen: –
"Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel gemundet?"
Hans Castorp lächelte erfreut und verwirrt.
"Das heißt… Wie meinen Sie, Herr Settembrini? Granatapfel? Es gab doch keine? Ich habe nie im Leben … Doch, einmal habe ich Granatapfelsaft mit Selters getrunken. Es schmeckte zu süßlich."
Der Italiener, schon vorüber, wandte den Kopf zurück und artikulierte: "Götter und Sterbliche haben zuweilen das Schat-tenreich besucht und den Rückweg gefunden. Aber die Unterir-dischen wissen, daß, wer von den Früchten ihres Reiches kostet, ihnen verfallen bleibt."
Und er ging weiter, in seinen ewig hell gewürfelten Hosen, und ließ im Rücken Hans Castorp, der "durchbohrt" sein sollte von so viel Bedeutung und es gewissermaßen auch war, ob-gleich er, ärgerlich erheitert über die Zumutung, es zu sein, vor sich hin murmelte:
"Latini, Carducci, Ratzi-Mausi-Falli, laß mich in Frieden!"
Gleichwohl war er sehr glücklich bewegt über diese erste Anrede; denn trotz der Trophäe, dem makabren Angebinde, das er auf dem Herzen trug, hing er an Herrn Settembrini, legte großes Gewicht auf sein Dasein, und der Gedanke, gänzlich und auf immer von ihm verworfen und aufgegeben zu sein, wäre denn doch beschwerender und schrecklicher für seine Seele ge-wesen, als das Gefühl des Knaben, der in der Schule nicht mehr in Betracht gekommen war und die Vorteile der Schande ge-nossen hatte, wie Herr Albin … Doch wagte er nicht, von seiner Seite das Wort an den Mentor zu richten, und dieser ließ abermals Wochen vergehen, bis er sich dem Sorgenzögling wieder einmal näherte.
Das geschah, als auf den in ewig eintönigem Rhythmus an-rollenden Meereswogen der Zeit Ostern herangetrieben war und auf "Berghof" begangen wurde, wie man alle Etappen und Umschnitte dort aufmerksam beging, um ein ungegliedertes Ei-nerlei zu vermeiden. Beim ersten Frühstück fand jeder Gast ne-ben seinem Gedecke ein Veilchensträußchen, beim zweiten Frühstück erhielt jedermann ein gefärbtes Ei, und die festliche Mittagstafel war mit Häschen geschmückt aus Zucker und Scho-kolade.
"Haben Sie je eine Schiffsreise gemacht, Tenente, oder Sie, Ingenieur?" fragte Herr Settembrini, als er nach Tische in der Halle mit seinem Zahnstocher an das Tischchen der Vettern her-antrat … Wie die Mehrzahl der Gäste kürzten sie heute den Hauptliegedienst um eine Viertelstunde, indem sie sich hier zu einem Kaffee mit Kognak niedergelassen hatten. "Ich bin erin-nert durch diese Häschen, diese gefärbten Eier an das Leben auf so einem großen Dampfer, bei leerem Horizont seit Wochen, in salziger Wüstenei, unter Umständen, deren vollkommene Be-quemlichkeit ihre Ungeheuerlichkeit nur oberflächlich verges-sen läßt, während in den tieferen Gegenden des Gemütes das Bewußtsein davon als ein geheimes Grauen leise fortnagt… Ich erkenne den Geist wieder, in dem man an Bord einer sol-chen Arche die Feste der terra ferma pietätvoll andeutet. Es ist das Gedenken von Außerweltlichen, empfindsame Erinnerung nach dem Kalender … Auf dem Festlande wäre heut Ostern, nicht wahr? Auf dem Festlande begeht man heut Königs Ge-burtstag, – und wir tun es auch, so gut wir können, wir sind auch Menschen … Ist es nicht so?"
Die Vettern stimmten zu. Wahrhaftig, so sei es. Hans Castorp, gerührt von der Anrede und vom schlechten Gewissen gespornt, lobte die Äußerung in hohen Tönen, fand sie geist-reich, vorzüglich und schriftstellerisch und redete Herrn Set-tembrini aus allen Kräften nach dem Munde. Gewiß, nur ober-flächlich, ganz wie Herr Settembrini es so plastisch gesagt habe, lasse der Komfort auf dem Ozean-Steamer die Umstände und ihre Gewagtheit vergessen, und es liege, wenn er auf eigene Hand das hinzufügen dürfe, sogar eine gewisse Frivolität und Herausforderung in diesem vollendeten Komfort, etwas dem Ähnliches, was die Alten Hybris genannt hätten (sogar die Alten zitierte er aus Gefallsucht), oder dergleichen, wie "Ich bin der König von Babylon!", kurz Frevelhaftes. Auf der anderen Seite aber involviere ("involviere"!) der Luxus an Bord doch auch ei-nen großen Triumph des Menschengeistes und der Menschen-ehre, – indem er diesen Luxus und Komfort auf die salzigen Schäume hinaustrage und dort kühnlich aufrecht erhalte, setze der Mensch gleichsam den Elementen den Fuß auf den Nacken, den wilden Gewalten, und das involviere den Sieg der mensch-lichen Zivilisation über das Chaos, wenn er auf eigene Hand diesen Ausdruck gebrauchen dürfe …
Herr Settembrini hörte ihm aufmerksam zu, die Füße ge-kreuzt und die Arme ebenfalls, wobei er sich auf zierliche Art mit dem Zahnstocher den geschwungenen Schnurrbart strich.
"Es ist bemerkenswert", sagte er. "Der Mensch tut keine nur einigermaßen gesammelte Äußerung allgemeiner Natur, ohne sich ganz zu verraten, unversehens sein ganzes Ich hineinzulegen, das Grundthema und Urproblem seines Lebens irgendwie im Gleichnis darzustellen. So ist es Ihnen soeben ergangen, In-genieur. Was Sie da sagten, kam in der Tat aus dem Grunde Ihrer Persönlichkeit, und auch den zeitlichen Zustand dieser Per-sönlichkeit drückte es auf dichterische Weise aus: es ist immer noch der Zustand des Experimentes …"
"Placet experiri!" sagte Hans Castorp nickend und lachend, mit italienischem c.
"Sicuro, – wenn es sich dabei um die respektable Leidenschaft der Welterprobung handelt und nicht um Liederlichkeit. Sie sprachen von 'Hybris', Sie bedienten sich dieses Ausdrucks. Aber die Hybris der Vernunft gegen die dunklen Gewalten ist höchste Menschlichkeit, und beschwört sie die Rache neidischer Götter herauf, per esempio, indem die Luxusarche scheitert und senkrecht in die Tiefe geht, so ist das ein Untergang in Ehren. Auch die Tat des Prometheus war Hybris, und seine Qual am skythischen Felsen gilt uns als heiligstes Martyrium. Wie steht es dagegen um jene andere Hybris, um den Untergang im buh-lerischen Experiment mit den Mächten der Widervernunft und der Feindschaft gegen das Menschengeschlecht? Hat das Ehre? Kann das Ehre haben? Si o no!"
Hans Castorp rührte in seinem Täßchen, obgleich nichts mehr darin war.
"Ingenieur, Ingenieur", sagte der Italiener mit dem Kopfe nickend, und seine schwarzen Augen hatten sich sinnend "fest-gesehen", "fürchten Sie nicht den Wirbelsturm des zweiten Höllenkreises, der die Fleischessünder prellt und schwenkt, die Unseligen, die die Vernunft der Lust zum Opfer brachten? Gran Dio, wenn ich mir einbilde, wie Sie kopfüber, kopfunter um-hergepustet flattern werden, so möchte ich vor Kummer umfal-len wie eine Leiche fällt …"
Sie lachten, froh, daß er scherzte und Poetisches redete. Aber Settembrini setzte hinzu:
"Am Faschingsabend beim Wein, Sie erinnern sich, Ingenieur, nahmen Sie gewissermaßen Abschied von mir, doch, es war etwas dem Ähnliches. Nun, heute bin ich an der Reihe. Wie Sie mich hier sehen, meine Herren, bin ich im Begriff, Ihnen Lebewohl zu sagen. Ich verlasse dies Haus."
Beide verwunderten sich aufs höchste.
"Nicht möglich! Das ist nur Scherz!" rief Hans Castorp, wie er bei anderer Gelegenheit auch gerufen hatte. Er war fast eben-so erschrocken wie damals. Aber auch Settembrini erwiderte: "Durchaus nicht. Es ist, wie ich Ihnen sage. Und übrigens trifft Sie diese Nachricht nicht unvorbereitet. Ich habe Ihnen erklärt, daß in dem Augenblick, wo sich meine Hoffnung, in irgendwie absehbarer Zeit in die Welt der Arbeit zurückkehren zu können, als unhaltbar erweisen werde, ich hier meine Zelte abzubrechen und irgendwo im Orte mich für die Dauer einzurichten entschlossen sei. Was wollen Sie nun, – dieser Augenblick ist ein-getreten. Ich kann nicht genesen, es ist ausgemacht. Ich kann mein Leben fristen, aber nur hier. Das Urteil, das endgültige Urteil, lautet auf lebenslänglich, – mit der ihm eigenen Aufge-räumtheit hat Hofrat Behrens es mir verkündet. Gut denn, ich ziehe die Folgerungen. Ein Logis ist gemietet, ich bin im Be-griffe, meine geringe irdische Habe, mein literarisches Hand-werkszeug dorthin zu schaffen … Es ist nicht einmal weit von hier, in 'Dorf', wir werden einander begegnen, gewiß, ich wer-de Sie nicht aus den Augen verlieren, als Hausgenosse aber habe ich die Ehre, mich von Ihnen zu verabschieden."
So Settembrinis Eröffnung am Ostersonntag. Die Vettern hatten sich außerordentlich bewegt darüber gezeigt. Des längeren noch, und wiederholt, hatten sie mit dem Literaten über sei-nen Entschluß gesprochen: darüber, wie er auch privatim den Kurdienst weiter werde ausüben können, über die Mitnahme und Fortführung ferner der weitläufigen enzyklopädischen Arbeit, die er auf sich genommen, jener Übersicht aller schöngei-stigen Meisterwerke, unter dem Gesichtspunkt der Leidenskon-flikte und ihrer Ausmerzung; endlich auch über sein zukünfti-ges Quartier im Hause eines "Gewürzkrämers", wie Herr Set-tembrini sich ausdrückte. Der Gewürzkrämer, berichtete er, habe den oberen Teil seines Eigentums an einen böhmischen Da-menschneider vermietet, der seinerseits Aftermieter aufneh-me … Diese Gespräche also lagen zurück. Die Zeit schritt fort, und mehr als eine Veränderung hatte sie bereits gezeitigt. Set-tembrini wohnte wirklich nicht mehr im internationalen Sanatorium "Berghof", sondern bei Lukaçek, dem Damenschneider, – schon seit einigen Wochen. Nicht in Form einer Schlittenab-reise hatte sein Auszug sich abgespielt, sondern zu Fuß, in kur-zem, gelbem Paletot, der am Kragen und an den Ärmeln ein wenig mit Pelz besetzt war, und begleitet von einem Mann, der auf einem Schubkarren das literarische und das irdische Hand-gepäck des Schriftstellers beförderte, hatte man ihn stock-schwingend davongehen sehen, nachdem er noch unterm Portal eine Saaltochter mit den Rücken zweier Finger in die Wange gezwickt … Der April, wie wir sagten, lag schon zu einem gu-ten Teil, zu drei Vierteln, im Schatten der Vergangenheit, noch war es tiefer Winter, gewiß, im Zimmer hatte man knappe sechs Wärmegrade am Morgen, draußen war neungradige Kälte, die Tinte im Glase, wenn man es in der Loggia ließ, gefror über Nacht noch immer zu einem Eisklumpen, einem Stück Stein-kohle. Aber der Frühling nahte, das wußte man; am Tage, wenn die Sonne schien, spürte man hie und da bereits eine ganz leise, ganz zarte Ahnung von ihm in der Luft; die Periode der Schneeschmelze stand in naher Aussicht, und damit hingen die Veränderungen zusammen, die sich auf "Berghof" unaufhaltsam vollzogen, – nicht aufzuhalten selbst durch die Autorität, das le-bendige Wort des Hofrats, der in Zimmer und Saal, bei jeder Untersuchung, jeder Visite, jeder Mahlzeit das populäre Vorur-teil gegen die Schneeschmelze bekämpfte.
Ob es Wintersportsleute seien, fragte er, mit denen er es zu tun habe, oder Kranke, Patienten? Wozu in aller Welt sie denn Schnee, gefrorenen Schnee brauchten? Eine ungünstige Zeit, – die Schneeschmelze? Die allergünstigste sei es! Nachweislich gäbe es im ganzen Tal um diese Zeit verhältnismäßig weniger Bettlägrige, als irgendwann sonst im Jahre! Überall in der wei-ten Welt seien die Wetterbedingungen für Lungenkranke zu dieser Frist schlechter als gerade hier! Wer einen Funken Ver-stand habe, der harre aus und nutze die abhärtende Wirkung der hiesigen Witterungsverhältnisse. Danach dann sei er fest gegen Hieb und Stich, gefeit gegen jedes Klima der Welt, vorausge-setzt nur, daß der volle Eintritt der Heilung abgewartet worden sei – und so fort. Aber der Hofrat hatte gut reden, – die Vorein-genommenheit gegen die Schneeschmelze saß fest in den Köp-fen, der Kurort leerte sich; wohl möglich, daß es der sich nä-hernde Frühling war, der den Leuten im Leibe rumorte und seßhafte Leute unruhig und veränderungssüchtig machte, – je-denfalls mehrten die "wilden" und "falschen" Abreisen sich auch im Hause Berghof bis zur Bedenklichkeit. Frau Salomon aus Amsterdam zum Beispiel, trotz dem Vergnügen, das die Untersuchungen und das damit verbundene Zurschaustellen feinster Spitzenwäsche ihr bereiteten, reiste vollständig wilder-und falscherweise ab, ohne jede Erlaubnis und nicht, weil es ihr besser, sondern weil es ihr immer schlechter ging. Ihr Aufent-halt hier oben verlor sich weit zurück hinter Hans Castorps An-kunft; länger als ein Jahr war es her, daß sie eingetroffen war, – mit einer ganz leichten Affektion, für die ihr drei Monate zu-diktiert worden waren. Nach vier Monaten hatte sie "in vier Wochen sicher gesund" sein sollen, aber sechs Wochen später hatte von Heilung überhaupt nicht die Rede sein können: sie müsse, hatte es geheißen, mindestens noch vier Monate bleiben. So war es fortgegangen, und es war ja kein Bagno und kein si-birisches Bergwerk hier, – Frau Salomon war geblieben und hatte feinstes Unterzeug an den Tag gelegt. Da sie nun aber nach der letzten Untersuchung, im Angesicht der Schnee-schmelze, eine neue Zulage von fünf Monaten erhalten hatte, wegen Pfeifens links oben und unverkennbarer Mißtöne unter der linken Achsel, war ihr die Geduld gerissen, und mit Protest, unter Schmähungen auf "Dorf" und "Platz", auf die berühmte Luft, das internationale Haus Berghof und die Ärzte reiste sie ab, nach Hause, nach Amsterdam, einer zugigen Wasserstadt.
War das klug gehandelt? Hofrat Behrens hob Schultern und Arme auf und ließ die letzteren geräuschvoll gegen die Schen-kel zurückfallen. Spätestens im Herbst, sagte er, werde Frau Salomon wieder da sein, – dann aber auf immer. Würde er recht behalten? Wir werden sehen, wir sind noch auf längere Erden-zeit an diesen Lustort gebunden. Aber der Fall Salomon war also durchaus nicht der einzige seiner Art. Die Zeit zeitigte Ver-änderungen, – sie hatte das ja immer getan, aber allmählicher, nicht so auffallend. Der Speisesaal wies Lücken auf, Lücken an allen sieben Tischen, am Guten Russentisch wie am Schlechten, an den längs – wie an den querstehenden. Nicht gerade, daß dies von der Frequenz des Hauses ein zuverlässiges Bild gegeben hätte; auch Ankünfte, wie jederzeit, hatten stattgefunden; die Zimmer mochten besetzt sein, aber da handelte es sich eben um Gäste, die durch finalen Zustand in ihrer Freizügigkeit einge-schränkt waren. Im Speisesaal, wie wir sagten, fehlte manch einer dank noch bestehender Freizügigkeit; manch einer aber tat es sogar auf eine besonders tiefe und hohle Weise, wie Dr. Blumenkohl, der tot war. Immer stärker hatte sein Gesicht den Ausdruck angenommen, als habe er etwas schlecht Schmecken-des im Munde; dann war er dauernd bettlägrig geworden und dann gestorben, – niemand wußte genau zu sagen, wann; mit aller gewohnten Rücksicht und Diskretion war die Sache behandelt worden. Eine Lücke. Frau Stöhr saß neben der Lücke, und sie graute sich vor ihr. Darum siedelte sie an des jungen Ziemßen andere Seite über, an den Platz Miß Robinsons, die als geheilt entlassen worden, gegenüber der Lehrerin, Hans Ca-storps linksseitiger Nachbarin, die fest auf ihrem Posten geblieben war. Ganz allein saß sie derzeit an dieser Tischseite, die üb-rigen drei Plätze waren frei. Student Rasmussen, der täglich dünner und schlaffer geworden, war bettlägrig und galt für moribund; und die Großtante war mit ihrer Nichte und der hoch-brüstigen Marusja verreist, – wir sagen "verreist", wie alle es sagten, weil ihre Rückkehr in naher Zeit eine ausgemachte Sache war. Zum Herbst schon würden sie wieder eintreffen, – war das eine Abreise zu nennen? Wie nah war nicht Sommerson-nenwende, wenn erst einmal Pfingsten gewesen war, das vor der Türe stand; und kam der längste Tag, so gings ja rapide bergab, auf den Winter zu, – kurzum, die Großtante und Marusja waren beinahe schon wieder da, und das war gut, denn die lachlustige Marusja war keineswegs ausgeheilt und entgiftet; die Lehrerin wußte etwas von tuberkulösen Geschwüren, die die braunäugige Marusja an ihrer üppigen Brust haben sollte, und die schon mehrmals hatten operiert werden müssen. Hans Ca-storp hatte, als die Lehrerin davon sprach, hastig auf Joachim ge-blickt, der sein fleckig gewordenes Gesicht über seinen Teller geneigt hatte.
Die muntere Großtante hatte den Tischgenossen, also den Vettern, der Lehrerin und Frau Stöhr ein Abschiedssouper im Restaurant gegeben, eine Schmauserei mit Kaviar, Champagner und Likören, bei der Joachim sich sehr still verhalten, ja, nur einzelnes mit fast tonloser Stimme gesprochen hatte, so daß die Großtante in ihrer Menschenfreundlichkeit ihm Mut zugespro-chen und ihn dabei, unter Ausschaltung zivilisierter Sittengeset-ze, sogar geduzt hatte. "Hat nichts auf sich, Väterchen, mach' dir nichts draus, sondern trink, iß und sprich, wir kommen bald wieder!" hatte sie gesagt. "Wollen wir alle essen, trinken und schwatzen und den Gram – Gram sein lassen, Gott läßt Herbst werden, eh wir's gedacht, urteile selbst, ob Grund ist zum Kum-mer!" Am nächsten Morgen hatte sie zur Erinnerung bunte Schachteln mit "Konfäktchen" an fast alle Besucher des Speise-saales verteilt und war dann mit ihren beiden jungen Mädchen etwas verreist.
Und Joachim, wie stand es um ihn? War er befreit und er-leichtert seitdem, oder litt seine Seele schwere Entbehrung an-gesichts der leeren Tischseite? Hing seine ungewohnte und em-pörerische Ungeduld, seine Drohung, wilde Abreise halten zu wollen, wenn man ihn länger an der Nase führe, mit der Abreise Marusjas zusammen? Oder war vielmehr die Tatsache, daß er vorderhand eben doch noch nicht reiste, sondern der hofrätli-chen Verherrlichung der Schneeschmelze sein Ohr lieh, auf jene andere zurückzuführen, daß die hochbusige Marusja nicht ernst-lich abgereist, sondern nur etwas verreist war und in fünf klein-sten Teileinheiten hiesiger Zeit wieder eintreffen würde? Ach, das war wohl alles auf einmal der Fall, alles in gleichem Maße; Hans Castorp konnte es sich denken, auch ohne je mit Joachim über die Sache zu sprechen. Denn dessen enthielt er sich ebenso streng, wie Joachim es vermied, den Namen einer anderen etwas Verreisten zu nennen.
Unterdessen aber, an Settembrinis Tisch, an des Italieners Platz, – wer saß dort seit kurzem, in Gesellschaft holländischer Gäste, deren Appetit so ungeheuer war, daß jeder von ihnen sich zu Anfang des täglichen Fünf-Gänge-Diners, noch vor der Suppe, drei Spiegeleier servieren ließ? Es war Anton Karlo-witsch Ferge, er, der das höllische Abenteuer des Pleurachoks erprobt hatte! Ja, Herr Ferge war außer Bett; auch ohne Pneumothorax hatte sein Zustand sich so gebessert, daß er den größ-ten Teil des Tages mobil und angekleidet verbrachte und mit seinem gutmütig-bauschigen Schnurrbart und seinem ebenfalls gutmütig wirkenden großen Kehlkopf an den Mahlzeiten teil-nahm. Die Vettern plauderten manchmal mit ihm in Saal und Halle, und auch für die Dienstpromenaden taten sie sich dann und wann, wenn es sich eben so traf, mit ihm zusammen, Nei-gung im Herzen für den schlichten Dulder, der von hohen Din-gen gar nichts zu verstehen erklärte und, dies vorausgesandt, überaus behaglich von Gummischuhfabrikation und fernen Ge-bieten des russischen Reiches, Samara, Georgien, erzählte, wäh-rend sie im Nebel durch den Schneewasserbrei stapften.
Denn die Wege waren wirklich kaum gangbar jetzt, sie be-fanden sich in voller Auflösung, und die Nebel brauten. Der Hofrat sagte zwar, es seien keine Nebel, es seien Wolken; aber das war Wortfuchserei nach Hans Castorps Urteil. Der Frühling focht einen schweren Kampf, der sich, unter hundert Rückfällen ins Bitter-Winterliche, durch Monate, bis in den Juni hinein, erstreckte. Schon im März, wenn die Sonne schien, war es auf dem Balkon und im Liegestuhl, trotz leichtester Kleidung und Sonnenschirm vor Hitze kaum auszuhalten gewesen, und es gab Damen, die schon damals Sommer gemacht und bereits beim ersten Frühstück Musselinkleider vorgeführt hatten. Sie waren in einem Grade entschuldigt durch die Eigenart des Klimas hier oben, das Verwirrung begünstigte, indem es die Jahreszeiten meteorologisch durcheinander warf; aber es war auch bei ihrem Vorwitz viel Kurzsicht und Phantasielosigkeit im Spiel, jene Dummheit von Augenblickswesen, die nicht zu denken vermag, daß es noch wieder anders kommen kann, sowie vor allem Gier nach Abwechslung und zeitverschlingende Ungeduld: man schrieb März, das war Frühling, das war so gut wie Sommer, und man zog die Musselinkleider hervor, um sich darin zu zei-gen, ehe der Herbst einfiel. Und das tat er, gewissermaßen. Im April fielen trübe, naßkalte Tage ein, deren Dauerregen in Schnee, in wirbelnden Neuschnee überging. Die Finger erstarr-ten in der Loggia, die beiden Kamelhaardecken traten ihren Dienst wieder an, es fehlte nicht viel, daß man zum Pelzsack gegriffen hätte, die Verwaltung entschloß sich, zu heizen, und je-dermann klagte, man werde um seinen Frühling betrogen. Alles war dick verschneit gegen Ende des Monats; aber dann kam Föhn auf, vorausgesagt, vorausgewittert von erfahrenen und empfindlichen Gästen: Frau Stöhr sowohl, wie die elfenbeinfarbene Lewi, wie nicht minder die Witwe Hessenfeld spürten ihn einstimmig schon, bevor noch das kleinste Wölkchen über dem Gipfel des Granitbergs im Süden sich zeigte. Frau Hessenfeld neigte alsbald zu Weinkrämpfen, die Lewi wurde bettlägrig, und Frau Stöhr, die Hasenzähne störrisch entblößt, bekundete stündlich die abergläubische Befürchtung, ein Blutsturz möchte sie ereilen; denn die Rede ging, daß Föhnwind dergleichen be-fördere und bewirke. Unglaubliche Wärme herrschte, die Hei-zung erlosch, man ließ über Nacht die Balkontür offen und hatte trotzdem morgens elf Grad im Zimmer; der Schnee schmolz gewaltig, er wurde eisfarben, porös und löcherig, sackte zusammen, wo er zu Hauf lag, schien sich in die Erde zu verkriechen. Ein Sickern, Sintern und Rieseln war überall, ein Tropfen und Stürzen im Walde, und die geschaufelten Schranken an den Straßen, die bleichen Teppiche der Wiesen verschwanden, wenn auch die Massen allzu reichlich gelegen hatten, um rasch zu ver-schwinden. Da gab es wundersame Erscheinungen, Frühlings-überraschungen auf Dienstwegen im Tal, märchenhaft, nie gese-hen. Ein Wiesengebreite lag da, – im Hintergrunde ragte der Schwarzhornkegel, noch ganz im Schnee, mit dem ebenfalls noch tief verschneiten Scalettagletscher rechts in der Nähe, und auch das Gelände mit seinem Heuschober irgendwo lag noch im Schnee, wenn auch die Decke schon dünn und schütter war, von rauhen und dunklen Bodenerhebungen da und dort unter-brochen, von trockenem Grase überall durchstochen. Das war jedoch, wie die Wanderer fanden, eine unregelmäßige Art von Verschneitheit, die diese Wiese da aufwies, – in der Ferne, ge-gen die waldigen Lehnen hin, war sie dichter, im Vordergrund aber, vor den Augen der Prüfenden, war das noch winterlich dürre und mißfarbene Gras mit Schnee nur noch gesprenkelt, betupft, beblümt … Sie sahen es näher an, sie beugten sich staunend darüber, – das war kein Schnee, es waren Blumen, Schneeblumen, Blumenschnee, kurzstielige kleine Kelche, weiß und weißbläulich, es war Krokus, bei ihrer Ehre, millionenweise dem sickernden Wiesengrunde entsprossen, so dicht, daß man ihn gut und gern hatte für Schnee halten können, in den er wei-terhin denn auch ununterscheidbar überging.
Sie lachten über ihren Irrtum, lachten vor Freude über das Wunder vor ihren Augen, diese lieblich zaghafte und nachahmende Anpassung des zuerst sich wieder hervorgetrauenden or-ganischen Lebens. Sie pflückten davon, betrachteten und unter-suchten die zarten Bechergebilde, schmückten ihre Knopflöcher damit, trugen sie heim, stellten sie in die Wassergläser auf ihren Zimmern; denn die unorganische Starre des Tales war lang ge-wesen, – lang, wenn auch kurzweilig.
Aber der Blumenschnee wurde mit wirklichem zugedeckt, und auch den blauen Soldanellen, den gelben und roten Pri-meln erging es so, die ihm folgten. Ja, wie schwer der Frühling es hatte, sich durchzuringen und den hiesigen Winter zu über-wältigen! Zehnmal ward er zurückgeworfen, bevor er Fuß fas-sen konnte hier oben, – bis zum nächsten Einbruch des Winters, mit weißem Gestöber, Eiswind und Heizungsbetrieb. Anfang Mai (denn nun ist es gar schon Mai geworden, während wir von den Schneeblumen erzählten), Anfang Mai war es schlecht-hin eine Qual, in der Loggia nur eine Postkarte ins Flachland zu schreiben, so schmerzten die Finger vor rauher Novembernässe; und die fünfeinhalb Laubbäume der Gegend waren kahl wie die Bäume der Ebene im Januar. Tagelang währte der Regen, eine Woche lang stürzte er nieder, und ohne die versöhnenden Ei-genschaften des hiesigen Liegestuhltyps wäre es überaus hart gewesen, im Wolkenqualm, mit nassem, starrem Gesicht, so viele Ruhestunden im Freien zu verbringen. Insgeheim aber war es ein Frühlingsregen, um den es sich handelte, und mehr und mehr, je länger er dauerte, gab er als solcher sich auch zu erken-nen. Fast aller Schnee schmolz unter ihm weg; es gab kein Weiß mehr, nur hie und da noch ein schmutziges Eisgrau, und nun begannen wahrhaftig die Wiesen zu grünen!
Welch milde Wohltat fürs Auge, das Wiesengrün, nach dem unendlichen Weiß! Und noch ein anderes Grün war da, an Zartheit und lieblicher Weiche das Grün des neuen Grases noch weit übertreffend. Das waren die jungen Nadelbüschel der Lär-chen, – Hans Castorp konnte auf Dienstwegen selten umhin, sie mit der Hand zu liebkosen und sich die Wange damit zu strei-cheln, so unwiderstehlich lieblich waren sie in ihrer Weichheit und Frische. "Man könnte zum Botaniker werden", sagte der junge Mann zu seinem Begleiter, "man könnte wahr und wahrhaftig Lust bekommen zu dieser Wissenschaft vor lauter Spaß an dem Wiedererwachen der Natur nach einem Winter bei uns hier oben! Das ist ja Enzian, Mensch, was du da am Abhange siehst, und dies hier ist eine gewisse Sorte von kleinen gelben Veilchen, mir unbekannt. Aber hier haben wir Ranunkeln, sie sehen unten ja auch nicht anders aus, aus der Familie der Ranunkulazeen, gefüllt, wie mir auffällt, eine besonders reizende Pflanze, zwittrig übrigens, du siehst da eine Menge Staubgefäße und eine Anzahl Fruchtknoten, ein Andrözeum und ein Gynä-zeum, soviel ich behalten habe. Ich glaube bestimmt, ich werde mir einen oder den anderen botanischen Schmöker zulegen, um mich etwas besser zu informieren auf diesem Lebens – und Wissensgebiet. Ja, wie es nun bunt wird auf der Welt!"
"Das kommt noch besser im Juni", sagte Joachim. "Die Wie-senblüte hier ist ja berühmt. Aber ich glaube doch nicht, daß ich sie abwarte. – Das hast du wohl von Krokowski, daß du Botanik studieren willst?"
Krokowski? Wie meinte er das? Ach so, er kam darauf, weil Dr. Krokowski sich neulich botanisch gebärdet hatte bei einer seiner Konferenzen. Denn der ginge freilich fehl, der meinte, die durch die Zeit gezeitigten Veränderungen wären so weit ge-gangen, daß Dr. Krokowski keine Vorträge mehr gehalten hätte! Vierzehntägig hielt er sie, nach wie vor, im Gehrock, wenn auch nicht mehr in Sandalen, die er nur sommers trug und also nun bald wieder tragen würde – jeden zweiten Montag im Speise-saal, wie damals, als Hans Castorp, mit Blut beschmiert, zu spät gekommen war, in seinen ersten Tagen. Drei Vierteljahre lang hatte der Analytiker über Liebe und Krankheit gesprochen, – nie viel auf einmal, in kleinen Portionen, in halb – bis dreiviertel-stündigen Plaudereien, breitete er seine Wissens – und Gedankenschätze aus, und jedermann hatte den Eindruck, daß er nie werde aufzuhören brauchen, daß es immer und ewig so weitergehen könne. Das war eine Art von halbmonatlicher "Tausend-undeine Nacht", sich hinspinnend von Mal zu Mal ins Beliebi-ge und wohlgeeignet, wie die Märchen der Scheherezade, einen neugierigen Fürsten zu befriedigen und von Gewalttaten abzu-halten. In seiner Uferlosigkeit erinnerte Dr. Krokowskis Thema an das Unternehmen, dem Settembrini seine Mitarbeit ge-schenkt, die Enzyklopädie der Leiden, und als wie abwand-lungsfähig es sich erwies, möge man daraus ersehen, daß der Vortragende neulich sogar von Botanik gesprochen hatte, ge-nauer: von Pilzen … Übrigens hatte er den Gegenstand viel-leicht ein wenig gewechselt; es war jetzt eher die Rede von Liebe und Tod, was denn zu mancher Betrachtung teils zart poeti-schen, teils aber unerbittlich wissenschaftlichen Gepräges Anlaß gab. In diesem Zusammenhang also war der Gelehrte in seinem östlich schleppenden Tonfall und mit seinem nur einmal an-schlagenden Zungen-R auf Botanik gekommen, das heißt auf die Pilze, – diese üppigen und phantastischen Schattengeschöpfe des organischen Lebens, fleischlich von Natur, dem Tierreich sehr nahe stehend, – Produkte tierischen Stoffwechsels, Eiweiß, Glykogen, animalische Stärke also, fanden sich in ihrem Auf-bau. Und Dr. Krokowski hatte von einem Pilz gesprochen, der berühmt schon seit dem klassischen Altertum seiner Form und der ihm zugeschriebenen Kräfte wegen, – einer Morchel, in de-ren lateinischem Namen das Beiwort impudicus vorkam, und dessen Gestalt an die Liebe, dessen Geruch jedoch an den Tod erinnerte. Denn das war auffallenderweise Leichengeruch, den der Impudicus verbreitete, wenn von seinem glockenförmigen Hute der grünliche, zähe Schleim abtropfte, der ihn bedeckte, und der Träger der Sporen war. Aber bei Unbelehrten galt der Pilz noch heute als aphrodisisches Mittel.
Na, etwas stark war das ja gewesen für die Damen, hatte Staatsanwalt Paravant gefunden, der, moralisch gestützt durch des Hofrats Propaganda, die Schneeschmelze hier überdauerte. Und auch Frau Stöhr, die ebenfalls charaktervoll standhielt und jeder Versuchung zu wilder Abreise die Stirne bot, hatte bei Tisch geäußert, heute sei Krokowski denn aber doch "obskur" gewesen mit seinem klassischen Pilz. "Obskur", sagte die Unse-lige und schändete ihre Krankheit durch namenlose Bildungs-schnitzer. Worüber aber Hans Castorp sich wunderte, war, daß Joachim auf Dr. Krokowski und seine Botanik anspielte; denn eigentlich war zwischen ihnen von dem Analytiker ebensowe-nig die Rede, wie von der Person Clawdia Chauchats oder der Marusjas, – sie erwähnten ihn nicht, sie übergingen sein Wesen und Wirken lieber mit Stillschweigen. Jetzt aber also hatte Joachim den Assistenten genannt, – in mißlaunigem Tone, wie übrigens auch schon seine Bemerkung, daß er die volle Wiesen-blüte nicht abwarten wolle, recht mißlaunig geklungen hatte. Der gute Joachim, nachgerade schien er im Begriff, sein Gleich-gewicht einzubüßen; seine Stimme schwankte beim Sprechen vor Gereiztheit, er war an Sanftmut und Besonnenheit durchaus nicht mehr der alte. Entbehrte er das Apfelsinenparfüm? Brachte die Fopperei mit der Gaffky-Nummer ihn zur Verzweiflung? Konnte er nicht mit sich selber ins Reine darüber kommen, ob er den Herbst hier erwarten oder falsche Abreise halten sollte?
In Wirklichkeit war es noch etwas anderes, wodurch dies ge-reizte Beben in Joachims Stimme kam und weshalb er des bota-nischen Kollegs von neulich in fast höhnischem Tone erwähnt hatte. Von diesem Etwas wußte Hans Castorp nichts, oder viel-mehr, er wußte nicht, daß Joachim davon wußte, denn er selbst, dieser Durchgänger, dies Sorgenkind des Lebens und der Päd-agogik, er wußte nur zu gut davon. Mit einem Worte, Joachim war seinem Vetter auf gewisse Schliche gekommen, er hatte ihn unversehens bei einer Verräterei belauscht, ähnlich derjenigen, deren er sich am Faschingsdienstag schuldig gemacht, – einer neuen Treulosigkeit, verschärft durch den Umstand, an dem nicht zu zweifeln war, daß Hans Castorp sie dauernd verübte.
Zum ewig eintönigen Rhythmus des Zeitablaufs, zur kurz-weilig feststehenden Gliederung des Normaltages, der immer derselbe, der sich selbst zum Verwechseln und bis zur Verwir-rung ähnlich war, identisch mit sich, die stehende Ewigkeit, so daß schwer zu begreifen war, wie er Veränderung zu zeitigen vermochte, – zur unverbrüchlichen Alltagsordnung also gehörte, wie jedermann sich erinnert, der Rundgang Dr. Krokowskis zwischen halb vier und vier Uhr nachmittags durch alle Zim-mer, das ist über alle Balkons, von Liegestuhl zu Liegestuhl. Wie oft hatte nicht der Berghof-Normaltag sich erneut, seit damals, als Hans Castorp in seiner horizontalen Lebenslage sich geärgert hatte, weil der Assistent einen Bogen um ihn beschrieb und ihn nicht in Betracht zog! Längst war aus dem Gaste von damals ein Kamerad geworden, – Dr. Krokowski redete ihn sogar häufig mit diesem Namen an bei seiner Kontrollvisite, und wenn das militärische Wort, dessen R-Laut er auf exotische Weise durch nur einmaliges Anschlagen der Zunge am vorderen Gaumen hervorbrachte, ihm auch scheußlich zu Gesichte stand, wie Hans Castorp gegen Joachim geurteilt hatte, so paßte es doch nicht schlecht zu seiner stämmigen mannhaft-heiteren und zu fröhli-chem Vertrauen auffordernden Art, die freilich wiederum durch seine Schwarzbleichheit in gewisser Weise Lügen gestraft wur-de, und der denn doch etwas Bedenkliches jederzeit anhaftete.
"Nun, Kamerad, wie gehts, wie stehts!" sagte Dr. Krokowski, indem er, vom russischen Barbarenpaare kommend, an das Kopfende von Hans Castorps Lager trat; und der so frischerweise Angeredete, die Hände auf der Brust gefaltet, lächelte täglich wieder gepeinigt-freundlich über die scheußliche Anrede, indem er des Doktors gelbe Zähne betrachtete, die sich in seinem schwarzen Barte zeigten. "Recht wohl geruht?" fuhr Dr. Krokowski dann wohl fort. "Fallende Kurve? Steigende heut? Nun, hat nichts auf sich, kommt bis zur Hochzeit schon wieder in Ordnung. Ich grüße Sie." Und mit diesem Wort, das ebenfalls scheußlich klang, da er es wie "gdieße" sprach, ging er schon weiter, zu Joachim hinüber – es handelte sich um einen Rundgang, einen kurzen Blick nach dem Rechten und um nichts weiter.
Manchmal freilich auch verweilte Dr. Krokowski sich länger, plauderte, breitschultrig dastehend und immer mannhaft lä-chelnd, mit dem Kameraden über dies und jenes, über die Wit-terung, über Abreisen und Ankünfte, über des Patienten Stim-mung, seine gute oder schlechte Laune, seine persönlichen Ver-hältnisse auch wohl, seine Herkunft und seine Aussichten, bis er "ich gdieße Sie" sagte und weiterging; und Hans Castorp, die Hände zur Abwechslung hinter dem Kopf gefaltet, antwortete ihm, ebenfalls lächelnd, auf all das, – mit dem durchdringenden Gefühle der Scheußlichkeit, gewiß, aber er antwortete ihm. Sie plauderten gedämpft, – obgleich die gläserne Scheidewand die Loggien nicht völlig trennte, konnte Joachim die Unterhaltung nebenan nicht verstehen und machte übrigens auch nicht den leisesten Versuch dazu. Er hörte seinen Vetter sogar vom Liegestuhl aufstehen und mit Dr. Krokowski ins Zimmer gehen, ver-mutlich um ihm seine Fieberkurve zu zeigen; und dort setzte dann das Gespräch sich wohl noch eine längere Weile fort, der Verzögerung nach zu urteilen, womit der Assistent auf dem in-neren Wege bei Joachim eintraf Worüber plauderten die Kameraden? Joachim fragte nicht; aber sollte jemand aus unserer Mitte sich an ihm kein Beispiel nehmen und die Frage aufwerfen, so ist allgemein darauf hinzuweisen, wieviel Stoff und Anlaß zu geistigem Austausch vorhanden ist zwischen Männern und Kameraden, deren Grundanschauungen idealistisches Gepräge tragen, und von denen der eine auf seinem Bildungswege dazu gelangt ist, die Materie als den Sündenfall des Geistes, als eine schlimme Reizwucherung desselben aufzufassen, während der andere, als Arzt, den sekun-dären Charakter organischer Krankheit zu lehren gewohnt ist. Wie manches, meinen wir, ließ sich da nicht erörtern und aus-tauschen über die Materie als unehrbare Ausartung des Immate-riellen, über das Leben als Impudizität der Materie, über die Krankheit als unzüchtige Form des Lebens! Da konnte, unter Anlehnung an laufende Konferenzen, die Rede gehen von der Liebe als krankheitsbildender Macht, vom übersinnlichen We-sen des Merkmals, über "alte" und "frische" Stellen, über lösli-che Gifte und Liebestränke, über die Durchleuchtung des Un-bewußten, den Segen der Seelenzergliederung, die Rückver-wandlung des Symptoms – und was wissen wir, – von deren Seite dies alles nur Vorschläge und Vermutungen sind, wenn die Frage aufgeworfen wird, was Dr. Krokowski und der junge Hans Castorp miteinander zu plaudern hatten!
Übrigens plauderten sie nicht mehr, das lag zurück, nur eine Weile, einige Wochen lang war es so gewesen; in letzter Zeit hielt Dr. Krokowski sich bei diesem Patienten wieder nicht länger auf als bei allen anderen, –"Nun, Kamerad?" und "Ich gdieße Sie", darauf beschränkte sich nun die Visite meistens wieder. Dafür hatte Joachim eine andere Entdeckung gemacht, eben die, die er als Verräterei von Seiten Hans Castorps empfand, und gemacht hatte er sie völlig unwillkürlich, ohne in seiner militäri-schen Arglosigkeit im mindesten auf Späherwegen gegangen zu sein, das darf man glauben. Er war ganz einfach an einem Mitt-woch aus der ersten Liegekur abgerufen worden, hinunterbeor-dert ins Souterrain, um sich vom Bademeister wiegen zu lassen, – und da sah er es also. Er kam die Treppe hinunter, die reinlich linoleumbelegte Treppe mit Aussicht auf die Tür zum Ordinationszimmer, zu dessen beiden Seiten die Durchleuchtungskabinette gelegen waren, links das organische und rechts um die Ek-ke das um eine Stufe vertiefte psychische, mit Dr. Krokowskis Besuchskarte an der Tür. Auf halber Höhe der Treppe aber blieb Joachim stehen, denn eben verließ Hans Castorp, von der In-jektion kommend, das Ordinationszimmer. Mit beiden Händen schloß er die Tür, durch die er rasch getreten war, und wandte sich, ohne um sich zu blicken, nach rechts, gegen die Tür, an der die Karte auf Reißnägeln saß, und die er mit wenigen, lautlos vorwärtswiegenden Schritten erreichte. Er klopfte, neigte sich hin beim Klopfen und hielt das Ohr zu dem pochenden Finger. Und da des Bewohners baritonales "Herein!" mit dem exotisch anschlagenden R-Laut und dem verzerrten Diphthong aus dem Gelasse erschollen war, sah Joachim seinen Vetter im Halbdun-kel von Dr. Krokowskis analytischer Grube verschwinden.