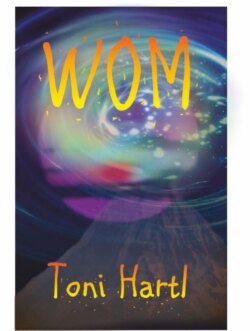Читать книгу WOM - Toni Hartl - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Adlerwunde
ОглавлениеNondol nahm den Grashalm aus dem Mund, auf dem er nun schon viel zu lange herumgekaut hatte. Das rechte Bein über das linke geschlagen lag er im Gras und sah verträumt dem Adlerpärchen zu, das weit über ihm verspielt seine Kreise zog. Wie unbeschreiblich schön müsste es doch sein, so wie diese majestätischen Vögel über die endlosen Wälder, Täler und Berge hinweggleiten zu können – frei von jeglicher Sorge und ohne die geringsten Gedanken an morgen oder daran, was die Zukunft wohl bringen würde.
Die Wälder von oben sehen. Oh ja! Nondol liebte den Wald. Kein Wunder, schließlich hatte er sein ganzes bisheriges Leben im Wald verbracht.
Eine Welt ohne Wald; wie sollte die sein? Das würde gar nicht gehen. Sein Großvater, der schon lange gestorben war, hatte einmal gesagt: „Eine Welt ohne Wald kann nicht leben. Würde es keinen Wald geben, gäbe es auch dich nicht, mein Junge. Deshalb sind wir Belmaner von Walon dafür auserkoren, im Wald zu leben und ihn zu bewahren.“
Was er genau damit gemeint hatte, wusste Nondol zwar nicht, aber sicher hatte sein Großvater recht. Aber ebenso gerne, wie er den Wald mochte, seine Gerüche, die Bäume, die Tiere und alles, was dazu gehörte, genau so gerne hätte er einmal gesehen, was hinter den endlosen Wäldern lag. Wie sah die Welt jenseits der endlosen Wälder aus?
Er stellte sich vor, dass vielleicht wesentlich größere Wiesen und Lichtungen die Baumbestände unterbrechen würden, als es hier in der Gegend von Grondel – seinem Heimatdorf – der Fall war. Und sicherlich gab es größere Orte und womöglich gewaltige Berge, auf denen keine Bäume mehr wuchsen.
Es gab zwar auch rings um Grondel einige kleinere Wiesen und Lichtungen, die man in jahrelanger Rodungsarbeit dem Wald abgerungen hatte. Auch Felder und Äcker wurden von den Belmanern bestellt. Aber im großen und ganzen bestand die Welt seines Volkes nun einmal aus Wald.
Nun ja. Möglicherweise würde er ja eines Tages, wenn er erwachsen war, eine längere Reise unternehmen und sich einmal ansehen, wie es anderswo aussah. Im Moment jedenfalls war er damit zufrieden, auf dieser kleinen Lichtung zu liegen, die im Durchmesser nicht viel größer sein mochte, als er mit einem Stein werfen konnte. Er lag im Gras und genoss die warmen Sonnenstrahlen, die bereits seinen ganzen Körper erwärmt und dafür gesorgt hatten, dass sich auf seiner Stirn und unter seiner leichten Bekleidung ein zarter Schweißfilm gebildet hatte.
Diese Lichtung war seit seiner frühesten Kindheit Nondols absoluter Lieblingsplatz. Wie oft hatte er sich alleine oder zusammen mit seinem Freund hier oben an der Hohen Wand aufgehalten und die atemberaubende Aussicht genossen. Ein Lächeln schlich sich auf sein Gesicht, als ihm die Worte seines rundlichen Kameraden Walgin in den Sinn kamen.
„Wenn ich Ärger hab oder sonst irgendwie nachdenken muss, geh ich meistens zu der Lichtung an der Hohen Wand und komme erst heim, wenn mir was eingefallen ist. Obwohl – manchmal bin ich auch schon heimgekommen, wenn mir nichts eingefallen war. Das war dann meistens, weil ich Hunger hatte.“
Walgin war Nondol´s bester Freund seit den ersten Kindertagen. Eigentlich nicht verwunderlich, denn immerhin waren sie am selben Tag, sogar zur selben Stunde, nur zwei Hütten voneinander entfernt zur Welt gekommen. Ihre beiden Mütter, zwei dicke Freundinnen – wobei man das „dick“ getrost wörtlich nehmen durfte – hatten vom ersten Tag an dafür gesorgt, dass Nondol und Walgin nie länger als zwei Tage getrennt waren.
Nur ein einziges mal, so konnte Nondol sich erinnern, hatte die Trennung länger angedauert.
Das war damals, als Sepon - Walgins Vater - bei der Feldarbeit einen beachtlichen Goldklumpen gefunden hatte. Zum aller ersten Mal hatte Walgin das Dorf verlassen und mit seinem Vater nach Selmthorn reisen dürfen, um mit dem unverhofften Reichtum dort „große Geschäfte“ zu machen.
Ermana, Walgins Mutter, hatte ihrem Mann allerdings kaum zugehört, als er nach sechs Tagen sinnlos betrunken heimgekehrt war und mit stolzgeschwellter Brust erzählte, wie er in Selmthorn den Bürgermeister höchstpersönlich übers Ohr gehauen hatte.
In den darauf folgenden Tagen war Walgin nicht müde geworden, von den Erlebnissen der Reise zu berichten. Als er aber bemerkt hatte, dass Nondol etwas eifersüchtig auf „seine Abenteuer“ reagierte, zwang er sich dazu, nicht mehr so häufig darüber zu sprechen.
Was letztendlich bei dem Handel mit dem Goldklumpen herausgesprungen war, blieb für immer Sepons Geheimnis. Niemand durfte ihn je danach fragen, ohne eine ärgerliche Antwort zu erhalten.
Alles, was man im Dorf mitbekommen hatte, war die Tatsache, dass Sepon den Wagen voller Werkzeug und Einrichtungsgegenstände nach Hause gebracht hatte. Jede Familie in Grondel hatte eine Axt, eine Säge, ein scharfes Messer, sowie einige Töpfe, Pfannen und noch mehrere andere nützliche Utensilien geschenkt bekommen. Die Freude war seinerzeit so groß gewesen, dass bereits am nächsten Tag ein Fest ausgerichtet wurde, bei dem man sowohl Sepons Glück, als auch seine Großzügigkeit gefeiert hatte.
Unvermittelt wurde Nondol aus seinen Gedanken gerissen, als sich eine freche Fliege summend auf seinem linken Augenlid niederließ. Er verjagte das lästige Insekt, setzte sich seufzend auf, schlang die Arme um seine angewinkelten Knie und gähnte einmal herzhaft.
Wie schon so oft genoss er es auch diesmal, in der warmen Jedulsonne (Jedul = Juni) auf der kleinen Lichtung am Rande der Hohen Wand zu sitzen und hinunter zu blicken auf das beeindruckende Tal, das sich am Fuße der Felswand vor ihm erstreckte. Er konnte in diesem Augenblick ja nicht ahnen, wie unfassbar schicksalhaft dieser sonnige, warme Tag für ihn werden sollte.
Hier oben war er ein König. Ja, hier oben fühlte Nondol sich wie ein Herrscher, der von den höchsten Zinnen seines Schlosses auf sein Reich hinab blickte und für gut befand, was er sah.
Nondol hatte zwar noch nie ein Schloss gesehen aber Mingar, sein Großonkel, hatte ihm viele Geschichten erzählt von den gewaltigen Königshäusern, wie er sie nannte, von den Menschen, von Angst einflößenden Ungeheuern, Flugechsen und noch vielen anderen unbekannten aber faszinierenden Dingen.
Insbesondere die Menschen übten auf Nondol eine große Faszination aus. Nach Mingars Beschreibung sahen sie eigentlich genau so aus, wie die Belmaner, nur waren sie wesentlich größer.
Als Mingar sie zum ersten mal beschrieb, neckte er Nondol, indem er sagte: „Ja ja, mein Junge, wenn du ein Menschenmädchen küssen wolltest, müsstest du dich auf Walgins Schultern stellen und Dich an den goldenen Zöpfen des Mädchens festhalten“.
Dann hatte er schallend gelacht und Nondols Gesicht war vor Verlegenheit so rot angelaufen, als hätte er sich mit Mohnblumensaft eingerieben.
Nondol war überzeugt, dass Mingar ziemlich übertrieben hatte, was die Größe der Menschen betraf. Dass sie aber hochgewachsener sein mochten, als ein Belmaner, glaubte er durchaus.
Nondol löste sich aus seinen Tagträumen und erhob sich. Vorsichtig bewegte er sich auf dem weichen Gras nach vorne, bis er nur noch etwa drei Schritte vor der senkrecht abfallenden Felswand stand. Es wäre gefährlich gewesen, noch weiter an den Abgrund heran zu treten. Leicht konnte sich ein Stück des mit Gras bewachsenen Erdreiches lösen, das hier den Felsen bedeckte, und ihn mit in die Tiefe nehmen.
Eine leichte Gänsehaut lief ihm bei diesem Gedanken über den Rücken. Die Hohe Wand war gefährlich. Sie bestand aus glattem Fels, fiel senkrecht ab und war mindestens so hoch, wie 20 große Tannenbäume. Auf halber Höhe der Wand ergoss sich aus dem Felsmassiv heraus ein Wasserfall, der rauschend in die Tiefe stürzte und tief unten, wo er auf dem steinigen Grund auftraf, ein ständiges Tosen erzeugte, das hier oben in dieser Höhe allerdings nur noch gedämpft zu hören war.
An warmen Tagen, so wie heute, bildete sich durch das verdunstende Wasser ein Nebelschleier, der manchmal bis an die Kante reichte, an der Nondol sich jetzt so weit nach vorne gewagt hatte. Gelegentlich, wenn die Sonne in der richtigen Position stand, geschah es, dass sich darin ein Regenbogen bildete, der sich beinahe zu einem perfekten Kreis schloss. Mehrmals schon hatte er dies zusammen mit Walgin beobachtet.
Nondol war überzeugt, dass dies der einzige Ort war, von dem aus man einen ringförmigen Regenbogen von oben betrachten konnte und es erfüllte ihn mit Stolz, weil dies „sein Platz“ war. Nun ja – seiner und Walgins Platz.
Lange schaute er gedankenverloren hinunter. Auch wenn er diesen Anblick schon so oft genossen hatte; er würde sich wohl nie daran satt sehen können. Der Fluss namens Jemboch, der – geboren durch den Wasserfall – dort unten seinen Lauf nahm, schlängelte sich glitzernd durch ein tiefes Tal, das beiderseits durch steile, bewaldete Hänge gesäumt wurde. Begünstigt durch die hohe Position, in der Nondol sich hier befand, konnte er ein gutes Stück des Flusslaufes einsehen, bis sich das Tal weit im Westen in einer Rechtsbiegung dem Blick entzog.
Ein lautes Kreischen lenkte seinen Blick nach oben. Die beiden Adler hatten sich inzwischen aus den höheren Luftregionen weiter nach unten geschraubt und schienen etwas aufgeregt. Nondol vermutete, dass sich irgendwo unter ihm in einer Felsnische der Horst befand. Womöglich saßen ein oder zwei Junge darin, die – geplagt von Hunger - bereits ungeduldig auf die Rückkehr ihrer Eltern warteten. Und die beiden Adler wagten es nicht, das Nest anzufliegen, weil ein neugieriger Belmaner sich hier herumtrieb. Sie konnten ja nicht wissen, dass er nichts Böses im Schilde führte. Im Gegenteil; er war froh, wenn die großen Vögel ihn in Ruhe ließen. Nach Mingars Erzählungen war es in der Vergangenheit mehr als einmal geschehen, dass kleine Belmanerkinder von Adlern verschleppt wurden. In den meisten dieser Fälle hatten sich die Kleinkinder, alle im Alter von zwei oder drei Jahren, mit ihren Eltern bei der Feldarbeit befunden.
Nondol konnte sich durchaus vorstellen, dass ein Adler so ein kleines Geschöpf, vor allem, wenn es auf allen Vieren auf der Wiese herumkrabbelte, für Beute hielt und es mitnahm, um seine Jungen damit zu füttern. Eine schreckliche Vorstellung zwar, aber Nondol lag es fern, die Adler deshalb als böse oder grausam zu bezeichnen. Er glaubte zwar nicht, dass er gefährdet sein könnte, denn er zählte immerhin schon 15 Jahre und war für sein Alter sogar ziemlich groß und kräftig. Trotzdem konnte es nicht schaden, diesen riesigen Vögeln mit Respekt zu begegnen.
Wenn da unten im Horst wirklich junge Adler saßen, konnte es durchaus sein, dass die Elterntiere in ihm eine Bedrohung sahen und sich veranlasst fühlten, ihren Nachwuchs zu verteidigen. Soeben wollte er sich deshalb etwas weiter vom Rand des Abgrundes zurückziehen, als er gerade noch bemerkte, wie der größere der beiden Vögel – vermutlich der Adlervater – die Flügel etwas anwinkelte und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit schräg von oben direkt auf ihn zustürzte.
Nondol ging zwar nicht davon aus, dass der Greif vorhatte, ihn zu töten. Trotzdem wollte ihn der Schrecken beinahe lähmen, als er bemerkte, mit welcher Geschwindigkeit der Vogel sich ihm näherte. Rasch drehte er sich deshalb um und lief, so schnell es ihm seine Beine erlaubten, über die Lichtung auf den Waldrand zu. Ich muss rechtzeitig die Bäume erreichen, war sein einziger Gedanke.
„Merk dir eines“ hatte Mingar einst gesagt „ein Adler verfolgt seine Beute niemals ins dichte Unterholz, weil er sich dort die Flügel brechen könnte.“ Hoffentlich hatte er recht!
Nondol glaubte, noch nie im Leben so schnell gelaufen zu sein. Bereits nach wenigen Schritten trat ihm der Schweiß auf die Stirn. Mit einem Mal befiel ihn eine panische Angst und er versuchte, seine Laufgeschwindigkeit noch einmal zu erhöhen.
Nur noch 30 Schritte!
Nondol lief, als wäre ein Rudel hungriger Wölfe hinter ihm her.
Nur noch 20 Schritte.
Ein lautes Kreischen drang von hinten an seine Ohren!
Schon glaubte er das leise Rauschen zu vernehmen, das entstand, wenn die Adlerflügel pfeilschnell die Luft durchschnitten. Instinktiv ließ er sich mitten im Lauf bäuchlings auf den Boden fallen und spürte im selben Moment einen brennenden Schmerz auf dem Rücken.
„Neiiin!“ kam es panisch und gequält über seine Lippen. Aber dann war es auch schon vorbei. Ein klopfendes Geräusch erklang, während ein dunkler Schatten über ihn hinweg fegte und sofort wieder verschwunden war. Keuchend sprang Nondol auf und setzte stolpernd seine Flucht in Richtung der rettenden Bäume fort. Er hatte Angst, dass der Adlervater jeden Moment zurückkehren könnte. Nur das nicht! Darauf konnte er gerne verzichten.
Endlich! Nach einer halben Ewigkeit, wie ihm schien, erreichte er den rettenden Waldrand und stolperte zwischen den mächtigen Bäumen hindurch weiter in das Halbdunkel des dichten Unterholzes. Als er sicher war, so weit vorgedrungen zu sein, dass die Adler ihm nicht mehr folgen würden, ließ er sich im Schutze mehrerer kleiner Buchen zu Boden sinken, legte sich flach auf den Rücken, streckte erschöpft alle Viere von sich und wartete ab, bis sich sein heftiger Atem und das Rauschen des Blutes in seinen Ohren wieder beruhigt hatten.
Eine ganze Weile lag er ausgestreckt und mit geschlossenen Augen im Laub. Ein Wanderer, der zufällig vorbeigekommen wäre, hätte ihn wohl im ersten Augenblick für tot gehalten, wäre da nicht der heftig bebende Brustkorb gewesen.
Nondol nutzte die Ruhepause um sich zu sammeln und seine Gedanken wieder in klare Bahnen zu lenken. Nach reiflicher Überlegung kam er zu dem Schluss, dass der Adlerangriff auch eine positive Seite hatte. Gleich würde er nach Hause gehen und seinem Freund Walgin eine phantastische Geschichte erzählen; eine Geschichte vom mutigen, siegreichen Kampf eines jungen Belmaners mit einem mächtigen Adler. Natürlich war es erforderlich, das Geschehene etwas auszuschmücken. Aber darin sah er kein Problem. Er erfreute sich an dem Gedanken, ein kleines Abenteuer parat zu haben, das er seinem Freund Walgin unter die Nase reiben konnte - womöglich sogar mehrmals.
Das Knacken eines trockenen Zweiges ließ Nondol hochfahren. Als er in die Richtung blickte, aus der er das verdächtige Geräusch vernommen hatte, legte sich ein Ausdruck auf sein Gesicht, der zugleich Freude und Enttäuschung widerspiegelte.
„Walgin? Wo kommst du denn plötzlich her?“
Als ob dieser die Frage gar nicht gehört hätte, kam er rasch näher und blieb vor Nondol stehen. Auch er atmete heftig und die Färbung seines schweißnassen Gesichtes kam der einer reifen Tomate nahe. Schnaufend brachte er hervor: „Mein lieber Hahnenschweif, das war ja knapp, was? Wenn ich nicht den Stock nach dem Mistvieh geworfen hätte, wer weiß, was dann mit Dir passiert wäre!“
„Was? Du hast meinen Kampf mit dem Adler mitbekommen?“ Nondols Überraschung war echt.
„Was heißt hier Kampf“, erwiderte Walgin. „Wenn du das Kampf nennst, wie sieht denn dann bei dir eine panische Flucht aus?“
„Ja ja, ist ja schon gut. Du hast es also tatsächlich gesehen!“ Nondol konnte einen leichten Ärger nicht verbergen. Einerseits war er recht froh, Walgin in diesem Moment in der Nähe zu wissen, andererseits konnte er sein Vorhaben mit der ausgeschmückten Geschichte nun vergessen. Und überhaupt; was sollte die Sache mit dem Stock bedeuten?
Noch ehe er danach fragen konnte, fuhr Walgin nicht ohne Stolz fort: „Was heißt hier gesehen!“ Ich hab dich gerettet, das kannst du mir glauben. Sag bloß, du hast gar nicht mitgekriegt, dass ich das Federvieh mit einem hammerharten Treffer verjagt habe? Direkt an seiner hässlichen Schnabelspitze hab ich ihn getroffen, den Mistkerl!“
Auch das noch! Walgin führte sich schon wieder als Held auf - und auch noch mit Recht, wie Nondol sich widerwillig eingestand. „Ach ja, jetzt erinnere ich mich“ presste Nondol hervor. „Da war so ein komisches Klacken, als ich am Boden lag und der Adler über mir war. Dann war das also, als du ihn mit dem Stock getroffen hast.“
„Natürlich, was hast du denn gedacht. Heilige Schneckensuppe, der hat vielleicht dumm aus den Federn geguckt. Das hättest du sehen sollen.“ Walgin war drauf und dran, sich in einen Redeschwall zu versteigen, den Nondol im Moment wirklich nicht vertragen konnte. Und obwohl es ihm nicht leichtfiel, sagte er: „Du bist wirklich im richtigen Augenblick gekommen, Walgin. Danke.“ Dann fügte er mit einem Ächzen hinzu: „Könntest du mir mal aufhelfen?“
Walgin verspürte eine leichte Verlegenheit, als Nondol sich bei ihm bedankte. Rasch trat er an seinen Freund heran, der sich inzwischen aufgesetzt hatte und ihm seine rechte Hand entgegenstreckte. Er ergriff sie und zog ihn hoch, während seine Linke zur Unterstützung Nondols Oberarm umfasste. Beide standen sich einen Augenblick gegenüber und die Situation wollte es, dass sie sich gegenseitig in ihre verschwitzten und geröteten Gesichter blickten, wobei Nondol seine Augen etwas nach unten richten musste, da er Walgin um etwa einen halben Kopf überragte.
Und dann begann Nondol plötzlich zu grinsen. Der Grund dafür lag in Walgins Gesicht. Es wirkte in diesem Moment einfach zu komisch. Seine Haare, die mehr an ein struppiges Wolfsfell erinnerten, hatten sich in ein scheinbar unbezähmbares Wirrwarr verwandelt. Das sonst übliche Hellrot der beiden Pausbacken hatte nun die Färbung einer überreifen Kirsche angenommen und von seiner kleinen, runden Nase verabschiedete sich soeben ein Schweißtropfen um gleich darauf im weichen Waldboden zu versickern.
Und dann, wie auf einen geheimen Befehl hin, fingen sie plötzlich beide an, so herzhaft und überschwänglich zu lachen, dass es einem uneingeweihten Beobachter vorkommen musste, als hätten sie den Verstand verloren. Sie lachten immer noch, als sie – Nondol vorausgehend - bereits ein Stück in Richtung der Hohen Wand zurückgelegt hatten. Doch eine Weile später bemerkte Nondol, dass Walgins Lachen schlagartig abbrach. Immer noch lachend wandte er sich ihm zu, um den Grund für den plötzlichen Stimmungswechsel zu erfahren.
Walgin war stehen geblieben und als Nondol ihn ansah, bemerkte er, dass dessen rötliche Gesichtsfarbe sich zunehmend in das Weiß einer Birkenrinde verwandelte. „He, was ist denn mit dir plötzlich los?“ fragte Nondol und auch ihm stand von einer Sekunde auf die andere der Sinn nicht mehr nach Lachen.
Walgin stand wie versteinert und mit großen Augen, deutete mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf ihn, schluckte noch einige Male und stotterte dann los: „Du … dein...das Hemd … am Rücken … es ist ja total zerrissen … und äh … und … du blutest.“
Wie von selbst griff Nondols linke Hand hinter sich um das weiche Leder seines Hemdes abzutasten und er fühlte tatsächlich einen beachtlichen Riss. Das Rückenteil des eigentlich recht strapazierfähigen Kleidungsstückes war vom unteren Saum bis beinahe hoch zum Kragen aufgeschlitzt. Und noch etwas spürte er. Eine warme, leicht klebrige Flüssigkeit, die sich nicht nur über seinen gesamten Rücken ausbreitete, sondern bereits innerhalb der Hose seinen Hintern und die Oberschenkel hinunter lief. Obwohl er keinerlei Schmerz verspürte, wusste er, dass es Blut war, noch bevor er die rot gefärbte Hand mit gespreizten Fingern nach vorne führte und dann den Blick wieder zu Walgin wandte.
Nondol war beileibe kein Weichling. Im Wald aufgewachsen, hatte er zwangsläufig schon zahlreiche kleinere und größere Verletzungen überstanden und seinen jungen Körper schmückten bereits mehrere Narben. In diesem Moment drohte allerdings eine leichte Panik von ihm Besitz zu ergreifen. Er fühlte förmlich, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich, während Walgin besorgt näher trat.
Doch dann erkannte er mit einem Mal die Chance, Walgin seine Härte und Unerschrockenheit demonstrieren zu können. Wie lange hatte er auf so eine Gelegenheit gewartet. Nun war sie gekommen und er ergriff sie, ohne noch länger zu zögern, beim Schopf.
Betont emotionslos und so beiläufig, als spräche er über das schöne Wetter, hörte er sich sagen: „Ah, ich wusste ja, dass er mich erwischt hat, aber es scheint doch ein etwas tieferer Kratzer zu sein, als ich anfangs dachte. Naja, das wird schon wieder. Jetzt lass uns erst mal nach Hause gehen. Ich glaube, es könnte nicht schaden, wenn meine Mutter die Wunde etwas säubert.“
„Einen Moment noch“, sagte Walgin, als Nondol sich wieder umdrehte, um seinen Weg fortzusetzen. „Lass mich mal sehen.“ Dann ergriff er die beiden auseinanderklaffenden Teile des arg lädierten, leichten Lederhemdes, zog sie vorsichtig mit Daumen und Zeigefingern etwas weiter auseinander und betrachtete die Verletzung eingehender, als es zuvor möglich gewesen war.
Und ohne den Blick von Nondols Rücken zu wenden, sprach er leise und mehr zu sich selbst: „Jaah, da … da ... hast du völlig recht. Es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen und sich jemand darum kümmert.“ Und in Gedanken fügte er hinzu: „Nur gut, dass du es selber nicht sehen kannst, sonst hätte es dich wahrscheinlich schon umgehauen.“
Insgeheim aber bewunderte er Nondol. Er selbst, so gestand er sich ein, hätte bei einer derartigen Verletzung sicher anders reagiert. Vermutlich hätte er in derselben Situation angefangen zu heulen und wäre kopflos nach Hause gelaufen. Doch Nondol war anders. Das war ihm immer schon bewusst gewesen. Er war Nondol von Kindheit an mit einer gewissen Achtung begegnet, ohne ihm dies je direkt zu zeigen oder gar zu sagen.
Stets war es Nondol gewesen, der sich auf die höchsten Bäume oder Felsen wagte. Nondol konnte schneller schwimmen und länger tauchen als er und er sprang auch von höheren Felsen hinunter ins Wasser. Vergangenen Winter hatte er sogar, nur mit einem Stock bewaffnet, zwei hungrige Wölfe aus dem Dorf vertrieben, die dort versucht hatten, eine Ziege zu reißen.
Gerade als sie zur Lichtung an der Hohen Wand zurückkehrten, wurde Walgin plötzlich aus seinen Gedanken gerissen, als Nondol jäh mit einem Bein einknickte und zu stürzen drohte. Schnell griff Walgin ihm unter die Arme und half ihm wieder hoch.
Erst jetzt fiel ihm Nondols aschfahles Gesicht auf. Die ganze Zeit war er neben seinem Freund hergegangen und hatte gar nicht bemerkt, dass sich dessen Zustand zunehmend verschlimmert hatte. Nondols graues Gesicht war jetzt mit Schweiß überströmt und sein Atem ging schnell und rau.
„Komm , Nondol, ich helfe dir“ keuchte er ihm ins Ohr. „Dort hinter dem Strauch hab ich Loska angebunden. Ich helfe dir in den Sattel, dann musst du nicht mehr laufen. Wir schaffen das schon.“
Gemeinsam schleppten sie sich noch die wenigen Schritte bis zu dem erwähnten Strauch. Und tatsächlich, hinter dem Gebüsch wartete Loska. Das kräftige Reh, einen leichten Sattel auf dem Rücken, kaute soeben an einigen Blättern, die es sich von dem Strauch abgezupft hatte und blickte den beiden schnaufenden Gestalten mit treuen, braunen Augen entgegen.
Walgin half Nondol mit dem linken Bein in den Steigbügel, dann hievte er ihn auf Loskas Rücken und legte ihn mit dem Oberkörper nach vorne, so dass er mit beiden Armen den Hals des Tieres umfassen konnte. Entsetzt stellte er fest, dass das Blut bereits aus Nondols linkem Hemdsärmel lief und von den Fingern seiner Hand tropfte. Er musste sich beeilen, wollte er nicht riskieren, dass Nondol an seiner Verletzung verblutete!
Hastig löste er die Zügel von den Zweigen und führte Loska im Laufschritt auf dem schmalen Waldweg in Richtung Grondel, wobei er immer wieder einen Blick zur Seite warf, um sich zu vergewissern, dass sein verletzter Freund nicht vom Rücken des Tieres kippte.
Anfangs beschrieb der Weg eine leichte aber stetige Steigung und Walgin, der nun nicht gerade zu den ausdauerndsten Läufern zählte, kam gehörig ins Schwitzen und rang heftig nach Atem. Als sie endlich die Anhöhe erreichten, von wo aus der Weg bis kurz vor das Dorf ständig bergab führen würde, hielt er an, um zu verschnaufen und einen Blick nach seinem Kameraden zu werfen.
Es sah nicht gut aus. Walgin stellte fest, dass Nondols Gesicht sich nicht mehr von dem eines Toten unterschied und Entsetzten stieg in ihm hoch, weil er für einen Augenblick dachte, sein Freund wäre bereits gestorben. Dicke Tränen füllten seine Augen. Er legte seine Hand auf Nondols blutverschmierte Schulter und flehte verzweifelt: „He Nondol ... was ist denn? Komm schon … wach auf .. .bewege dich … sag doch was!“
Mit unendlicher Erleichterung vernahm er ein Leises Stöhnen. „Wir schaffen das schon“ fuhr er fort. „Du musst noch ein wenig durchhalten. Gleich sind wir zu Hause ... Bitte ... nimm dich zusammen.“
Und ganz leise, kaum hörbar, vernahm er Nondols trockene, heisere Stimme:
„Jaaaa... dann steh hier nicht herum ... bring mich heim.“
„Ja, das tu ich, Nondol, das tu ich, verlass dich drauf.“ Schon zog er heftig an Loskas Zügel und lief, das Reittier mit dem halbtoten Freund auf dem Rücken hinter sich herziehend, weiter Richtung Grondel. Aber so sehr er sich auch anstrengte, es ging viel, viel zu langsam für seine Begriffe und es war doch noch so weit bis zum rettenden Dorf.
Dann, nach einigen endlosen Minuten, schoss ihm eine verzweifelte Idee durch den Kopf. Das Reh könnte eigentlich viel schneller laufen! Er war es, der zu langsam lief; er würde das Tier nur aufhalten, sollte er es weiterhin am Zügel führen!
„Ja, so mach ich´s“ hörte er sich selbst sagen. Augenblicklich brachte er Loska zum Stehen, nestelte mit zitternden Fingern an seiner Hose und löste das Lederband, das ihm als Gürtel diente und zu diesem Zweck mehrmals um seine Körpermitte geschlungen war.
Dann trat er an Nondol heran und entfernte auch dessen Lederband aus der Hose. Mit nervösen aber geschickten Fingern ging er nun daran, die beiden Lederriemen zusammen zu knüpfen, so dass er bald eine Befestigungsschnur von ausreichender Länge in Händen hielt. Diese schlang er nun unter Nondols Achselhöhlen mehrfach um dessen Körper und anschließend auf raffinierte Weise um Hals und Brust des Reittieres. „Tut mir leid, gute Freundin“, sprach er in einem beruhigenden Ton mit dem treuen Tier, „das ist sicher unangenehm für dich, aber es geht nicht anders.“
Gleich darauf gab er Loska einen Klaps auf das Hinterteil und rief dem davon stiebenden Reh hinterher: „Und jetzt lauf.... lauf und bring Nondol zu seiner Mutter!“
Er wusste, dass auf das Reitreh Verlass war; es würde auf dem schnellsten Weg nach Hause laufen, da konnte er vollkommen sicher sein. Aber ob er sich auch im gleichen Maße auf die Verschnürung verlassen konnte, die er Nondol angelegt hatte? Er hoffte es inständig und betete, dass Nondol rechtzeitig Grondel erreichen würde.
Eine Weile blieb er unbeweglich am Wegrand stehen und blickte gedankenschwer noch hinter Loska mit ihrer blutenden Last her, selbst als er sie schon längst nicht mehr sehen konnte. Als schlimme Gedanken erneut einen wabernden Wasserfilm vor seinen Augen entstehen ließen, wischte er sich den Blick frei und setzte sich raschen Schrittes in Bewegung. Es kam zwar jetzt nicht mehr auf jede Sekunde an. Trotzdem drängte es ihn, nach Hause zu kommen und sich über Nondols Zustand Gewissheit zu verschaffen. Nebenbei fragte er sich, weshalb Nondol eigentlich zu Fuß und ohne sein Reh zur Hohen Wand gegangen war. Warum nur hatte er die treue Jendali daheim gelassen?
„Oh Walon, bitte hilf ihm, dass er es schafft“ ging es ihm durch den Kopf, während er, mit einer Hand die rutschende Hose festhaltend, lief und lief und sich zwischendurch immer wieder über die Augen wischte, wenn der Tränenvorhang ihm den Blick zu verschleiern begann.
Wie konnte dieser Tag nur so einen Ausgang nehmen? Er hatte doch begonnen, wie so viele andere auch. Morgens war er, wie üblich, zeitig aufgestanden und hatte die Tiere im Stall gefüttert, danach ausgemistet und die Ziegen gemolken. Später war er gemeinsam mit Nondol und noch zwei anderen gleichaltrigen Jungen zu Mingars Hütte gegangen und sie hatten sich eine jener aufregenden Geschichten angehört, die dieser auf seinen jahrelangen Reisen – angeblich - erlebt hatte.
Walgin erinnerte sich, dass er nach dem Mittagsmahl wieder Nondols Eltern aufgesucht hatte und dort erfuhr, dass sein Freund - wohl um Kräuter für Mingar zu besorgen – kurz zuvor zur Feuchtwiese aufgebrochen war. Dort hatte er aber vergeblich nach ihm gesucht und dann war ihm in den Sinn gekommen, dass Nondol sich vielleicht bei der Hohen Wand aufhalten könnte.
Deshalb hatte er Loska gesattelt und sich dorthin auf den Weg gemacht. Tatsächlich hatte er ihn bald darauf vor dem Abgrund stehend entdeckt und wollte sich soeben anpirschen, um ihn zu erschrecken, als der gemeine Angriff „dieses elenden Federbalgs“ erfolgte.
Was weiter geschehen war, hätte er am liebsten aus seinen Gedanken verbannt, doch es wollte ihm einfach nicht gelingen. Das zerrissene und blutgetränkte Hemd, die schreckliche Rückenwunde, das fahle Gesicht und sogar Nondols röchelnder Atem ließen sich einfach nicht aus seinen Kopf vertreiben. Immer wieder sah er all diese schrecklichen Dinge vor sich und es nutzte auch nichts, ganz fest und wütend die Augen zu schließen.
Und dann, endlich, lichtete sich der Wald und vor ihm erstreckte sich die langgezogene, sonnenüberflutete Dorfwiese. Er überquerte sie auf dem kürzesten Weg, lief vorbei an den Holzgattern, in denen die Ziegen grasten und konnte, Walon sei gepriesen, schon von weitem Loska erkennen. Sie trottete gelangweilt und mit zu Boden hängenden Zügeln über den sauber gefegten Platz in der Mitte des Dorfes und blickte freudig hoch, als sie seiner ansichtig wurde. Er konnte sich aber jetzt unmöglich mit ihr beschäftigen, sondern lenkte seine Schritte stracks auf Nondols Elternhütte zu.
Offenbar hatte man im Inneren sein Kommen bemerkt, denn Nondols Mutter, die füllige Nawina erschien aufgelöst in der Eingangstüre und eilte sofort auf ihn zu. „Oh Walgin, da bist du ja endlich! Was ist denn nur geschehen? Oh ihr Unglückseligen, was habt wieder angestellt? Wie konnte Nondol sich so schlimm verletzen? Was habt ihr nur getrieben? War es ein Tier?“
Walgin, noch völlig außer Atem, konnte sich nicht entscheiden, welche Frage er zuerst beantworten sollte. Zu allem Überfluss eilten nun auch noch seine Eltern und einige andere Dorfbewohner herbei, um ihn zu umringen und neugierig und lautstark mit Fragen zu bedrängen.
Obwohl er eigentlich selbst gerne erfahren hätte, wie es seinem verletzten Freund ging, blieb ihm schier nichts anderes übrig, als mit tränenunterdrückter Stimme zu antworten: „Ich kann nichts dafür... er auch nicht (damit meinte er Nondol).., es war der Adler, dieses Elendsvieh... er hat ihn angegriffen... Nondol hatte ihm gar nichts getan... er hat ihn einfach angegriffen... den Rücken hat er ihm aufgekratzt oben an der Hohen Wand, dieser Mistvogel... dann hab ich Nondol zu Loska geschleppt und ihn darauf angebunden, damit er schneller zu Hause ist... er hat doch so furchtbar geblutet ... und ich konnte nicht so schnell laufen... ja... und jetzt bin ich auch da. Und jetzt... bitte... sagt mir, wie es Nondol geht. Er wird doch wieder gesund, oder?“
Nawina, die Walgin ungeduldig an beiden Schultern gepackt hatte, um die Antworten schneller aus ihm herauszuschütteln, fasste sich wieder und antwortete überraschend ruhig und mit sehr mütterlicher Stimme: „Ja ja, er wird schon wieder, er wird schon wieder, Walgin. Mingar kümmert sich um ihn. Ach so war das! Ein Adler hat ihn angegriffen! Das muss ich Emnor erzählen!“
Schon wandte sie sich wieder um und strebte eilig auf die Eingangstüre ihres Blockhauses zu. Doch dann hielt sie mitten im Schritt inne, wendete und eilte mit ausgebreiteten Armen abermals auf Walgin zu, um ihn kräftig an ihre üppige Brust zu drücken. „Oh Walgin!“ rief sie mit hochdramatischer und von Schluchzen begleiteter Stimme. „Oh Walgin, du guter Junge! Das hast du wirklich gut gemacht! Was für ein guter Freund du doch bist! Oh ich danke dir tausendmal! Oh du Segensreicher; Walon soll dir ewiges Leben schenken, mein guter Junge!“
Und noch ehe Walgin recht begriff, wie ihm geschah, packte ihn die vor Dank ergriffene Nawina erneut an den Schultern und küsste ihn auf die Stirn, immer und immer wieder.
Obwohl Walgin angesichts der zahlreichen Zuschauer die Verlegenheitsröte ins Gesicht stieg und er sich in diesem Moment nichts sehnlicher wünschte, als dass dieses Küssen bald ein Ende nehmen möge, wehrte er sich nicht dagegen. Geduldig ließ er es geschehen, weil er Nondols Mutter gut genug kannte, um zu wissen, dass ihr Herz in diesem Augenblick von ehrlicher Dankbarkeit erfüllt war und er sie auf keinen Fall kränken wollte, indem er sich in irgend einer Weise wehrte.
Schließlich war es seine Mutter, die ihn aus dieser heiklen Situation befreite, indem sie herantrat, ihm den Arm um die Schulter legte und ihn sanft aus Nawinas „Gewalt“ befreite.
„Komm Junge“ sagte sie leise und in einem mehr als mütterlichen Ton „jetzt gehen wir erst einmal nach Hause. Dann kannst du dich waschen und hinterher erzählst du uns alles ganz von vorne und der Reihe nach. Jetzt komm.“ Mit den letzten Worten führte sie Walgin bereits mitten durch die herumstehende Dorfgemeinschaft auf die heimatliche Hütte zu.
„Aber, Mutter, ich wollte noch ..“.
„Später“ unterbrach sie ihn „später kannst du dann nach Nondol sehen. Der muss jetzt erst einmal ordentlich versorgt werden. Morgen früh, wenn es ihm wieder besser geht, besuchst du ihn dann.“
Walgin sah ein, dass seine Mutter in diesem Fall wohl recht hatte. Jetzt war wirklich nicht die Zeit für einen Krankenbesuch. Er stellte sich vor, wie Nondol von seiner Mutter und Mingar gesäubert wurde, wie sie ihm Heilsalbe auf die schreckliche Verwundung strichen und ihn anschließend, in einen dicken Verband gehüllt, in sein Bett legten. Und er war sicher, dass die fürsorgliche Nawina bis zum nächsten Morgen an Nondols Bett wachen würde.
Ja, das würde sie tun - so wie es seine Mutter auch bei ihm getan hätte. Mütter sind etwas Sonderbares und Wunderbares, ging es ihm durch den Kopf.
Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als sich die Eingangstür zu ihrem Blockhaus mit einem leisen Ächzen öffnete und sie das Halbdunkel der großen Stube betraten. Etwas später setzte ihm seine Mutter eine kräftige Kräuter-Käse-Suppe mit Schwarzbrot vor, die er mit dem gesunden Appetit eines Heranwachsenden verzehrte.
Während sein Vater sich um die allabendliche Versorgung der Stalltiere kümmerte, verrichtete seine Mutter zunächst die nötigste Hausarbeit und setzte sich dann zu ihm an den Tisch. Sie sprach nicht gleich, aber Walgin spürte, dass sie ihm etwas Wichtiges zu sagen hatte und offensichtlich nicht wusste, wie sie das Gespräch beginnen sollte. Er wollte seiner Mutter die Entscheidung erleichtern und fragte deshalb: „Soll ich dir jetzt erzählen, was heute genau passiert ist?“
„Nein“ antwortete sie, „warte lieber noch bis dein Vater da ist, sonst musst du es womöglich zweimal erzählen. Er wird ja wohl gleich kommen. Er bringt Loska noch in den Stall.“
Sofort bekam Walgin ein schlechtes Gewissen. Die gute Loska! Er hatte sie ganz vergessen.
Ermana legte eine kurze Pause ein, sah ihrem Sohn zufrieden lächelnd zu, wie er die leere Holzschüssel zur Seite schob und sprach dann weiter, indem sie in typischer „Mutterart“ die Ellbogen auf den Tisch stützte und die Finger ineinander verschränkte.
„Eines möchte ich dir aber gleich sagen, Walgin. Ich meine, dass dein Vater und ich sehr stolz sein können auf dich. Ich weiß zwar noch nicht genau, was eigentlich vorgefallen ist, aber soviel ich bisher gehört habe, hast du wirklich sehr umsichtig und erwachsen gehandelt.“
Es machte Walgin verlegen, wenn seine Mutter in diesem Tonfall mit ihm sprach, wie es ihn im Grunde immer verlegen machte, wenn er Lob erfuhr. Deshalb meinte er beschwichtigend: „Ach, das war nichts besonderes. Nondol und ich sind Freunde und er hätte für mich sicher dasselbe getan.“
Gerade als seine Mutter zu einer Antwort ansetzen wollte, ging die Tür auf und sein Vater betrat, gefolgt von Mingar, den Raum. Entgegen seiner sonst stets humorigen Art machte Nondols Großonkel in diesem Moment eine sehr betrübte Miene. Schon stieg in Walgin wieder eine schlimme Ahnung hoch und er fragte ängstlich: „Was ist? Geht es Nondol schon wieder besser?“
Mingar antwortete zunächst nicht. Er trat an den Tisch, rückte sich einen Stuhl zurecht und ließ sich mit einem tiefen Seufzer darauf nieder. Sepon servierte eifrig zwei Krüge mit selbstgebrautem Met und nahm dann ebenfalls Platz.
„Nun ja,“ wandte Mingar sich an Walgin, nachdem er einen Schluck aus dem Krug genommen hatte, „gut geht es ihm noch nicht. Er hat sehr viel Blut verloren und ich musste seine tiefe Wunde reinigen und verbinden. Es kommt jetzt darauf an, dass er kein allzu hohes Fieber bekommt. Aber ich glaube, er wird es schaffen. Nondol ist ein zäher Bursche und gibt so leicht nicht auf.“
Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Du hast ihm das Leben gerettet, Walgin.“
Bei Mingars letzten Worten verspürte Walgin einen Stich im Herzen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der alte Mann so direkt sein würde. „Stand es denn so schlimm um ihn?“ fragte er schnell, nur um irgendetwas zu sagen.
Mingars Stimme wurde sehr leise, als er antwortete: „Es hätte nicht viel gefehlt und er wäre verblutet. Dass du ihn auf Loskas Rücken festgebunden hast, war eine gute Idee. Es war zwar riskant, aber es war die einzige Möglichkeit, damit er schnell genug nach Hause kam. Aber das wirst du selbst am besten wissen.“
„Ich hab ihm schon gesagt, dass wir stolz sind auf ihn“ meldete sich seine Mutter zu Wort und Walgin konnte aus den Augenwinkeln erkennen, dass sein Vater zustimmend nickte. Mingar sah ihn mit einem Lächeln an und sagte: „Ja, das dürft ihr auch sein. Der Junge hat dort draußen eine schwere Entscheidung getroffen. Und was das Wichtigste ist - sie war richtig.“
So viele lobende Worte waren beinahe zu viel für Walgin. Es freute ihn, dass seine Tat Anerkennung fand. Noch mehr erbaute ihn aber, dass er Nondol damit geholfen, ja möglicherweise sogar das Leben gerettet hatte. Weniger gefiel ihm die Art, wie Mingar und seine Mutter mit ihm redeten. Sie sprachen in einem Ton mit ihm, als hätten sie einen kleinen Jungen vor sich, der dafür gelobt wird, dass er so brav seinen Hirsebrei aufgegessen hat. Es war aber jetzt nicht die Zeit, sich darüber zu beklagen. Er würde seine Mutter bei passender Gelegenheit darauf ansprechen.
Als ob sein Vater seine Gedanken erraten hätte, meldete er sich – in einem Tonfall, bei dem Walgin sich schon wesentlich erwachsener vorkam - zu Wort und fragte: „Jetzt würde mich aber schon interessieren, was eigentlich vorgefallen ist und vor allem, wo sich das Ganze zugetragen hat. So viel ich weiß, war Nondol ja nicht mehr in der Lage, viel zu erzählen, als er hier ankam.“
„Das stimmt“ setzte Mingar das Gespräch fort. „Als ich ihn von Loskas Rücken hob und in die Hütte trug, phantasierte er etwas von einem Adler und einem Stock.“ Und dann wieder an Walgin gewandt „Ich nehme an, die Rückenwunde hat ihm ein Adler zugefügt. Mit dem Stock wird er sich wohl verteidigt haben.“
„Nein, das mit dem Stock war ich“ warf Walgin ein.
Als er in die erstaunten Gesichter blickte, beeilte er sich, weiter zu sprechen. Es brannte ihm auf dem Herzen, die ganze Geschichte endlich los zu werden und so sprudelte es regelrecht aus ihm heraus, als er fortfuhr. „Ich hab doch Nondol heute bei der Feuchtwiese gesucht und da war er nicht. Da hab ich Loska gesattelt und bin zur Lichtung bei der Hohen Wand geritten. Dort hab ich Nondol dann gesehen, als er gerade in das Tal hinab blickte. Gerade als ich zu ihm hingehen wollte, ist der Adler auf ihn zugestürzt. Nondol wollte in den Wald fliehen, ist aber hingefallen und der Adler hat ihn mit seiner Kralle noch am Rücken erwischt. Ich hab schnell einen Stock nach dem Adler geworfen und ihn am Schnabel getroffen. Da ist er wieder weg und Nondol hat mich gar nicht gesehen. Er ist in den Wald gelaufen und ich bin hinterher. Er ist so schnell gerannt, da hab ich ihn erst suchen müssen. Als ich ihn endlich gefunden hatte, da haben wir zuerst gar nicht bemerkt, dass er verletzt ist. Erst später hab ich das gesehen. Dann wurde er immer schwächer. Ich hab ihn auf Loska gesetzt aber er konnte sich kaum noch alleine festhalten. Naja ... und da bin ich auf die Idee gekommen, ihn festzubinden. Das war oben auf der Anhöhe bei den grauen Eichen.“
Er legte eine kurze Verschnaufpause ein, fuhr aber dann rasch fort, als er die erwartungsvollen Blicke seiner aufmerksamen Zuhörer bemerkte: „Naja...so war das. Loska brachte ihn dann ja wohl nach Hause. Das Weitere wisst ihr ja besser als ich.“
Walgin atmete mehrmals tief durch und fühlte sich nun, da er das Geschehene endlich jemandem erzählt hatte, sehr erleichtert. Er hatte sich möglichst kurz gefasst und bewusst verschwiegen, wie nahe an der Felswand stehend er Nondol angetroffen hatte. Für den Ablauf des Geschehens hielt er es für bedeutungslos. Außerdem ging er davon aus, dass Nawina die Geschichte später von Mingar erfahren würde und er wollte Nondols Mutter nicht unnötig schockieren. Ihre Eltern sahen es ohnehin nicht gerne, wenn er und Nondol sich an der Hohen Wand aufhielten.
„Nun ja“ setzte Mingar wieder an „so ungefähr hatte ich mir das Ganze schon vorgestellt. Ich denke, die Adler werden wohl einen Horst in der Wand haben. Ein Adler greift schon mal an, wenn er seine Jungen in Gefahr sieht. Nondol hätte das eigentlich wissen müssen. Diesen Vorwurf kann ich ihm nicht ersparen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig.“
Wieder sah er Walgin mit einem Lächeln an und griff, in fast zärtlicher Weise, nach dessen Hand. „Jetzt müssen wir erst einmal dafür sorgen, dass Nondol wieder gesund wird.“
Während er sich erhob, hielt Mingar den Augenkontakt mit Walgin mehrere Sekunden lang aufrecht, wobei er darauf zu achten schien, dass weder Sepon noch Ermana es bemerkten. Walgin hatte das unbestimmte Gefühl, dass der alte, weise Mann, den er so gerne mochte, ihm etwas zu sagen versuchte. Er konnte den Sinn des Blickes aber nicht deuten. Walgin nahm an, dass er nochmals, ohne Worte, seinen Dank zum Ausdruck bringen wollte.
Sie geleiteten Mingar noch bis vor die Hütte und verabschiedeten sich dann von ihm. Inzwischen war die Dämmerung hereingebrochen, so dass bis auf das gelegentliche Blöken einer Ziege oder eines Schafes friedvolle Ruhe im Dorf herrschte.
Walgin sah Mingar hinterher, wie er flotten Schrittes und erstaunlich leichtfüßig für sein hohes Alter Nondols Hütte anstrebte.
_____________________________________
Nondols Gesicht war heiß und von Schweiß bedeckt. Wie Walgin schon richtig vermutet hatte, saß Nawina die ganze Nacht hindurch auf einem Stuhl am Bett ihres Sohnes und kühlte ihm mit einem feuchten Tuch geduldig und liebevoll die heiße Stirn. Voller Sorge blickte sie auf den Jungen nieder, unter dessen geschlossenen Lidern die Augen unruhig rollten.
Sein Atem ging unregelmäßig und oft drang ein Stöhnen aus seiner Brust. Manchmal warf er in wilden Fieberträumen den Kopf hin und her oder schlug mit den Armen um sich, so als wolle er einen imaginären Angreifer verjagen.
Das Angebot ihres Mannes, sie bei der Nachtwache abzulösen, hatte Nawina dankend abgelehnt. Sie wusste, in dieser Nacht würde sie ohnehin keinen Schlaf finden. Auf einem Schemel neben dem einfachen Bett hatte Mingar einen hölzernen Becher bereitgestellt, dessen Inhalt aus einer grünlichen, würzig duftenden Flüssigkeit bestand.
„Flöße ihm davon so viel wie möglich ein“ hatte er sie beauftragt. „Das wird sein Fieber senken und ihm Kraft geben.“
Nawina tat, wie ihr geheißen und führte mit der unerschöpflichen Geduld, wie sie nur liebende Mütter aufzubringen vermögen, die ganze Nacht hindurch den kleinen hölzernen Löffel mit dem Heiltrank immer wieder an die trockenen Lippen ihres Sohnes, um ihm kleine Mengen davon zu verabreichen.
Lange bevor vor der Hütte die ersten Sonnenstrahlen durch das Blätterdach fallen und die Waldvögel ihr Zwitschern anstimmen konnten, war der Becher geleert und Nawina am Bett ihres Sohnes eingenickt. Von einer inneren Unruhe geweckt, schreckte sie hoch und musste verzweifelt erkennen, dass Mingars Heiltrank die erhoffte Wirkung verfehlt hatte. Nondols ganzer Körper schien vor Fieber regelrecht zu glühen. Seine Haut fühlte sich so trocken und heiß an, dass die kleine, tapfere Frau kaum wagte, ihren Sohn zu berühren.
Der Atem des Jungen ging flach, beinahe schon hechelnd, und Nawina kam es vor, als würde er mit jedem seiner schnellen Atemzüge einen Teil der noch verbliebenen Lebenskraft ausatmen. Panik stieg in ihr hoch! Verzweiflung! Ungläubig blickte sie mit großen, feuchten Augen auf ihren Jungen nieder und wollte einfach nicht glauben, was sie sah. Wie sehr hatte sie doch darauf gehofft und dafür gebetet, Mingars Trank möge ein Wunder bewirken. Konnte es sein, dass so viel inniges Hoffen, Beten und Bitten vollkommen umsonst gewesen sein sollten? Nein, das konnte nicht sein! Es durfte einfach nicht sein!
„Mingar! Ich muss schnell zu Mingar!“ Wer sonst, wenn nicht ihr Onkel, konnte hier noch helfen? So schnell es ihre kurzen Beine erlaubten verließ sie die Hütte um über den in Nebelschwaden gehüllten Dorfplatz auf Mingars bescheidenes Heim zuzustreben. Zum Glück blieb ihr die halbe Wegstrecke erspart, denn der Mann mit dem schlohweißen, langen Haar kam ihr bereits entgegen um von sich aus nach Nondol zu sehen.
Kaum hatte er sich auf Rufweite genähert, begann Nawina auch schon verzweifelt zu jammern: „Mingar, oh Mingar, da bist du ja! Nondol hat so schreckliches Fieber! Oh Mingar, du musst ihm helfen. Der arme Junge ringt ja bereits mit dem Tod!“ Mit den letzten Worten wurde ihre Stimme so laut und durchdringend, dass sogar das Vogelgezwitscher in den Bäumen für einen Moment verstummte.
Wortlos, aber mit besorgter Miene beschleunigte der Angesprochene seine Schritte, eilte an Nawina vorbei und stand schon wenig später an Nondols Bett. Nur kurz legte er seine Linke auf die Stirn des Jungen, während die Fingerspitzen der anderen Hand an Nondols Hals nach dem Puls fühlten. Dann beugte er sich rasch nach vorne, neigte den Kopf zur Seite und presste ein Ohr auf die Brust des Patienten.
Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, wandte er seinen Blick mit ausdrucksloser Miene zur Tür, in der Nawina mit vor der Brust gefalteten Händen stand und ihn mit großen, flehenden Augen ansah. „Jetzt ist also der Zeitpunkt gekommen“, kam es kaum hörbar über seine Lippen. „Ich sehe keine andere Möglichkeit mehr. Ich muss den Beutel öffnen.“
Nawina, die Mingars gehauchte Worte nicht verstanden hatte, blickte, auf eine Erklärung hoffend, in das Gesicht ihres Onkels. Obwohl dieser sie direkt ansah, wurde ihr gewahr, dass er sie in diesem Augenblick so wenig wahrnahm, wie den Gesang der Vögel vor der Hütte oder das einsetzende Blöken der Schafe und Ziegen im nahen Stall. So verharrten sie eine Weile, ohne ein Wort zu sprechen.
„Ja... ich muss es tun“ wiederholte Mingar seine Worte jetzt so laut, dass Nawina sie verstehen konnte und ängstlich fragte: „Was ... was musst du tun, Mingar?
Er antwortete nicht; stand nur da mit hängenden Armen und halb geöffnetem Mund und sein nach Nirgendwo gerichteter Blick verriet nichts – und doch so viel. Innerhalb weniger Augenblicke hatte ihr Onkel sich so sehr verändert, dass er ihr fremd und irgendwie unheimlich erschien. Sogar seine Stimme hatte sich wie die eines Unbekannten angehört.
Dann setzte er sich unvermittelt in Bewegung und ging rasch auf die Türe zu, so dass Nawina gezwungen war, sich einen Schritt zur Seite zu bewegen, um ihm Platz zu machen. Sie konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er, wäre sie nicht ausgewichen, einfach durch sie hindurchgegangen wäre, als würde sie gar nicht existieren. Dann verließ Mingar den Raum und eilte über den Dorfplatz auf seine Hütte zu.
Nawina fühlte plötzlich, wie sich von hinten zwei Hände zärtlich auf ihre Schultern legten und so verhinderten, dass sie vor Schwäche ins Wanken geriet. Sie wandte den Kopf, blickte in das mitfühlend lächelnde Gesicht ihres Mannes, wandte sich um und legte ihr tränennasses Antlitz Halt suchend an seine Brust. Sie wusste nicht, ob Emnor lange genug hinter ihr gestanden hatte, um Mingars Worte zu hören. Sie war aber dankbar dafür, dass er in diesem Moment nichts sagte, keine Fragen stellte, sondern sie nur fest in seinen Armen hielt und ihr zärtlich und tröstend über das Haar strich.
Erst nach einer geraumen Weile hörte sie ihn sagen: „Es ist schon gut, Nawina. Du wirst sehen, es wird alles gut. Nondol wird wieder gesund. Mingar weiß schon, was er tut.“
„Oh Emnor“, presste sie hervor „hast du Mingar gesehen? Hast du sein Gesicht gesehen, seinen Blick? Ich möchte ja so gerne glauben, dass alles wieder gut wird... ein Schluchzen unterbrach ihre Worte, „...aber Mingar machte mir nicht den Eindruck, als ob er sehr zuversichtlich wäre.“
Sie hatte ja recht. Emnor wusste nur zu gut, dass sie recht hatte. Auch ihm gelang es nur mit größter Mühe, die Tränen zu unterdrücken und seiner Frau mit gespielter Zuversicht Hoffnung zu schenken. Dann legte er mit geschlossenen Augen seinen Kopf an den ihren und küsste zart ihr dichtes, nach hinten gekämmtes und zu einem Schopf gebundenes Haar.
„Oh Walon lass bitte ein Wunder geschehen“ bat er in Gedanken den Gott des ewigen Waldes. „Bitte lass das Wunder geschehen und Nondol wieder gesund werden. Nicht für mich bitte ich darum, sondern für mein Weib. Sie würde den Tod des Jungen nicht verkraften. Wenn der Junge stirbt, wird es Nacht um sie“.
In diese düsteren Gedanken versunken nahm er gar nicht wahr, wie sie sich halb aus seinen Armen löste und ihn langsam zu Nondols Bett führte. Er erwachte erst aus seiner Versunkenheit, als sie sich über ihren Sohn beugte und ihm, so wie er es zuvor bei ihr getan hatte, mit einer Hand zärtlich durch das Haar strich, das nun von Schweiß durchtränkt auf seiner Stirn klebte.
Hastige Schritte ließen sie beide aufschrecken. Mingar stand schwer atmend in der Tür und sah sie beide an, als hätten sie soeben etwas Verbotenes getan. Er hielt einen kleinen, mit seltsamen Stickereien verzierten Lederbeutel in der linken Hand, während seine rechte den Griff eines Messers umschloss. Die Klinge steckte in einer Lederscheide, die mit den selben Stickereien versehen war, wie der Beutel und das hintere Ende des schneeweißen Griffes hatte die Form einer goldenen Kugel.
„Mingar“ stieß Nawina mit leiser Stimme hervor „was willst du denn mit ...“
„Geht hinaus“ unterbrach er sie mit rauer Stimme. „Geht!“
In einem weitaus sanfteren Ton fügte er hinzu: „Bitte ... Nawina, frag mich nicht. Stell mir keine Fragen jetzt. Wenn ich euren Sohn retten soll, dann geht jetzt bitte und achtet darauf, dass ich nicht gestört werde, bis ich euch bescheid sage.“
Unsicher und fragend blickte Nawina zu ihrem Mann hoch. Der sah sie mit steinerner Miene an, dann richtete er den Blick kurz zu Mingar, der ungeduldig zwei Schritte in den Raum getreten war und nickte ihr schließlich kaum merklich zu. Als er merkte, dass sie sich nicht zum Gehen entschließen konnte, dirigierte er sie mit sanfter Gewalt an ihrem Onkel vorbei zur Tür, die aus dem kleinen Zimmer hinaus in den geräumigen Hauptraum der Hütte führte.
Die Gelegenheit, sich im Türrahmen noch einmal umzuwenden und Blickkontakt mit Mingar aufzunehmen blieb ihm versagt, denn gerade als er sich dazu anschickte, verschloss der alte Mann die Tür von innen. Einige Augenblicke blieb Emnor stehen, strich sich mit beiden Händen langsam von oben nach unten über sein Gesicht, um sich dann wieder Nawina zuzuwenden.
Sie war in wenigen Augenblicken um Jahre gealtert. Mit den Bewegungen einer uralten Greisin schlurfte Nawina zum Tisch, zog sich unendlich langsam einen Stuhl zurecht und ließ sich dann erschöpft und mit einem Mitleid erregenden Seufzer darauf nieder. Emnor trat an ihre Seite und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Zusammengesunken und mit im Schoß gefalteten Händen sah sie zu ihm hoch.
Es bedurfte jetzt keiner Worte um sich zu verständigen. Sie sahen sich lange schweigend an und schließlich nahm Emnor ebenfalls auf einem der primitiv gezimmerten, robusten Stühle Platz und legte die Hände auf den Tisch. Es entging ihm nicht, dass Nawina immer wieder ängstlich und erwartungsvoll zur Tür blickte, hinter der sich Mingar um ihren so schwer erkrankten Jungen bemühte. Er spürte aber auch, dass es in diesem Moment besser war, sie mit ihren Gedanken alleine zu lassen und nicht mit Worten zu stören.
Nawina vertraute Mingar. Sie hatte ihm ruhigen Gewissens stets vertrauen dürfen. Aber nicht nur sie – alle Bewohner des kleinen Dorfes schenkten Mingar ihr uneingeschränktes Vertrauen. Zu ihm kam man, wenn man Rat suchte. Mingar konsultierte man, wenn jemand krank war. Niemand hatte so viel Wissen von den heilenden Wirkungen der verschiedensten Kräuter und Mixturen, wie der alte Mann. Er hatte auf beinahe alle Fragen eine Antwort und trug ein Wissen in sich, das alle Dorfbewohner erstaunte. Mingar war Heiler, Lehrer und Ratgeber in einer Person. Man liebte ihn und brachte ihm Respekt entgegen.
Trotzdem fühlte Nawina plötzlich eine lähmende Angst vor dem, was nun geschehen würde .... was er tun würde. Der Mann, den sie seit ihrer Kindheit kannte und liebte, hatte sich auf so dramatische Weise verändert. Und wie um alles in der Welt sollte er mit einem Messer und einem Beutel voller Geheimnisse ihrem Sohn helfen?
Was geschah jetzt in diesem Raum?
________________________________________
Mingar stand vor Nondols Bett und blickte lange und regungslos auf den Jungen nieder. Den Lederbeutel mitsamt seinem Inhalt und das reich verzierte Messer hatte er auf dem Hocker abgelegt , auf dem immer noch der geleerte Holzbecher stand.
Nondol lag mit weit geöffnetem Mund auf dem Rücken. Sein Atem ging keuchend, seine Haut glühte nun heiß und trocken. Mingar beugte sich nach vorne, zog die Schafwolldecke, die ohnehin nur noch die Beine des Kranken bedeckt hatte, beiseite und schleuderte sie achtlos in eine Ecke des Raumes. Dann drehte er den Liegenden vorsichtig zur Seite, so dass er die Rückenwunde freilegen konnte. Zunächst wickelte er die um den Körper geschlungenen Binden ab. Danach machte er sich daran, die mit Heilsalbe getränkten Leinenkompressen von der Wunde zu ziehen. Auch diese Dinge ließ er achtlos auf den staubigen Boden fallen, so als ob er wüsste, dass sie nicht mehr benötigt würden.
Nur kurz warf er einen Blick auf die furchtbar entzündete Furche am Rücken seines Patienten, während er ihn in Bauchlage brachte. Jetzt hielt er kurz inne, kniete sich dann zu Boden und wandte sich dem Hocker zu, auf dem der Lederbeutel lag. Mit flinken Bewegungen löste er die dünne, verknotete Schnur, zog die geraffte Öffnung auseinander und fasste mit der linken Hand hinein. Als er sich wieder aufrichtete, betrachtete er einen kleinen, aus glänzendem, dunkelgrünen Kristall bestehenden Gegenstand. Der Kristall glich in Größe und Form einem Taubenei. Die Oberfläche war glatt und glänzend. Von einem Ei unterschied ihn lediglich der Umstand, dass beide Enden identisch geformt waren.
Mingars Gesicht glich einer ausdruckslosen Maske als er bewegungslos verharrte und lange, ohne sichtbar zu atmen, auf das kalte, grüne Ding in seinen Händen blickte. Er betrachtete es nachdenklich, drehte es einige Male unentschlossen zwischen den Fingern und führte es dann hoch, so dass es sich vor seinem Gesicht befand.
Im Innern des grünen Kristalls – etwa dort, wo man bei einem gewöhnlichen Ei den Dotter vermuten würde – erkannte er nun ein rotes Glühen. Je länger Mingars Augen darauf ruhten, um so mehr hatte er den Eindruck, als würde das „Glutherz“ nicht gleichbleibend leuchten, sondern unruhig wabern und pulsieren.
Nach einer Weile der stummen Betrachtung kam ein Seufzen über Mingars Lippen und er flüsterte: „Nenuana, du Gute. Hab unendlichen Dank für dieses große Geschenk. Aber was muss ich tun, Nenuana – was?“
Erneut betrachtete er ratlos, ja beinahe verzweifelt, das geheimnisvolle „Glut-Ei“ in seinen Händen. Und als ob jemand vor ihm stünde, begann er ein kaum hörbares Gespräch.
„Wie sagtest du damals? Wenn du den Inhalt des Beutels jemals brauchen solltest, wirst du wissen, was zu tun ist! Ja, so sagtest du. Aber ich weiß es nicht, Nenuana; ich weiß es nicht!
Sein anfangs kaum hörbares Flüstern war mit diesen Worten immer lauter geworden.
„Wie sehr habe ich damals mit mir gerungen, ob ich dieses Geschenk von dir annehmen soll, oder nicht. Nun bin ich froh, es nicht abgelehnt zu haben, Nenuana! Aber nun knie ich hier und weiß nicht, was zu tun ist. Sag es mir, Nenuana. Bitte sag es mir.“
Tränen der Verzweiflung flossen nun über Mingars Gesicht, während Nondol auf seinem Lager ein leises Stöhnen von sich gab. Und so, als ob er dieses Stöhnen als Aufforderung verstanden hätte, wandte Mingar sich, immer noch auf Knien, mit dem „Glut-Ei“ in der rechten Hand seinem Großneffen zu.
Ganz langsam führte er es über die Rückenwunde, senkte es langsam und legte es dann auf Nondols Rücken; direkt auf die entzündete, lange Wunde. Vorsichtig balancierte er den Kristall so aus, dass er liegen blieb und erhob sich dann langsam. Sofort verstummte Nondols Stöhnen und ging in ein gleichmäßiges, ruhiges Atmen über.
Eine Weile stand Mingar so neben dem Bett und sah voller Erwartung und Schmerz auf den schwerkranken Nondol nieder, auf dessen Rücken nun der geheimnisvolle, grüne Stein lag.
Die Minuten verstrichen aber es tat sich nichts.
Voller Ungeduld kniete Mingar erneut nieder, legte sanft und vorsichtig die rechte Hand auf das gläserne Ei und verhielt so einige Sekunden, ohne zu wissen, warum er dies eigentlich tat.
Wieder wartete er eine Weile – wieder vergeblich. Dann erinnerte er sich plötzlich an das Messer. Er lenkte seinen Blick nach links und starrte auf den weißen Elfenbeingriff, als ob er von ihm eine Antwort erwartete. Nach einem Augenblick der Ratlosigkeit ergriff er mit seiner Rechten das Messer und zog es aus der reich verzierten Scheide. Im Halbdunkel des kleinen Raumes glänzte die scharfe, spitze Klinge, wie poliertes Silber. Wie in Trance führte er die Messerspitze an seine linke Hand und setzte sie an die Fingerkuppe des Zeigefingers. Dann drückte er dagegen, bis die haarscharfe Spitze in seine Haut eindrang und eine kleine Verletzung verursachte. Schnell legte er das Messer wieder auf den Schemel.
Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand presste er nun die kleine Wunde an seinem linken Zeigefinger zusammen, bis ein Blutstropfen daraus hervortrat. Nun hielt er den Finger dicht über den Kristall und wartete, bis der Tropfen darauf niederfiel.
Staunend stellte er fest, dass die dunkelrote Flüssigkeit nicht über die glatte Oberfläche glitt, sondern ohne jegliche Ablenkung in das kleine Ei eindrang. Mit fasziniertem Blick verfolgte Mingar, wie der kleine rote Tropfen, ohne ein Loch zu hinterlassen, langsam durch das grüne, harte Material wanderte, sich der glühenden Mitte näherte und gleich darauf mit ihr verschmolz. Nun begann es im Inneren lebendig zu werden. Wie ein unförmiger Embryo begann das Herz des Kristalls sich in beinahe wellenförmigen Bewegungen zu winden und zu drehen, sich auszudehnen und wieder zu schrumpfen.
Und dann sah Mingar, wie die Glut begann, sich ihren Weg aus dem Ei zu bahnen. Zuerst war es nur ein hauchdünner, kaum sichtbarer Dorn, der sich im Innern des Kristalls mehr und mehr nach unten bohrte. Wie ein dünner, nadelspitzer Wurm bahnte sich die flüssige Glut langsam ihren Weg durch das harte Kristall, bis es schließlich genau an der Stelle, wo der Stein Nondols heiße Haut berührte, nach außen drang.
Mingar beobachtete fasziniert, wie die glutrote, leuchtende Flüssigkeit innerhalb der entzündeten Furche auf Nondols Rücken entlang wanderte und immer wieder winzige Verzweigungen bildete, so dass sie Augenblicke später die gesamte Wunde füllte.
Kaum war dies geschehen, lösten sich die Hautverfärbungen an den Wundrändern zusehends auf, verschwanden, als würden sie von der Oberfläche der Haut in das Körperinnere gesogen. Die geheimnisvolle rote Flüssigkeit verschmolz mehr und mehr mit der Wunde, die feuchte Verletzung trocknete rasch aus und begann mit unglaublicher Geschwindigkeit zu heilen.
_____________________________________
Mit dem ersten Sonnenstrahl, der das dichte Blätterdach des Waldes durchstach und die Vögel dazu animierte, ihren Morgengesang anzustimmen, erwachte Walgin in seiner Kammer. Auf den erholsamen Schlaf, wie er ihn sonst gewohnt war, hatte er in der vergangenen Nacht verzichten müssen. Schlimme Träume hatten ihn geplagt und er war mehrmals schweißgebadet aufgewacht. Nun aber drängte es ihn, nach seinem besten Freund zu sehen.
Behände sprang er von seiner warmen Liegestatt hoch, schlüpfte in die raue Leinenhose und warf sich sein Lederhemd über. Als er gleich darauf schwungvoll die Tür öffnete und die große Wohnstube betrat, sah er, dass seine Mutter soeben damit beschäftigt war, ein Frühstück für ihn zu bereiten. Sie stand an der offenen Feuerstelle und rührte in einem über der Glut hängenden Topf. Im ganzen Raum roch es verführerisch nach gesalzener Ziegenmilch und frischem Brot. Er verspürte zwar, wie immer wenn er morgens aufstand, ordentlichen Hunger, aber mit der Morgenmahlzeit wollte er sich in diesem Moment eigentlich nicht aufhalten.
„Mutter“, sagte er „hast du etwas dagegen, wenn ich jetzt erst mal nach Nondol schaue und anschließend die Frühsuppe esse?“ Bevor seine Mutter die Möglichkeit hatte dagegen zu protestieren, fügte er hastig hinzu: „Ich werde mich auch ganz bestimmt beeilen. Wirklich!“
„Na gut“ meine sie mit einem verständnisvollen Lächeln. „Brauch aber bitte nicht zu lange, dein Essen wird ja sonst kalt“. Sie vernahm nur noch ein gedankenlos hingeworfenes „Ja ja“ dann war er auch schon durch die Türe verschwunden und eilige Schritte entfernten sich von der Hütte.
Auf seinem Weg zu Nondols Elternhütte hatte Walgin keinen Blick für die Schönheit des Waldes, der durch die einfallende Morgensonne unvergleichliche Schattenspiele erhielt. Da und dort hauchten die letzten Reste des aufsteigenden Morgennebels ihren Geist aus und die ersten Vorboten der zu erwartenden Sommerhitze stiegen bereits aus dem taufeuchten Boden empor. Die typischen Gerüche nach Tannenzapfen, Baumpech, abgestorbenen Fichtennadeln und feuchter Erde bereicherten die Luft, ohne allerdings von dem jungen Belmaner wahrgenommen zu werden, den es in diesem Moment danach drängte, seinem Freund einen Krankenbesuch abzustatten.
Walgin erreichte Emnors Blockhütte, eilte die drei Treppen zur Eingangstüre hoch und trat schwungvoll in die Stube ein. Ein Anklopfen oder eine andere Form der Ankündigung war in den Belmanerdörfern ohnehin nicht üblich. Die großen Stuben, die gleichzeitig als Wohn- und Kochraum benutzt wurden, waren ein offener Ort. Jeder Dorfbewohner betrat jede Nachbarhütte, wie seine eigene. Allerdings galt dies nur für den Hauptraum. Die Nebenräume, wie Schlaf- oder Speisekammern waren tabu.
Gleich nachdem Walgin allerdings die Hütte betreten hatte, blieb er wie vom Blitz getroffen stehen und musste den Anblick, der sich ihm bot, erst einmal verdauen. Er hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, was er in diesem Moment zu sehen bekam.
Am großen Tisch neben der Feuerstelle saßen Nawina, Emnor, Mingar - und Nondol! Jeder von ihnen hatte eine große Holzschüssel vor sich und löffelte in aller Ruhe eine angenehm duftende Suppe, als ob es nie ein Unglück gegeben hätte. Also ob nie ein Adler herabgestürzt wäre und Nondols Rücken zerfetzt hätte. Als ob er – Walgin – niemals eine Heldentat vollbracht und seinen Freund vor dem Verbluten gerettet hätte. Als ob Nondol nie dem Tode nahe gewesen wäre.
Walgin konnte es einfach nicht fassen. Er fühlte sich, wie vor den Kopf geschlagen. Er hatte sorgenvolle Eltern erwartet, Nondol geschwächt im Bett liegend, Mingar mit einem Heiltrank davor stehend, allesamt darum bemüht, dass Nondol wieder gesund wurde. Oder zumindest eine ähnliche Situation.
War er denn verrückt geworden? Hatte er das alles nur geträumt? Das war doch nicht möglich!
Plötzlich wurde ihm die Peinlichkeit der Situation bewusst. Er war in die Hütte gestürmt, hatte die Aufmerksamkeit der Bewohner auf sich gelenkt und nun stand er in der halb offenen Tür, konnte den Mund nicht mehr schließen und starrte die Leute, die hier beim Frühstück saßen, mit entsetzten Augen an, als ob es sich um Ungeheuer aus der Lembol-Schlucht handeln würde.
Bevor er jedoch erklärende Worte finden konnte, wurde er von schallendem Gelächter aus seiner Erstarrung gerissen. Sowohl Mingar, als auch Nondol und seine Eltern waren wohl durch die Art seines Auftrittes derart belustigt, dass sie sich vor herzhaftem Lachen krümmten.
Angesichts dieser Reaktionen wusste Walgin sich vor Verlegenheit kaum noch zu helfen. Er trippelte von einem Bein auf das andere und war bereits geneigt, sich umzudrehen und die Hütte fluchtartig zu verlassen. Da erhob sich Mingar von seinem Stuhl und kam mit ausgestreckten Armen, aber immer noch lachend, auf ihn zu. Er legte ihm beschwichtigend eine Hand auf die Schulter, während er mit der anderen beiläufig die Türe schloss und sagte: „Ach Walgin, guter Junge, sei uns bitte nicht böse. Ich weiß, das war jetzt peinlich für dich. Es war aber auch zu komisch, wie du hier hereingeplatzt und dann wie vom Donner gerührt stehen geblieben bist“.
Während er ihn nun sanft zum Tisch dirigierte und durch eine Geste dazu aufforderte, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, sagte er lächelnd: „Weißt du, es ist wirklich schade, dass du dich nicht selber sehen konntest. Ich verspreche dir, du hättest ebenfalls lachen müssen“.
Während das Lachen der Anderen nach und nach leiser und verhaltener wurde, setzte Mingar fort: „Aber ich verstehe natürlich, dass du überrascht bist. Wir alle verstehen das. Du hast sicher nicht erwartet, dass wir hier so entspannt beim Morgenmahl sitzen“.
Jetzt nahm Mingars Miene allmählich wieder die Ernsthaftigkeit an, die Walgin von ihm gewohnt war. „Ja Walgin, du hast schon recht. Es ist natürlich nicht ganz selbstverständlich, dass es so ist, wie es ist. Und natürlich verdienst du es, über die Sache aufgeklärt zu werden“.
Nun richtete Mingar seinen Blick zu Nondol: „Auch dir habe ich noch nicht die ganze Wahrheit gesagt, mein Junge. Es war nicht nur die gute Medizin, die dich so schnell und unerwartet wieder gesund werden ließ.“
Er umrundete nun langsam und nachdenklich den Tisch, so als ob er nach den richtigen Worten suchen müsste. Dann blieb er stehen und sprach die beiden Jungen an: „Ich möchte hier nicht weiter über dieses Thema sprechen. Deshalb schlage ich vor, dass ihr beide erst einmal in aller Ruhe eure Suppe und etwas Brot esst. Danach kommt ihr bitte beide zu mir und wir setzen uns zusammen, um ein ausführliches Gespräch zu führen. Ich habe euch einiges zu sagen. Aber keine Angst, es wird nichts mit Vorwürfen oder dergleichen zu tun haben. Was ich euch zu berichten habe, ist wesentlich weitreichender und … „
An dieser Stelle unterbrach er sich, hielt kurz inne und sagte dann nur noch: „Aber das alles erkläre ich euch dann in meiner Hütte. Mehr möchte ich momentan nicht dazu sagen“.
Dann wandte er sich an Emnor und Nawina. „Auch mit euch muss ich mich noch unterhalten. Aber das hat Zeit. Jetzt sind erst einmal die beiden Jungen dran. Fürs erste sollten wir froh und glücklich sein, dass Nondol seine Verletzung überstanden hat. Alles weitere ist momentan nicht so vordringlich“.
Als Nawina zu einer Frage ansetzte, unterbrach Mingar sie mit einer Geste: „Nein Nawina, bitte frag jetzt nichts. Wie gesagt, es gibt einiges zu erklären. Ich möchte das aber auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Ich kann dir vorläufig nur so viel sagen; es wird eine längere Geschichte, die ich dir und Emnor zu erzählen habe. Aber wie ich bereits sagte. Erst einmal sind die beiden hier an der Reihe“. Damit zeigte er auf Nondol und Walgin.
Um die Angelegenheit abzuschließen, wandte er sich um und ging rasch zur Türe. Als er den Raum verlassen hatte, kehrte Stille ein. Das ausgelassene Lachen, das kurz zuvor noch das kleine Häuschen erfüllt hatte, war innerhalb kürzester Zeit vergessen und hatte einer bedrückenden Nachdenklichkeit Platz gemacht. Die abrupte Änderung der Stimmung hatte sie alle überrascht. Nicht nur Walgin war mit der Situation etwas überfordert.
Er wollte eigentlich nur nach seinem Freund sehen, wollte ihn besuchen, sich nach seinem Befinden erkundigen und hoffen, dass er bald wieder gesund sein möge. Dabei hatte es sich ohnehin nur um eine sehr vage Hoffnung gehandelt. Insgeheim hatte er eher befürchtet, sein Freund liege fiebernd und nicht ansprechbar darnieder. Stattdessen hatte er ihn vollkommen erholt am Tisch sitzend angetroffen, war mit einem kollektiven Lachanfall empfangen worden und nun saßen sie alle hier beisammen und es herrschte betretenes Schweigen.
Was war denn nur geschehen? Walgin konnte sich aus all dem keinen Reim machen. Mingars rätselhafte Worte schwirrten immer noch durch seinen Kopf. Warum hatte er ihnen nicht einfach gesagt, was los war?
Er richtete seinen Blick zu Emnor. Dieser hatte den Kopf in beide Hände gestützt und blickte nur betreten und mit nachdenklicher Miene in seine Suppenschüssel. Und auch Nawina und Nondol sahen sich gegenseitig ratlos an. Dann wandte sich Nondols Mutter zu ihm und sagte: „Walgin, mein Junge, schön, dass du so früh aufgestanden und gekommen bist. Du bist wirklich ein guter Freund. Hast du denn schon gefrühstückt?“
Walgin schüttelte den Kopf: „Nein, ich habe aber Mutter versprochen, dass ich gleich zurückkomme und meine Suppe esse.“
„Ach nichts da“, warf Nawina energisch ein. „Du bekommst hier bei uns deine Suppe. Ich muss nachher ohnehin zu deiner Mutter und rede mit ihr. Jetzt setzt du dich erst einmal zu Nondol. Ich bringe dir gleich dein Essen. Und wenn ihr euch satt gegessen habt, geht ihr gemeinsam zu Mingar. Ihr habt ja gehört, was er gesagt hat.“ Damit erhob sie sich und machte sich an der Anrichte zu schaffen. Sie kramte eine große Holzschüssel hervor und befüllte sie an der Feuerstelle mit dem Schöpfer. Danach stellte sie das Gefäß mit der köstlich duftenden Kräutermilch-Suppe vor Walgin auf den Tisch und legte auch noch zwei große Scheiben Brot daneben.
In diesem Moment erhob sich Emnor, seufzte einmal tief und sagte dann zu seiner Frau: „Komm, lassen wir die beiden in Ruhe essen. Wir haben ohnehin im Stall zu tun“. Nawina nickte nur leicht, griff sich noch rasch einen Eimer, der am Boden neben der steinernen Feuerstelle gestanden hatte und verließ dann zusammen mit ihrem Mann die Hütte.
Kaum hatte sich die Tür hinter ihnen geschlossen, wandte sich Walgin an seinen Freund und es sprudelte aus ihm heraus: „Nondol, was ist denn hier los? Wie ist es denn nur möglich, dass du so schnell wieder gesund geworden bist? Was hat Mingar denn mit dir gemacht? Wieso tut er so geheimnisvoll?
„He, he, langsam, langsam Walgin“ wurde er von Nondol unterbrochen. „Ich weiß genau so wenig wie du, was hier los ist.“
„Aber Nondol, du warst gestern am späten Nachmittag noch halb tot. Ich hab deine Verletzung gesehen. Du wärst beinahe verblutet! Und durch die dreckigen Krallen dieses Adler-Mistkerls müsstest du doch eigentlich eine schreckliche Entzündung bekommen haben. Das gibt es doch gar nicht, dass du hier herum sitzt und scheinbar wieder vollkommen gesund bist!“ polterte Walgin erneut los.
Wiederum musste Nondol den Redefluss seines Freundes bremsen. „Ja, du hast ja recht. Aber das letzte, an das ich mich erinnern kann...“ Nach einer kurzen Atempause musste er erneut ansetzen: „Also ich weiß nur noch, dass mich der Adler angegriffen hat, dann lag ich auf dem Waldboden und du hast mir geholfen, zu Loska zu kommen. Ich weiß, dass ich schlimm geblutet habe und immer schwächer wurde. Dass du mich dann auf Loskas Rücken festgebunden hast, hab ich schon nicht mehr mitgekriegt. Das haben sie mir erst heute erzählt.“
Bei seinen letzten Worten hatte Nondol sich erhoben und mit beiden Händen über seine Schultern gegriffen, um sein Hemd bis in den Nacken hochzuziehen. Mit den Worten: „Hier, sieh dir das an“ drehte er sich so, dass Walgin einen Blick auf seinen Rücken werfen konnte.
Dieser schob geistesabwesend seine Schüssel etwas beiseite und stand ebenfalls auf. Mit fassungsloser Miene näherte er sich langsam seinem Freund und fuhr mit der rechten Hand über die Narbe an Nondols Rücken. Er konnte einfach nicht glauben, was er sah. Er war davon ausgegangen, einen straffen Verband vorzufinden unter dem sich eine schreckliche, entzündete Wunde über den Rücken zog. Aber Nondol trug weder einen Verband, noch war etwas zu sehen, das nach einer tiefen, blutenden Verletzung aussah. Alles, was der junge Belmaner erkennen konnte, war eine lange Narbe, die sich neben der Wirbelsäule seines Freundes der Länge nach über den Rücken erstreckte.
Es war kaum mehr als ein Flüstern, das Nondol nun aus dem Mund seines Kameraden vernahm: „Aber Nondol, das ist doch nicht möglich. Das ist ja völlig verheilt! Du hast da nur noch eine lange Narbe. Und selbst die sieht aus, als ob die Verletzung nicht erst von gestern, sondern bereits vom letzten Sommer wäre.“
Einige Augenblicke standen sie noch wortlos da und Walgin konnte seinen Blick nicht von der verheilten Wunde lösen. Dann zuckte Nondol mit den Schultern, so als wollte er damit seine Ratlosigkeit zum Ausdruck bringen, und ließ dann sein Hemd wieder über den Rücken fallen. Mit einem erneuten Schulterzucken setzte er sich an den Tisch um mit dem Verzehr seiner Suppe fortzufahren. Auch Walgin nahm seinen Platz wieder ein, griff zum Löffel und machte sich ebenfalls über die verführerisch duftende Suppe her. Nach einer weiteren Weile des Schweigens und Essens meinte Nondol dann: „Ich bin wirklich gespannt, was Mingar uns zu erzählen hat.“
„Ja, ich auch“ lautete Walgins einsilbige Antwort.
Danach trat wiederum eine längere Schweigepause ein. Lediglich das leise Klappern der Schüsseln auf dem Tisch und die scharrenden Geräusche der Löffel erfüllten den Raum. Dann endlich brachte Nondol es über sich, seinen Freund anzublicken und rang sich die Worte ab: „Walgin .. ich .. ich weiß, was ich dir zu verdanken habe.“
Diese Worte kamen nicht deshalb so schwer über Nondols Lippen, weil er sie etwa nicht ehrlich gemeint hätte. Nein, aber es war unter halbwüchsigen männlichen Belmanern einfach nicht üblich, sich sentimentale Gefühle einzugestehen. Das galt als „unmännlich“ und wurde, wo immer möglich, vermieden. Trotzdem legte Nondol nun seine freie Hand sanft auf den Unterarm seines Lebensretters und brachte flüsternd hervor: „Danke, Walgin“.
Walgins Antwort bestand lediglich in einem Erröten und einem verlegenen Blick in seine Schüssel. Dann schwiegen sie, bis sie ihre Mahlzeit beendet hatten. Und in ihnen beiden reifte die Erkenntnis, dass sie vom Schicksal soeben noch enger verbunden worden waren, als es bisher ohnehin schon der Fall gewesen war.