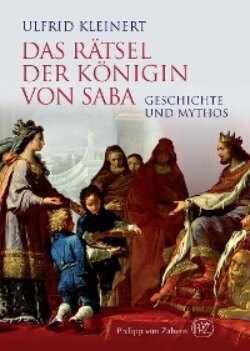Читать книгу Das Rätsel der Königin von Saba - Ulfrid Kleinert - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Am Ursprung der Geschichte. Fünf Beobachtungen zur Entstehung der alttestamentlichen Geschichte von König Salomo und der Königin von Saba im 1. Jahrtausend v. Chr.
ОглавлениеWer die vielen Facetten der Wirkung dieser Geschichte darstellen will, sollte zuerst nach ihrer Entstehung fragen.1 Schon ein vorläufiger literarkritischer Blick auf die in 1. Könige 10 wiedergegebene Erzählung vom Besuch der Königin von Saba bei König Salomo in Jerusalem zeigt uns verschiedene Stufen ihrer Entwicklung. In meiner Übersetzung des Textes aus dem Hebräischen habe ich das optisch zu zeigen versucht:
Da ist in fetter Schrift die älteste uns erkennbare schriftliche Fassung der Geschichte wiedergegeben. In ihr geht es um Salomos Weisheit: sie wird geprüft, bewährt, in höchsten Tönen gelobt; um sie herum gruppiert sich das übliche, hier ins Monumentale gesteigerte höfisch-diplomatische Zeremoniell des Gabentausches.
In diese Geschichte ist einerseits, im Kleindruck deutlich gemacht, die Beschreibung von Salomos Reichtum und seiner Hofhaltung eingefügt. Reichtum und Wohlergehen wurde zwar damals oft als Folge von Weisheit gesehen, dennoch stören die Bemerkungen dazu den Erzählfluss; sie erweisen sich so als später hinzugekommen.
In dem kursiv gesetzten Vers 9 hören wir eine ganz andere Sprache und andere Töne. In diesem Vers kommt Gott ins Spiel, von dem sonst nicht die Rede ist. Er wird von der Königin gelobt, weil er einen solch weisen und gerechten Mann wie Salomo für Israel als König eingesetzt hat. Zwar kann auch hier gesagt werden: Weisheit zeigt sich in der Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit; daran haben die Götter Wohlgefallen.2 Und das Lob des Gottes der Gastgeber gehört zur internationalen Diplomatie im Orient.3 Hier aber wirkt der Vers angehängt, isoliert im Erzählzusammenhang und erscheint vor allem in einer fast liturgischen Sprache, die der volkstümlichen Erzählung sonst fehlt.4
In ihr ging es ursprünglich um die durch des Königs Ruf und das entschlossene Handeln der Königin möglich gewordene Begegnung zweier gleichberechtigter, gleich kluger und gleich reicher Herrscherpersönlichkeiten, eines Mannes und einer Frau, eines im Süden und eines im Norden der arabischen Halbinsel siedelnden Volkes, die, wie eine Ergänzung deutlich macht, verschiedenen Religionen angehörten. Zwischen ihnen spielt sich ein dynamisches Geschehen ab, in dem zuerst die Königin aktiv ist (Vers 1 und 2), dann der König souverän reagiert (Vers 3), daraufhin die Königin den König in höchsten Tönen preist und reich beschenkt (Verse 4–10, mit den späteren Ergänzungen, die diesen Akzent verstärken) und schließlich der König die Gaben in dreifacher Weise erwidert, wobei – anders als bei den Geschenken der Königin – nichts konkret gesagt, aber viel Phantasien Weckendes angedeutet wird (Vers 13). Am Ende wird mit dem lakonischen Hinweis auf die Rückkehr der Königin ausgedrückt, dass es sich um eine außergewöhnliche und einmalige Begegnung gehandelt hat – eine schöne Episode im Leben der beiden sagenhaften Herrscherpersönlichkeiten.
Die Unterscheidung der verschiedenen literarischen Schichten des Textes klärt nun freilich noch nicht die Geschichte seiner Entstehung. Seiner soeben vorgestellten schriftlichen Fixierung im 1. Buch der Könige ging vermutlich ein längerer Prozess mündlicher und schriftlicher Überlieferung voraus. Von diesem Prozess können wir Spuren erkennen, zeitliche Eingrenzungen vornehmen, Bezüge herstellen. Das soll im Folgenden aufgezeigt werden. Dabei wird deutlich, dass nicht erst die Wirkungsgeschichte der Erzählung, sondern schon ihr Entstehungsprozess unseren Blick öffnen kann für historische politische, religiöse und kulturelle Entwicklungen.
Zeitlich begeben wir uns dazu in das erste vorchristliche Jahrtausend, örtlich in den Raum zwischen unterem Nil und oberem Euphrat und Tigris, und zwar an die Stelle, an der für wenige Jahrhunderte die kleinen Staatswesen von Juda und Israel lagen.
Wir beginnen mit den zeitlichen Grenzen, nämlich mit dem frühesten und dem spätesten Datum, zwischen denen der Text entstanden sein muss.
Unter den kritischen Forschern, die seit der Aufklärung bis heute der Geschichte von Salomo und der Königin von Saba nachgegangen sind, gibt es im Detail manche Kontroverse. Aber in zweierlei Hinsicht sind sie sich weitgehend einig. Ihre Einigkeit betrifft 1. den terminus a quo, also die Zeit, ab der frühestens die Erzählung von der Begegnung Salomos mit der Königin von Saba bekannt ist, und 2. den terminus ad quem, also die Zeit, zu der spätestens unsere Geschichte aufgeschrieben wurde. Nachdem ich im Folgenden in Übereinstimmung mit der Forschung 1. und 2. den Zeitrahmen abgesteckt habe, versuche ich 3. und 4. den Zeitraum dazwischen einzugrenzen und werde 5. davon berichten, wo, wann und wie ansonsten – außerhalb der Königsbücher – im Alten Testament5 von Saba und den Sabäern die Rede ist. Zunächst also zum frühesten Datum der Entstehung der Geschichte: