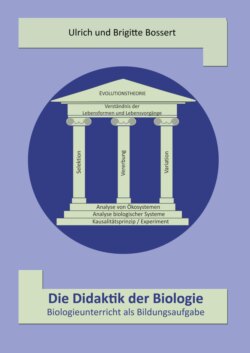Читать книгу Die Didaktik der Biologie - Biologieunterricht als Bildungsaufgabe - Ulrich Bossert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Erkenntnisfähigkeit in den Welten
ОглавлениеSinnesorgane des Menschen
Lebewesen nehmen äußere und innere Reize über Sinnesorgane wahr. Am Anfang der Informationskette stehen Art (qualitativ) und Empfindlichkeit (quantitativ) der jeweiligen Sinnesorgane. Fledermäuse hören auch Ultraschall, viele Vögel können ultraviolettes Licht zusätzlich wahrnehmen, das Rotkehlchen besitzt einen Magnetsinn usw. Diese unterschiedlichen Leistungen führen zu unterschiedlichen Informationen über die Außenwelt.
Hat man Tiere noch so genau untersucht und z.B. bei Fledermäusen ihre Orientierung im Ultraschallbereich in allen Einzelheiten aufgeklärt, so bleibt immer noch Thomas Nagels Frage: "What is it like to be a bat?"
Mit diesem Problemfeld hat sich auch schon Hoimar v. Ditfurth beschäftigt. Der folgende Text zur Wirtserkennung der Zecke und der dabei ablaufenden Informationsselektion folgt in weiten Teilen dem Artikel "Einstein und die Amöbe".
Der Schlüsselreiz, der sich nur auf möglichst wenige Merkmale bezieht, die aber für alle in Betracht kommenden Wirte gelten, ist die einzige überhaupt denkbare Lösung der fast utopisch anmutenden Aufgabe, ein Wirtsbild genetisch zu speichern, das alle jemals begegnenden Säugetiere wiedergibt.
Als biologischer Organismus ist die Zecke mit dem angeborenen Wissen über ihre Welt optimal informiert. Geruch und Temperaturanstieg definieren ein Säugetier für den in Frage kommenden Zweck mit ausreichender Zuverlässigkeit. Die Existenz von Zecken in der Welt beweist es. Geruch (Buttersäure) und Temperaturanstieg (auf der Haut) sind in der "Welt" der Zecke das einzige, was von einem Säugetier - ob Maus oder Büffel - "übrig bleibt". Sie sind für eine Zecke mit "dem" Säugetier identisch. Die "Welt" ist zwar reduziert, aber die Informationen sind zweckmäßig und zutreffend.
Biologisch zweckmäßige und objektiv "wahrheitsgetreue" Abbildung werden in der Strategie der Evolution als unterschiedliche Größen behandelt. Überleben und Erkennen sind für sie zwei Paar Stiefel. Und da, wer nicht überlebt, auch nichts anderes mehr tun kann, wird, wogegen sich schwer argumentieren lässt, der Überlebenswert einer Anpassung allen anderen noch so wünschenswerten Erfordernissen vorangestellt. Jede Anpassung ist ein Abbild der Welt. Es fragt sich nur, wie getreu die jeweilige Abbildung ist.
Nervenzentren des Menschen
Die Erregung, die durch Reize in den Sinnesorganen ausgelöst wurde, wird weiter geleitet und in dem Gehirn verarbeitet. Die unterschiedlichen Möglichkeiten werden durch einen Vergleich von Schnecke und Mensch veranschaulicht.
Die Erforschung des Verhaltens von Aplysia californica (sehr große Meeresschnecke) durch Eric Kandel und seine Arbeitsgruppe waren so erfolgreich, weil die Nervenzellen der verschiedenen Nervenknoten und ihre Verknüpfungen genetisch eindeutig festgelegt sind. Man kann einen Atlas der Nervennetze erstellen, der für alle Tiere dieser Art zutrifft. D.h. alle Untersuchungsergebnisse - auch die des Lernverhaltens - von allen Versuchstieren können zu einem Gesamtbild "addiert" werden.
Beim Menschen wird die Gehirnstruktur (hardware) bis zur Geburt durch die Gene und in geringerem Umfang durch die Umgebung (Mutter) bestimmt. Nach der Geburt wird gespeichert (software) und es werden Netzwerke geknüpft (hardware). Die Speichervorgänge im Gedächtnis hängen von vielfältigen äußeren Umständen und den Emotionen usw. der Person ab. Durch den Gebrauch oder Nichtgebrauch wird das Überleben vieler Nervenzellen beeinflusst - d.h. die Gehirnsubstanz (hardware) wird modifiziert. Das Gedächtnis wird lebenslang erweitert, umgebaut und teilweise gelöscht.
Es gibt dauerhafte Verknüpfungen (z. B. Reflexbogen) von kleinen Nervennetzen, die aber durch Lernen modifiziert werden können (bedingter Reflex). Hinzu kommen aber auch synchrone Neuronennetze, die sich erst "bei Bedarf" bilden und sich anschließend wieder anders strukturieren.
Einflüsse während der Entwicklung
Genetische und vorgeburtlich-epigenetische Prozesse bestimmen die psychische Grundausstattung eines Neugeborenen und damit sein Temperament als Kern seiner späteren Persönlichkeit. Das Stressverarbeitungssystem kann in seiner vorgeburtlichen Entwicklung durch negative Einflüsse über das traumatisierte Gehirn der werdenden Mutter stark beeinträchtigt werden. Ein weiterer Faktor ist die psychische Erfahrung in der Familie, dem Kindergarten, der Schule usw., die allgemein als „Erziehung“ und „Sozialisierung" angesehen wird. Es entwickeln sich die Fähigkeiten zur Kooperation, zu Empathie, zum Einhalten gesellschaftlich-moralischer Regeln und zur Berücksichtigung der Konsequenzen eigenen Handelns für einen selbst und die Anderen. Diese Ebene entwickelt sich bis zum Erwachsenenalter und darüber hinaus.
Schließlich gibt es die kognitiv-sprachliche Ebene; sie entwickelt sich ab dem dritten und vierten Jahr mit dem Ausreifen kognitiver und sprachlicher Fähigkeiten.
Dynamik - Raum - Zeit
Das unbewusste System beeinflusst das bewusste (Stimmungen, Motivation usw.).
D.h. jedes menschliche Gehirn, jeder Mensch und alle Ergebnisse aus Versuchen mit einem Menschen sind einmalig, weil sie durch seine Gene und das einmalige Wechselspiel mit der Umwelt in seiner Lebenszeit bestimmt wurden.
Mess- und Berechenbarkeit
Streng wissenschaftlich gesehen macht diese Flexibilität des menschlichen Gehirns intersubjektives Wissen unmöglich. Im täglichen Leben dagegen ist ein solches Wissen Voraussetzung für jedes Handeln und ein gutes Zusammenleben.
Der menschliche Körper besteht aus etwa 7,5 × 1013 Zellen. Man rechnet mit 1011 Neuronen des Großhirns und mindestens der gleichen Menge an Gliazellen. Man entdeckt immer mehr Aktivitäten der Gliazellen, die man bisher nur als passives Isolationsmaterial angesehen hat. Jedes Großhirnneuron ist mit etwa 1.000 anderen Nervenzellen verbunden. Jedes Neuron besitzt zwischen 10.000 und 1.000.000 Ionenkanäle (etwa 50 Kanaltypen), die für die Funktion wesentlich sind. Ein Kanal besteht aus einem Protein oder mehreren Proteinuntereinheiten (Quartärstruktur).
Um die Gehirnfunktion zu erschließen, müsste man die Art der Verknüpfungen und Verrechnungen dieses menschlichen Gehirns bestimmen (Schaltplan) und die Aktivität aller Neuronen messen und die Ergebnisse in Echtzeit verrechnen. Für kleine Neuronenverbände ist das möglich; für sehr große ist es theoretisch, aber nicht praktisch durchführbar. Es gibt also prinzipiell eine Lösung, die aber nicht praktikabel ist, weil das Großhirn dabei stirbt. Es gibt eine "Unschärfe": Wird gemessen, ist das Gehirn tot und die Berechnung zur Voraussage nutzlos. Ohne Messungen ist das Gehirn "glücklich", aber rätselhaft.
Man nimmt an, dass Sprache bei allen Menschen eine emergente Eigenschaft des Gehirns ist; wie sie zustande kommt und wie der Sprechapart gesteuert wird, ist noch unklar.
Es wäre gut vorstellbar, dass ein individuelles Gehirn auch in gewissen Grenzen individuelle Emergenzen aufweist, die dann eine besondere Neigung im Musikgeschmack, der Vorliebe für Poesie usw. oder dem mathematischen Verständnis zur Folge haben. Die geistigen Fähigkeiten sind sicher ein Produkt des Gehirns - der Zusammenhang ist aber unklar. Es wäre denkbar (nach Thomas Nagel zitiert in Tim Crane), dass wir in der Position eines alten Griechen sind, der sagt, dass die Materie Energie sei. Er behauptete das Richtige, erfasste aber den Tatbestand nicht.
Manche Computerspezialisten erhoffen (andere befürchten es) sich auch im Bereich der Software in Verbindung mit den steigenden Rechnerkapazitäten eine Art von Emergenz: die Singularität, ein Entwicklungsstadium von Maschinen, das die Fähigkeit des Menschen übertrifft.
System 1 und System 2
Das menschliche Gehirn kann in zwei Modi arbeiten; es kann System 1 oder System 2 benutzen.
Analysen von Daniel Kahnemann und anderen Forschern führten zur Unterscheidung der beiden Systeme, die schnelles und langsames Denken zur Folge haben.
Gerald Hüther weist darauf hin, dass es durch frühkindliche Erfahrungen dazu kommen kann, dass nur ein System benutzt wird.
Dabei handelt es sich um zwei extreme Einstellungen. Einmal um Menschen, die so sehr von Emotionen beherrscht werden, dass sie rationalen Argumenten kaum zugänglich sind. Sie entscheiden rein intuitiv.
Den anderen Pol bilden Personen, die aufgrund früher Erfahrungen und daraus abgeleiteten Überzeugungen, sich alleine von ihren kognitiven Fähigkeiten leiten lassen.
In einem ersten Schritt ist es wichtig, die beiden "Betriebssysteme" zu kennen und zu wissen, wann man sie einsetzten muss. Der zweite Schritt ist dann, durch Selbststeuerung die beiden Systeme in Balance zu halten. Das kann in der Praxis sehr schwierig sein, weil das Bauchgefühl als bottom-up arbeitendes Triebsystem in seiner Reaktion sehr schnell ist. Der Verstand (top-down System), der bremsen und abwägen kann, arbeitet deutlich langsamer.
In einem Artikel weist Ralf Konersmann darauf hin, dass Hans Blumenberg den Mythos als eine Form der Welterklärung aufgefasst hat, die die Überlebenschancen erhöhte.
Der Überlebenswert von System 1 mit seiner geringen "Latenzzeit" war am Anfang der menschlichen Evolution sicher von Vorteil; bei Entscheidungen in komplexen Situationen ist es aber ratsam, auch System 2 zu nutzen.
Das Problem ist, dass man nicht gleichzeitig System 1 und System 2 benutzen kann; das ist nur seriell möglich. Die Ergebnisse können auch nicht einfach verrechnet werden, da die "Einheiten" zu verschieden, ja unbekannt sind. Es bleibt immer ein Dilemma. Das macht das Leben spannend.
System 2 benötigt Ruhe und Zeit; es muss Wissen aktiviert und verknüpft werden, es kann sein, dass man Papier und Bleistift benötigt, fehlende Informationen müssen eingeholt werden ...
Liest man mit System 2, so ist das zeitaufwendiges "tiefes" Lesen im Gegensatz zu einem bloß informierenden Lesen.
Bei Problemlösungsstrategien sollte immer wieder auf die Benutzung von S1 und S2 und die Notwendigkeit ihres Zusammenwirkens eingegangen werden. Wie die folgende Typisierung des Lernens verdeutlicht, ist die Schule S2-lastig. Da für guten Unterricht aber auch Motivation und Empathie nötig sind, muss die Lehrkraft die Stunde gut planen.
Typisierung des Lernens
In der Schule wird gelernt. Aber was und wie? Welches Lernen ist gemeint?
Die Tabelle wurde in Anlehnung an Gregory Bateson und Maren Lehmann zusammengestellt und weiterentwickelt.
Die farbigen Markierungen machen deutlich, dass eine logische Typisierung zugrunde liegt.
Die Beispiele wurden nach formalen Gesichtspunkten ausgewählt – sie sind unterschiedlich bedeutend.
Kurze Zusammenfassungen zu der Tabelle
Lernen null
Auf eine einfache Informationsaufnahme von einem äußeren Ereignis folgt, dass ein ähnliches Ereignis zu einem späteren (und geeigneten) Zeitpunkt dieselbe Information übermittelt: Ich „lerne“ von der Werkssirene, dass es zwölf Uhr ist.
Das Lebewesen zeigt allenfalls eine minimale Veränderung in seiner Reaktion auf eine wiederholte Einheit der sensorischen Eingabe. Danach bleiben das Verhalten und auch die Umwelt unveränderlich (deshalb die Bezeichnung „Lernen null“). Es gibt keine Berichtigung durch Versuch und Irrtum.
Das Lebewesen merkt sich etwas.
Lernen I
In diesen Fällen kann eine Veränderung im „Lernen null“ stattfinden. Das Lebewesen zeigt zum Zeitpunkt 2 eine andere Reaktion als zum Zeitpunkt 1. Der Verhaltensauslöser ändert sich, der Kontext (die Situation) bleibt gleich.
Das Lebewesen hat sich an etwas gewöhnt. Das Lebewesen wurde konditioniert.
Lernen II
Bateson spricht von Lernen II, wenn sich sowohl das Verhalten als auch der Kontext ändern. Ein Transfer ist den Schülern nur möglich, wenn die Wissensbasis ausreichend groß ist und diese Lösungsstrategie immer wieder eingeübt wurde.
Beim problemlösenden Denken werden Prinzipien und Regeln (Gesetze) vorausgesetzt, die durch Begriffe, die Unterscheidungen von Merkmalen ermöglichen, beschrieben sind. Das Besondere des Problems muss einer der allgemeinen Regeln zugeordnet werden. Da der Problemfall aber kein Etikett trägt, muss mit Argumenten gezeigt werden, worum es sich im vorliegenden Fall handelt. Das ist eine Interpretationsleistung, da die Naturgesetze abstrakt formuliert sind und die Beobachtungen, auf die sie zurückgehen, in ihnen nicht vorkommen. Claus Giel
Lernen III
Dieses Lernen ist selten. Die Sichtweise (Paradigma) auf die Dinge wird in Frage gestellt und umgeworfen. Der neue Blick ist ungewohnt und kann der Anfang einer neuen Interpretationsweise sein. Oft müssen für die neue Anschauung Widerstände überwunden werden: Alfred Wegener – Kontinentaldrift oder Daniel Shechtman – Entdeckung der Quasikristalle.
Ansätze zu Lernen III findet man manchmal bei ganz kleinen Kindern, die noch nicht „in Schubladen“ denken und dadurch auf originelle Ideen kommen. Ähnlich könnte es auch bei Einfällen sein, die „im Schlaf kommen“ – das Gehirn verbindet dann Gebiete, die im wachen Zustand getrennt sind.
Kreatives Denken kann man nicht erzwingen; man kann aber die Bedingungen dafür schaffen. Einmal muss die Unterrichtsstunde so geplant werden, dass entsprechende Probleme sich stellen und dann muss man Zeit geben. Die Phase des divergenten Denkens, die Material für die Lösung aufbereiten soll, benötigt auch wieder Basiswissen und eine Kenntnis der Grundprinzipien des Fachgebietes. Der "Geistesblitz" (konvergentes Denken) zielt dann auf die präzise Antwort.
Viele Bildungspläne für Biologie sind so angelegt, dass sie Lernen II und Lernen III gar nicht verlangen, es aber auch nicht ermöglichen.
Sprachfunktionen
Intersubjektiver Austausch beim Menschen erfolgt über Mimik, Gesten und Sprache. Es folgt eine Definition der menschlichen Sprache, die auf Karl Popper (1984) zurückgeht.
Die menschliche Sprache dient dem Ausdruck, der Kommunikation und der Darstellung von Sachverhalten. Die vierte, die argumentative Funktion ist die wichtigste; sie erlaubt, die Darstellung der Sachverhalte und unsere Theorien kritisch zu überprüfen.
Die Welten
Die Vorstellungen von WELT 1, WELT 2 und WELT 3 gehen auf Karl Popper und in geringerem Maß auf John Eccles (englische Erstauflage 1977) zurück. Inzwischen wird die Sichtweise "Neuer Realismus" (Markus Gabriel, 2013) genannt. - "Belesenheit schützt vor Neuentdeckungen".
Beschreibungen der Welten
WELT 1 ("Leib")
Phänomene - Aussehen und Verhalten - real, messbar
anorganische Welt: Weltall, Welt, Elemente - Materie und Energie
Struktur und Funktion aller Lebewesen
Produkte der Gedankenwelt des Menschen
Bauwerke, Technik, Geräte, Werkzeuge
Kunstwerke, Musik, Bücher, Dokumente
Kleider, Moden
Münzen
WELT 2 (Geist, "Seele")
Bewusstsein, Wahrnehmung, Gedankenwelt des Individuums, Absichten, kreative Vorstellungen, Erinnerungen, Deutungen, Planung von Handlungen
Emotionen: Zuneigung, Liebe, Angst, Wut, Schmerz
Träume
WELT 3 ("Ideen")
gedankliche Leistungen der Individuen, die zu objektivem, überindividuellem Wissen werden, geteilte Weltsichten
objektive Wissenschaften, "Sätze an sich": begründet Argumentieren, Kritik, Theorien, technische Anwendungen - Geistes- und Naturwissenschaften
individuelle Kunst - kreative Vorstellungen (subjektiv), Kultur
Wertesysteme - soziales Zusammenleben, Tradition, Glaube
Die Aufteilung der Welten geben eine klare Vorstellung von den "Baustellen" - sie müssen nun erfasst werden. Es bestehen vielfältige Beziehungen, auch Überschneidungen zwischen den drei Welten. Keine der Welten ist statisch.
Untersuchung der Welten
Einheit entsteht durch rückgekoppelte Interaktionen
WELT 1 - eine Welt aller Lebewesen, dynamisch, Entwicklung der Erde, Evolution der Lebewesen, Welt der "nackten" Tatsachen (Phänomene - physische Gegenstände und Zustände), die durch (Mess-) Daten erfasst werden können.
WELT 2 - individuell → jeder Mensch und Vertreter einiger Tiergruppen besitzen eine eigene WELT 2, "die" subjektive WELT 2 gibt es in Milliarden Ausführungen, die Informationen führen zu Interpretationen (Bewusstseinszuständen), die nur teilweise zutreffend sind. Korrelationen können bedeutend sein (Vorhersagen ohne Verstehen), sie können aber auch Zufall sein.
Das menschliche Gehirn arbeitet automatisch in System 1; System 2 muss bewusst aktiviert werden.
WELT 3 - jeder Mensch kennt / anerkennt nur einen Ausschnitt aus der umfangreichen Gedankenwelt (Wissen im objektiven Sinn), Dynamik durch Weiterentwicklung, kritische Prüfung, neue Ideen
kulturelle Evolution
Religionen, Geistes-, Naturwissenschaften, Kunst
Die durch Sprache und Schrift tradierte WELT 3 hat eine starke Wagenheberfunktion - kein Wissen geht verloren.
Nur diese skizzierte Einheit ermöglicht die Bewältigung des alltäglichen Lebens, ein Verstehen auf der Grundlage von Wissen und den Entwurf eines Lebensplans. Wir (WELT 2) blicken mit unseren Deutungs- und Erklärungsmodellen (WELT 3) auf die "Realität" (WELT 1) - man könnte von einem modellabhängigem Realismus (Leonard Mlodinow) sprechen. Die Modelle gelten nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Gibt es mehr als ein anerkanntes Modell (z. B. Dualismus des Lichts), so gibt es zwei Wirklichkeiten.
Sprachfunktionen und Interaktionen sind die Grundlage zur Erfassung / Konstruktion der Welten. Für die Planung von Handlungen wäre eine zutreffende Erfassung und Deutung und damit ein Verständnis vorteilhaft, weil so in einem bestimmten Umfang Voraussagen möglich wären.
Kommunikation
Menschen können über die physikalische Welt, ihre Innenwelt und über ihre soziale Welt kommunizieren. Nach dem Blick auf das menschliche Gehirn muss man sich fragen, auf welcher Grundlage solche zwischenmenschlichen Gespräche stattfinden können und wie glaubhaft die ausgetauschten Mitteilungen sind.
Als Orientierung dient die folgende Tabelle in Anlehnung an Jürgen Habermas aus Detlef Horster.
Skizzen der wissenschaftlichen Welten
Überlegungen von Peter-André Alt, Lorraine Daston und Stefan Hildebrandt wurden einbezogen.
Intersubjektive Verständigung über die Welten
1. Erfahrungswahrheiten - die Welt der Naturwissenschaften
Schon 1660 (damals ging „Biologie“ noch in den Naturwissenschaften auf und war nicht als eigenes Gebiet abgegrenzt) gab es einen objektivierenden Ansatz für die Naturwissenschaften. Die neu gegründete „Royal Society of London for Improving Natural Knowledge“ folgte dem Grundsatz “NULLUS IN VERBA”.
„Improving Natural Knowledge“ bedeutet, dass sich zwei oder mehr Personen über einen naturwissenschaftlichen Tatbestand verständigen. Dabei ist zu fordern, dass für alle in den Beschreibungen benutzten Begriffe für jeden Menschen jederzeit im Einzelfall entscheidbar ist, ob sie zutreffen oder nicht (Fortschritt durch Dokumentation und Diskussion).
Das Wissenschaftsjournal "Philosophical Transactions" der Royal Society erschien 2015 im 350. Jahr.
Die Verständigung über Sinneseindrücke beschäftigte auch den jungen Max Born lange Zeit. Zur Lösung schlug er die folgende Methode vor.
Betrachten zwei Personen einen grünen Gegenstand, so ist nicht zu entscheiden, ob beide dasselbe Grün wahrnehmen. Bei zwei Eindrücken desselben Sinnesorganes ändert sich die Situation grundlegend. Betrachten beide zwei grüne Farbtafeln, so gibt es entscheidbare und objektiv prüfbare Aussagen, die auf dem Vergleich beruhen. Urteile über Gleichheit und Ungleichheit können zuverlässig verglichen werden. Beide können feststellen, dass ihnen z.B. das Grün zweier Blätter gleich erscheint.
Bei dem Gespräch zwischen Naturwissenschaftlern über den Vergleich geht es um Übereinstimmung; in der wissenschaftlichen Praxis um Messen: es werden Zeigerstellung von Messgeräten, die Ergebnisse von bildgebenden Verfahren usw. von den Wissenschaftlern verglichen.
Die in Fachzeitschriften veröffentlichten Versuchsergebnisse und ihre Deutungen werden oft von anderen wiederholt und damit überprüft. Mehr oder weniger schnell werden sie von der Wissenschaftsgemeinde anerkannt und können dann das allgemeine Wissen erweitern.
Als naturwissenschaftliche Tatsache ist sie keine Einzelmeinung mehr, sondern gemeinsames, mehrfach geprüftes Wissen der Gemeinschaft der Naturwissenschaftler.
Fragen nach Objektivität können nicht diskursiv behandelt werden, sondern werden mittels Beobachtung beantwortet.
Felix Mühlhölzer hat zur Prüfung und Bewertung naturwissenschaftlicher Theorien einige Kriterien zusammengestellt.
1. Einfachheit (Okhams Messer) und frei von inneren Widersprüchen
2. Theorien aus verschiedenen Gebieten passen zueinander (Evolutionstheorie, Stratigraphie, Isotopendatierung, Molekulargenetik / DNA)
3. Überprüfbarkeit durch Beobachtung und Experiment (Falsifikation / Popper)
4. Erklärungskraft in Bezug auf Phänomene der Erfahrungswelt, Voraussagemöglichkeit und Nutzbarkeit (Anwendungen - Molekularbiologie, Medizin)
2. Diskurse - die Welten der Nichtnaturwissenschaften
Die Geltungsansprüche von "Wahrheit" und Richtigkeit kann man im Diskurs prüfen.
Theorie des kommunikativen Handelns / Diskurs ↔ Sprache
nach Jürgen Habermas aus Detlef Horster
1. Die Beschreibung von Gründen verlangt eine Bewertung
2. Es ist eine Entscheidung darüber nötig, ob die Gründe stichhaltig sind
3. Der Interpret muss Stellung nehmen.
4. Die Stellungnahme ist nur mittels eigener Standards möglich
Wer Zeitungsberichte (Gentechnik, Impfschutz, ...) oder Talkshows verfolgt, erkennt, dass kommunikatives Handeln nicht leicht ist. Oft wird mit System 1 - Bauchgefühl "argumentiert", wo System 2 - Verstand gefragt ist. Behauptungen überwiegen, gut begründete Argumente sind selten. Sachargumenten stehen Wertungen gegenüber usw. - Infotainment eben.
Im täglichen Leben gibt es ein breites Spektrum der Diskursfähigkeit; problematisch sind die "Enden" des Kontinuums: Unfähigkeit (mangelndes Sprachvermögen + Dummheit) einerseits und geschulte, verlogene Lobbyisten andererseits (Firmen PR).
Keinem Vertreter der "Frankfurter Schule" ist es gelungen, Theorie und Praxis zu verbinden. Theodor W. Adorno ist tragisch gescheitert (68er Bewegung).
Auch Jürgen Habermas und Niklas Luhmann konnten ihre Meinungsverschiedenheiten nicht in einem Diskurs klären.
Eine erfolgreiche Übertragung auf politische Auseinandersetzungen hat nicht stattgefunden. Das liegt an dem unkritisch vorausgesetzten idealen Menschenbild und der naiven Annahme von der Überzeugungskraft des besseren Arguments.
Wichtigste Voraussetzung für Gespräche ist die großzügige Annahme auf beiden Seiten, dass der Andere auch recht haben könnte. Durch wechselseitige Kritik könnte erreicht werden, dass alle klarer sehen als zuvor und vielleicht ein Kompromiss angebahnt werden. Argumente werden kaum je eine Frage lösen, obwohl sie das einzige Mittel zum Lernen sind.
nach Karl R. Popper (2003)
Man sieht, dass Diskurse eingeübt werden müssen. Dabei sollte man daran denken, dass nicht immer alle Argumente genannt werden. Interessen, Motive, Absichten, Hintergedanken, Lüge, Täuschung, Betrugsabsichten, Profitgier spielen häufig auch eine Rolle. Außerdem sollte man immer bedenken, dass bewusst gelogen werden könnte.
Dann gibt es noch den manchmal tragischen Schulalltag mit gedankenlosen bis böswilligen Schülerinnen und Schülern. Zwei Erfahrungen aus meiner Referendarzeit: Ein Kollege hatte die Vorstellungen von Jürgen Habermas als reine Lehre verinnerlicht. Alles lässt sich diskursiv besprechen und klären. In der Mittelstufenklasse, die er zu unterrichten versuchte, kam er aber erst gar nicht zu Wort. Nach einer Woche hat er aufgegeben und gekündigt. Ein anderer Mitreferendar führte mit mir das folgende Gespräch: "Fliegen bei Dir auch Papierflieger im Unterricht?" "Ich habe noch keine bemerkt." "Bei mir brennen die manchmal."
Es gibt Dinge in der Unterrichtspraxis, die sich Philosophie- und Pädagogikprofessoren in ihrem Elfenbeinturm nicht vorstellen können oder einfach ignorieren.
Zusammenfassung:
Folgt man dem kritischen Rationalismus (Popper), so verzichtet man auf ein allgemeines Begründungsprinzip (absolute Wahrheit) und richtet sich an dem Prinzip der kritischen Prüfung (Fallibilismus) aus. Damit erhalten Probehandlung und Experiment einen hohen Stellenwert.
Daraus und aus den obigen Überlegungen (Tabellen) folgt, dass es "Wahrheit" in den Feldern der Wissenschaft in abgestufter Form gibt, sie immer eine Annäherung ist und sich aus vielen "Wahrheiten" (Aspekten) zusammensetzt. Es wäre besser, von einer Skala der Vernünftigkeit (Plausibilität, Sicherheit der Aussage) zu sprechen, auf der man die Ergebnisse bzw. Überzeugungen abtragen kann. Bei der Vernünftigkeit gibt es Abstufungen.
Die Freiheit des Individuums (Pluralismus) ist mit Verantwortung verbunden. Dieser Zusammenhang kann durch Einsicht (System 2) gewonnen werden. Damit wäre sie Teil der Kultur seiner selbst und erforderte Disziplin. Die Freiheit der anderen kann auch durch Staatsvertrag, durch Strafandrohung (Gesetze) oder durch Erfahrungen im sozialen Umfeld (TIT FOR TAT) gesichert werden.
Synthese
Das "Unbehagen", das die Romantiker oder Hans Blumenberg empfanden, bleibt erhalten und sollte Anlass zu einer Synthese sein.
Mythen boten nicht nur Erklärungen, sondern beinhalteten auch ein Wertegefüge, das Verhaltensvorschriften umfasste. Deutung und Normen bildeten eine Einheit - wenn man sich entsprechend verhielt, schleuderte Zeus keine Blitze.
Seit der Aufklärung gab es das "reine" Wissen, frei von Werten und Normen. Wahrheiten können grausam sein ("Kränkung" - Sigmund Freud), wenn sie Überzeugungen angreifen und zerstören. Wahrheit kann Befreiung und Zumutung sein.
Ein Mensch mit zwei Seiten (Natur und Kultur) muss ein Selbstbild erschaffen, das zwar Spannungen enthalten kann und an den Rändern vielleicht sogar etwas ausgefranst ist, aber für ihn ein geschlossenes BILD ergibt.
Dabei muss er mit einer Wissenssynthese den Bruch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften überwinden und die postmoderne Unverbindlichkeit durch Wertvorstellungen (Sinnsynthese) ersetzen. Es ist eine Balance erforderlich: wertegebundene Toleranz.
Man muss sich nicht für einen Pol, eine Sichtweise entscheiden, sondern sie als komplementär erkennen.
Hält der Mensch das entstandene BILD für sinnvoll, könnte es auch für seinem Leben Sinn (Macht, Prominenz, Wissen, Geld, flow, ...) geben.
Ein vergleichbares Problem der Komplementarität besteht bei der Natur des Lichtes. Hier gibt es auch ein "Sowohl als auch". Das Licht hat sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften - man kann es sich durch die Wahl des Experiments "aussuchen". Auch bei diesem Blick auf zwei Seiten hat man Schwierigkeiten bei der Verarbeitung, da man seine Vorstellung von festen Substanzen aufgeben muss.
Anhang: Bäume des Wissens
Verstehen und Wissen sind die Voraussetzungen für Problemlösungen im "Leben" in den Welten. Probleme werden durch Handlungen mit Zielvorstellungen (Interessen, Motivation) gelöst. In den Lösungsweg fließen Theorie- und Praxisanteile ein. Die Zielvorgabe und die Abläufe unterliegen Werturteilen.
In diesem Kapitel wurde versucht, ein System von Strukturen, Erkenntnismethoden (Theorie und Praxis) und Lösungsstrategien zu entwerfen, das eine zusammenhängende Grundlage für den gesamten Unterricht ist und die Übersicht sehr erleichtert.
Man versuchte immer wieder, das Wissen übersichtlich und einem Ordnungsschema entsprechend darzustellen.
Ein früher Versuch ist der "Baum des Wissens" (Arbor porphyriana ) der auf von Porphyrios von Tyros (geb. 234) entwickelte Kategorien zurückgeht und von Boëthius im 6. Jahrhundert erstmals als Baum dargestellt wurde.
Die Grundidee geht wahrscheinlich auf den Baum der Erkenntnis im Paradiesgarten (1. Mose 2, 9 ) zurück.
Weitere, ästhetisch ansprechende Beispiele und Hintergrundwissen in Steffen Siegel: Figuren der Ordnung um 1600.
Bekannt ist auch der Stammbaum des menschlichen Wissens, den Denis Diderot 1750 für den Prospekt der Encyclopédie entworfen hat (Anette Selg). In dem ersten Band gab es ein sehr übersichtliches "Figürlich dargestelltes System der Kenntnis des Menschen", das drei Bereiche der Welt unterschied, die aber alle vom Verstand (entendement) erfasst wurden.
Beachtenswert ist, dass unter der Rubrik "Naturgeschichte" in einem großen Abschnitt "Verwendung der Natur" Handwerke erfasst und dargestellt (Tafeln!) wurden.
Solche Übersichten sind interessant, ästhetisch ansprechend und können der Klärung der Gedanken dienen. Je größer die Datenflut ist, um so wichtiger ist ein Wissenssystem, in das man sie einordnen kann.
Die "Drohung des lebenslangen Lernens", die die permanente Ergänzung und Erneuerung des Wissens verlangt, kann dadurch wesentlich erleichtert werden.
Zu dem Überblick der Wissensgebiete gehört auch eine Über- bzw. Einsicht, wie die Wissenschaftler der einzelnen Gebiete "Evidenz" nachweisen, wie sie ihre Ansichten und Erkenntnisse belegen, wie sie Thesen begründen. Das würde nicht nur zu "Heureka!" (siehe Eva-Maria Engelen et al.), sondern auch zu echten Kompetenzen führen!
Literatur
Alt, Peter-André: Geisteswissenschaften sind keine Sozialwissenschaften, FAZ vom 30.08.2012
Bateson, Gregory: Ökologie des Geistes, Frankfurt1981
Born, Max: Symbol und Wirklichkeit in: Bähr, H. Walter (Hrsg.): Naturwissenschaft heute, Gütersloh 1965
Brockhaus, Der: Fremdwörter, Leipzig 1997
Crane, Tim über Geist und Körper in David Edmonds und Nigel Warburton: Philosophy Bites, Stuttgart 2013
Daston, Lorraine: Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in Otto Gerhard Oexle (Hrsg.): Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft, Göttingen 1998
v. Ditfurth, Hoimar: Einstein und die Amöbe in: Wir sind nicht nur von dieser Welt, Hamburg 1981
Engelen, Eva-Maria et al.: Heureka - Evidenzkriterien in den Wissenschaften, Heidelberg 2010
Gabriel, Markus: Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 2013
Giel, Claus: Heroische Leidenschaften, der blaue reiter 6, Stuttgart 1997
Hildebrandt, Stefan: Wahrheit und Wert mathematischer Erkenntnis, München 1995
Horster, Detlef: Jürgen Habermas zur Einführung, Hamburg 2001
Hüther, Gerald: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Göttingen 2010
Kahnemann, Daniel: Schnelles Denken, langsames Denken, München 2011
Die Darstellung in diesem Kapitel ist eine Umarbeitung und Erweiterung einer Vorlage aus
Alex Pentland: Social Physics, New York 2014,
die zurückgeht auf:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf
Konersmann, Ralf: Nichts als die Wahrheit, NZZ vom 25.03.2015
Lehmann, Maren: Theorie in Skizzen, Berlin 2010
Mühlhölzer, Felix: Wissenschaft, Stuttgart 2011
Penrose, Roger: Der Weg zur Wirklichkeit, Heidelberg 2010
Popper, Karl R. und Eccles, John C.: Das Ich und sein Gehirn, München 1982
Popper, Karl R.: Auf der Suche nach einer besseren Welt, München 1984
Popper, Karl: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd.II, Tübingen 2003
Selg, Anette und Wieland, Rainer: Die Welt der Encyclopédie, Frankfurt 2001
Siegel, Steffen: Figuren der Ordnung um 1600, Berlin 2009