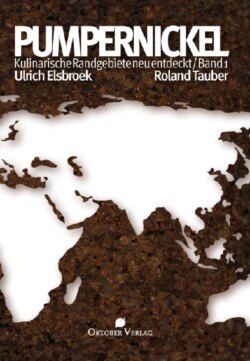Читать книгу Pumpernickel - Ulrich Elsbroek - Страница 10
H2 Ein hartes Brot. Herstellung
ОглавлениеSchmeichelt das Schwarzbrot auch heutzutage unseren Sinnen, die Herstellung des westfälischen Schwarzbrotes selbst hatte mit Genuss nicht das Geringste zu tun. Im Gegenteil, es war – zumindest in früheren Zeiten – ziemlich hartes Brot. War die Ernte eingebracht, musste das Getreide zu einer Mühle transportiert werden. Dabei waren bisweilen lange Strecken in Kauf zu nehmen. Bis weit ins 19. Jahrhundert befanden sich die Mühlen in den Händen des jeweiligen Landesfürsten. Und die waren vor allem daran interessiert, dass ihre mahlenden »Goldesel« ausgelastet waren. Da ging jede weitere Mühle, die über den tatsächlichen Bedarf hinaus gebaut wurde, nur zu Lasten des landesherrschaftlichen Portefeuilles. Lange Wegstrecken waren also das Ergebnis einer bewussten Verknappung der Mahlressourcen. Weil viele Bauern weder über Pferd und Wagen verfügten, mussten diese Wege nicht selten per pedes apostulorum und mit dem Sack auf der Handkarre absolviert werden. Doch oh Wunder: In aller Regel waren die Säcke nach dem Mahlen leichter als vor dem Mahlen. Einerseits gut, weil der Bauer so weniger zu schleppen hatte. Andererseits schmälerten sich so seine Möglichkeiten des Gelderwerbs. Denn diese »Leichterung« war die Folge der Naturalabgabe, die der Bauer sowohl an den Landesfürsten als auch an den Müller zu entrichten hatte. Ein weiterer unangenehmer, weil unberechenbarer Störfaktor konnte das Wetter sein. Ausbleibender Wind oder anhaltender Frost führte zu unangenehmen Wartezeiten, weil die Mühle ihr Werk nicht tun konnte. Zudem konnte der gute westfälische Landregen An- wie Abfahrt zu einem Abenteuer machen, weil die Wege tief und morastig wurden. Waren diese vielfältigen Hürden aber einmal genommen, und war der gute Landmann glücklich mit seiner Ware zuhause angekommen, konnte es endlich ans Backen gehen. Auch dies ein kraftraubendes Unterfangen.
Ein Teil des Roggenschrots wurde abends mit heißem Wasser vermengt, so dass es über Nacht aufquellen konnte. Hierfür benutzte man längliche Tröge mit Längen bis zu 4 m, die aus dicken Bohlen zusammengezimmert oder aus Baumstämmen geschlagen waren. Hinzu kam dann Sauerteig, der die Aufgabe hatte, die Gärung anzukurbeln und so den Brotteig aufzulockern. (Ohne diesen Zusatz wäre der Pumpernickel genau das, was man ihm ohnehin Jahrhunderte lang nachsagte: ein schwerer, nur schlecht verdaulicher Klumpen). Da dieser Prozess gut und gerne auch durch alte Teigreste in Gang kam, hat man darauf verzichtet, die Backtröge nach jeder Nutzung gründlich zu reinigen. Denn die darin anhaftenden Überbleibsel des Vorgängerteiges taten hier ihr blähendes Wunder. Die mangelnde Reinigung des Troges galt deshalb hierzulande auch nicht als Ausdruck von Schlampigkeit, sondern als eine gezielte Vorbereitung des nächsten Backganges. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Am nächsten Tage wurde der restliche Teil des Roggenschrotes hinzugegeben und miteinander vermengt. Nun müssen Sie sich vorstellen, dass dieser mit Wasser vollgesogene Roggenschrot sehr schwer war. Deshalb war das gründliche Durchkneten und -walken eine äußerst kräfteraubende Angelegenheit. Es sei denn, man bediente sich innovativer Ideen. So haben vornehmlich Männer den Teig – Stichwort »walken« – noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein mit den nackten Füßen bearbeitet. Eine erhebliche Erleichterung, weil ein wesentlicher Anteil der benötigten Kräfte durch die natürliche Schwerkraft des Körpers bereitgestellt wurde. Nachdem nach mehreren Bearbeitungsgängen die Homogenität des Teiges sichergestellt worden war, wurde er mit Hilfe eines spezielle Spatens – »Deegschüppe« oder »Deegstiäcke« genannt – aus dem Backtrog geholt, portioniert und in eine große, eckige Form geschlagen. Da lagen sie nun – echte »Kanten« mit einem Gardemaß von nicht selten einem halben Meter. Bernd, das Brot, lässt grüßen.
Nun kam der Teig in den Ofen. Aber stellen Sie sich bitte nicht eine handelsübliche Backröhre von Miele oder Siemens vor. Der Backofen des gemeinen Landmannes bestand bis ins 20. Jahrhundert aus einem simplen Hohlraum, der aus Backsteinen gemauert war. Funktionen wie Heißluft, Umluft, Grillen, Auftauen und Infrabraten gab es nicht. Dieser Hohlraum wurde zunächst mit Hilfe von Brennmaterial, wie z. B. Holz oder Torf, aufgeheizt. War die notwendige Hitze erreicht, wurden die Reste des Brennmaterials entfernt, danach der Ofen mit den Teiglingen bestückt. Hierfür nutze man einen Brotschieber, der allerdings mit den Teigspaten nicht zu verwechseln ist. Nun wurde die Ofenklappe vor die mundförmige Öffnung (das so genannte Mundloch) geklemmt und mit Hilfe von Lehm o. Ä. abgedichtet. Das Ziel war, dass so wenig Hitze wie möglich verloren ging. Dieses Setting hatte enorme Konsequenzen auf das Endprodukt. Denn dadurch wurde gleichzeitig der Luftaustausch mit der Außenluft verhindert. Die Folge: Die Feuchtigkeit, die durch die hohen Temperaturen aus dem Teig herausgetrieben wurde, konnte nicht entweichen, sondern verblieb im Ofen. Hinzu kam, dass die Temperatur nicht höher als 100° C war. Das bewirkte, dass die Brote in dem eher feucht-warmen Tropenklima weniger buken als garten. Dieses lange Garen im eigenen Dunst, das nicht selten bis zu 24 Stunden dauerte, bewirkte, dass die Mehlstärke sich in Zucker verwandelte, der daraufhin karamellisierte und für die dunkle Einfärbung des Brotes sorgte. Das Backen des Pumpernickels war also ein äußerst komplexer, anspruchsvoller Prozess.
Bereits die frühesten Öfen waren freistehend. Der Grund lag darin, dass im Falle eines Brandes das Feuer nicht auf die umliegenden Gebäude übergreifen konnte. Das Ofengewölbe dieses frühen Typs wurde auf einem Sandfundament gelagert und dann oberhalb mit einer dicken Lehmpackung und einer Schicht aus Grasplaggen bepackt. Nicht selten wurde der Ofen zudem mit einem Satteldach versehen, damit er vor Regen geschützt war. Im 16. Jahrhundert wurde der Ofen zunehmend im Rahmen eines Gebäudes realisiert: dem Backhaus. Es ermöglichte den Bauern, unabhängig vom Wetter zu arbeiten. Zudem wurde der Dachboden als Speicher benutzt. Der Backofen war in der Regel an den Hintergiebel angebaut und wurde von innen beschickt. Auch dieser Typ befand sich aus Gründen der Feuergefährlichkeit fernab der Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Eine besondere Erwähnung verdient die spezielle Form der Lüftung. Denn Kamine, durch die die Düfte und Rauchgase abgeführt werden konnten, waren in früher Zeit noch unbekannt. Ihre Funktion übernahm bis auf weiteres die Backhaus-Tür. »Aus diesem Grund war sie meistens in der Mitte quergeteilt: Stand die obere Hälfte offen, so konnte der Rauch abziehen, während dem auf dem Hofgelände frei herumlaufenden Vieh gleichzeitig der Weg zu den verlockenden Brotdüften versperrt war«. Erst nach und nach wurden die Backöfen mit Rauchabzügen versehen. Man sieht also, dass der Trend zum Hi-Tech-Ofenbau ungebrochen war. Und ein Ende des Fortschritts war nicht in Sicht. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wechselte das Backen des täglichen Brotesc vom Bauernhaus auf professionelle Bäckereien über. Damit »verschwand das Westfälische Schwarzbrot als Alltagsspeise vom Tisch der ländlichen Bevölkerung. Dafür fand es, nun in verfeinerter Form von Brotfabriken hergestellt und in Delikatessenläden und Konditoreien angeboten, überraschenderweise seine Liebhaber weit über Westfalens Grenze hinaus.«
»Pumpernickel kann man essen oder auch lesen. Als Einblick in vergangenes münsterländisches Leben sehr empfehlenswert: ›Weihrauch und Pumpernickel‹ von Otto Jägersberg.«
Jürgen Kehrer,
Autor der Wilsberg-Krimis