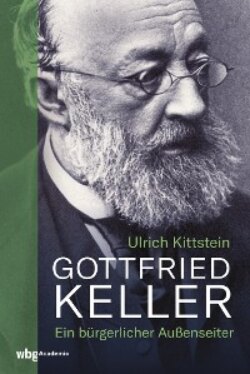Читать книгу Gottfried Keller - Ulrich Kittstein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lob des Sehens
ОглавлениеGegen Ende seines Aufenthaltes in der deutschen Residenzstadt nimmt Heinrich Lee, dessen reguläre Schullaufbahn (wie die seines Schöpfers Gottfried Keller) einst ein frühes und unrühmliches Ende gefunden hat, die Gelegenheit wahr, wenigstens einige seiner Bildungslücken zu schließen, indem er als Gasthörer Vorlesungen an der Universität besucht. Bevor er von der unbezähmbaren Neugier auch in die Gefilde der Rechtswissenschaft und der Geschichte geführt wird, befasst er sich eingehend mit Anthropologie, wobei ihn anfangs noch die Hoffnung leitet, daraus Nutzen für die zeichnerische Darstellung menschlicher Figuren zu ziehen. Die Freude am Wissenserwerb um seiner selbst willen, an der „bloßen Erkenntniß“ (12, S. 230), drängt dieses pragmatische Ziel jedoch bald in den Hintergrund.
Anregungen für das betreffende Kapitel im Grünen Heinrich verdankte Keller den Vorlesungen des Physiologen und Anatomen Jakob Henle, die er in Heidelberg gehört hatte und die, wie er damals feststellte, „dem Feuerbach bedeutend in die Hände“ arbeiteten (GB 1, S. 276), weil sie „die beste Grundlage oder vielmehr Einleitung“ zu dessen Unterricht über den Menschen und die Natur abgaben (GB 2, S. 458). Ebenso wichtig waren ihm die Thesen des gleichfalls in Heidelberg lehrenden Jakob Moleschott: „Beide Physiologie-Dozenten sind in der Romanfigur des einen ‚Lehrers‘ kontaminiert“29, dessen Stunden der Protagonist regelmäßig besucht. Und auch für Heinrich führt der Weg von der wissenschaftlichen Physiologie zur anthropologisch ausgerichteten Philosophie. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt durchaus noch an Gott glaubt, muten seine akademischen Studien wie eine Vorschule zu jenen reiferen weltanschaulichen Grundsätzen an, die er sich später unter Dorotheas Einfluss aneignen wird. Zwar versteht er die erhellenden Ausführungen über die „wunderbar scheinende Zweckmäßigkeit in den Einzelheiten des thierischen Organismus“ zunächst ganz im Sinne der altehrwürdigen Physikotheologie als einen schlagenden „Beweis […] von der Scharfsinnigkeit und Geschicklichkeit Gottes“ (12, S. 233), doch der Professor weiß alle voreiligen Schlussfolgerungen zu unterbinden:
[N]achdem der kluge Lehrer die Trefflichkeit und Unentbehrlichkeit der Dinge auf das Schönste geschildert, ließ er sie unvermerkt in sich selbst ruhen und so vollkommen in einander aufgehen, daß die ausschweifenden Schöpfergedanken eben so unvermerkt zurückkehrten und in den geschlossenen Kreis der Thatsachen gebannt blieben, welche jener Schlange der Ewigkeit gleicht, die sich selbst in den Schwanz beißt. (S. 234)
So lernt Heinrich, die irdische Natur und die einzelnen Organismen in ihrer „Folgerichtigkeit und Einheit“ (S. 234) als eine autonome Ordnung komplexer Funktionszusammenhänge zu betrachten und die „innere Nothwendigkeit, Identität und Selbständigkeit der natürlichen Dinge“ zu bewundern, während er „seinen Glauben an Gott und Unsterblichkeit“ vorläufig beiseite setzt (S. 239). Emphatisch proklamiert der Erzähler die heilsame Beschränkung des menschlichen Denkens und Forschens auf den weltimmanenten Kreis des Natürlichen, auf die „Kenntniß vom Charakteristischen und Wesentlichen der Dinge“ (S. 236), die vortrefflich geeignet sei, metaphysischen Spekulationen den Boden zu entziehen und eine Haltung einzuüben, die schon ganz feuerbachianisch wirkt: „Wo bleibt da noch eine Unruhe, ein zweifelhaftes Sehnen nach einer unbegriffenen Ewigkeit, wenn wir sehen, daß Alles entsteht und vergeht, sein Dasein abmißt nach einander und doch wieder zumal ist“ (S. 237).
Während Moleschott das menschliche Denken radikal auf stoffliche Grundlagen zurückführte und einen absoluten Determinismus postulierte, verfolgt der Roman eine Linie, die Feuerbachs ganzheitlicher Philosophie verpflichtet ist. Obwohl man sich den Geist nicht in idealistischer Manier ohne materielles Fundament vorstellen dürfe, könne er doch auch wiederum nicht darauf reduziert werden:
Denn der Geist, welchen die Materie die Macht hat in sich zu halten, hat seinerseits die Kraft, in seinen Organen dieselbe zu modificiren und zu veredeln, Alles mit ‚natürlichen Dingen‘, und jeder Lebende, der mit Vernunft lebt und insofern er sich fortpflanzt oder erhebliche Geistesthaten übt, hat im strengsten Sinne des Wortes seinen bestimmten Antheil z.B. an der Ausbildung und Vergeistigung des menschlichen Gehirnes, seinen ganz persönlichen, wenn auch unmeßbaren Antheil. (S. 238)
Mit dieser Dialektik von Stoff und Geist verteidigt Keller die Möglichkeit einer humanen Bildung und einer vernünftigen menschlichen Selbstbestimmung. Demselben Zweck dient Heinrichs Rechtfertigung des freien Willens, den sein im Übrigen so kluger und duldsamer akademischer Lehrer mit ungewohnter Hartnäckigkeit leugnet, womit er der „unglücklichen Neigung vieler, selbst ausgezeichneter Naturalisten“ erliegt, „auch an ungehöriger Stelle die Materie auf abstoßende und ganz überflüssige Weise zu betonen“, statt die „moralische Frucht“, die aus ihr hervorgeht, in ihrem Eigenwert anzuerkennen (S. 246f.). Ein „absoluter rationalistischer freier Wille“ kommt Heinrich zwar nicht mehr plausibel vor, weil er dafür im Laufe seiner Studien „schon zu viel Aufmerksamkeit und Achtung für das Leibhafte und dessen gesetzliche Macht erworben“ hat, doch er ist überzeugt, „daß innerhalb des ununterbrochenen organischen Verhaltens, der darin eingeschachtelten Reihenfolge der Eindrücke, Erfahrungen und Vorstellungen, zuinnerst der moralische Fruchtkern eines freien Willens keime zum emporstrebenden Baume, dessen Aeste gleichwohl wieder sich zum Grunde hinabbögen, dem sie entsprossen, um dort unablässig auf ’s Neue Wurzeln zu schlagen“ (S. 248). Der Wille des geistig gereiften Individuums gleiche einem geübten Reiter, der mit seinem Pferd, dem „besondere[n], immer noch materielle[n] Organ“ seines Leibes, auf dem unebenen Boden der rauhen Wirklichkeit unterwegs ist, oder auch einem Steuermann oder Schwimmer, der trotz aller äußeren Widrigkeiten „nach bestem Vermögen sein vorgenommenes Ziel zu erreichen“ sucht (S. 249f.). Innere Freiheit ist für den Menschen mithin nur zu erlangen, wenn er sich die natürlichstoffliche Bedingtheit seines Daseins bewusst macht, ohne ihr aber fatalistisch zu erliegen.
Eine Weltanschauung, die auf jede metaphysische Sinnstiftung verzichtet, läuft Gefahr, den Kosmos einer seelenlosen Mechanik oder dem puren Zufall auszuliefern. Wenn Keller die Natursphäre als eine höchst zweckmäßig eingerichtete „große Oekonomie des Weltlebens“ (S. 238) schildert, versucht er, genau dieser Bedrohung entgegenzuwirken. Die Natur wird zwar nicht etwa ihrerseits in pantheistischer Manier vergöttlicht, doch sie erscheint als ein Reich immanenter Vollendung, in dem überall Ordnung und Schönheit herrschen, und liefert dem Menschen damit ein Vorbild für die Gestaltung seines eigenen Lebens. Rühmt der Erzähler im Grünen Heinrich die „gute Natur“ und das „nothwendige und gesetzliche Wachsthum der Dinge“ (S. 119f.), so verweist der Maler Römer, Heinrichs einziger echter Lehrer auf dem Feld der bildenden Kunst, seinem Schützling jeden willkürlichen Zug beim Zeichnen mit den Worten: „Die Natur ist vernünftig und zuverlässig“ (S. 33). Und bei allen Mängeln, die ihm sonst anhaften mögen: Auf diesem Gebiet ist Römer eine Autorität.
Unter den Sinnen, die dem Menschen einen Zugang zur Natur gewähren, spielte der visuelle für Keller die wichtigste Rolle. Wenn der Erzähler die Ergebnisse von Heinrichs akademischen Studien referiert, schiebt er einen förmlichen Hymnus auf das Licht und das Auge ein:
Das Licht hat aber den Sehnerv gereift und ihn mit der Blume des Auges gekrönt, gleich wie die Sonne die Knospen der Pflanzen erschließt […]. Das Licht hat den Gesichtssinn hervorgerufen, die Erfahrung ist die Blüthe des Gesichtssinnes und ihre Frucht ist der selbstbewußte Geist; durch diesen aber gestaltet sich das Körperliche selbst um, bildet sich aus, und das Licht kehrt in sich selber zurück aus dem von Geist strahlenden Auge. (12, S. 237f.)
Das Credo einer sensualistischen Anthropologie und Erkenntnislehre! Das Bewusstsein ist kein Produkt der rein innerlichen Reflexion, es erwächst vielmehr aus der empirischen Begegnung mit der natürlichen Welt, aus den sinnlichen Wahrnehmungen und den von ihnen gespeisten Erfahrungen, aus denen sich schließlich ein „Geist“ bildet, der wiederum auf die materielle Wirklichkeit zurückwirken kann. Im geistbegabten Menschen gelangt die Natur zu sich selbst, indem sie sich mit Vernunft anschaut, und diese Vernunft entwickelt sich weiter fort in der unablässigen Wechselwirkung, im „Kreislauf “ (S. 238) zwischen der Natur und dem geistig-sinnlichen Menschengeschlecht. Ähnlich argumentiert Feuerbach, der das Selbst-Bewusstsein ebenfalls aus der Wahrnehmung ableitet und in einem vom Geist durchdrungenen Schauen jenes Vermögen erblickt, das den Menschen vom Tier unterscheidet: „Das Auge ist himmlischer Natur.“30
Der Dichter und der Philosoph unterstellen also eine buchstäblich organische Verbundenheit des erkennenden Subjekts mit der natürlichen Welt, die es umgibt. In dieser Denkfigur wurzelt auch der epistemologische Optimismus, von dem die einschlägigen Passagen des Grünen Heinrich zeugen. Wie Feuerbach traut Keller der an die Sinnentätigkeit geknüpften menschlichen Erkenntnis prinzipiell zu, die Realität richtig zu erfassen und zu zweifelsfrei wahren Einsichten zu gelangen. Heinrich Lee, der über eine rege Phantasie verfügt, übersetzt das an der Universität erworbene Wissen „sogleich in ausdrucksvolle poetische Vorstellungen“, indem er sich beispielsweise „die beiden Systeme des Blutkreislaufes und der Nerven mit dem Gehirne“ als „plastische Charakterwesen“ imaginiert. Der Erzähler beeilt sich jedoch zu versichern, dass diese „Vorstellungen […] aus dem Wesen des Gegenstandes hervorgingen und mit demselben Eines waren, so daß, wenn er damit hantirte, er die allerschönsten Symbole besaß, die in Wirklichkeit und ohne Auslegerei die Sache selbst waren“ (12, S. 241f.). Mit anderen Worten: Wenn der Mensch seine Sinne zu benutzen weiß und sich nichts vormacht, kann er in der Sphäre seiner Gedanken durchaus ein korrektes geistiges Abbild der äußeren Realität schaffen.
Kellers Überlegungen zum sinnlichen Weltverhältnis des menschlichen Individuums wurden aber nicht allein von Feuerbach inspiriert. Man vergleiche nur folgenden Passus aus Goethes Einleitung zum didaktischen Teil seiner Farbenlehre mit dem oben zitierten Abschnitt des Grünen Heinrich: „Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen tierischen Hülfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem äußeren entgegentrete.“31 Tatsächlich war der Poet und Naturforscher Goethe neben dem Philosophen und Anthropologen Feuerbach der zweite wichtige Gewährsmann für Kellers enthusiastische Hinwendung zur sichtbaren irdischen Natur. Nach der Überzeugung des Schweizer Dichters verstand Goethe die Wirklichkeit in musterhafter Weise „als sinnerfüllte, eigengesetzliche, organische Ganzheit, deren Zentrum die schöne, harmonische, einfache, klare, notwendige und ruhige, somit verständlicherweise Diesseitsfreude evozierende Natur bildet.“32 Der junge Heinrich Lee erwirbt denn auch erst durch seine intensive Goethe-Lektüre jene „hingebende Liebe an [!] alles Gewordene und Bestehende, welche das Recht und die Bedeutung jeglichen Dinges ehrt und den Zusammenhang und die Tiefe der Welt empfindet“ (12, S. 16) – eine Liebe, die später durch die Vorlesungen an der Universität ein systematisch begründetes wissenschaftliches Fundament erhält.
Das Entzücken über die Schönheit der Welt, wie sie sich den Sinnen und zumal dem Auge darbietet, begegnet bei Keller allenthalben. Diesem Sensualismus verdanken sich die vielgerühmte Plastizität und Farbigkeit seines Stils, die Fülle und Sättigung seiner erzählten Welten und der lichte Glanz, den er über so viele Figuren, Szenen und Landschaften ausgießt. Bezeichnenderweise widmete er auch einen der wenigen Aufsätze, in denen er sich allgemeiner zu ästhetischen Fragen äußerte, einem Phänomen aus dem Bereich des Lichts und der Farben, nämlich die kleine Schrift Das goldene Grün bei Goethe und Schiller, die vermeintliche Missgriffe der beiden Klassiker auf dem Gebiet der Farbmetaphorik zu rechtfertigen sucht. Und noch in späten Jahren hielt Keller an seinem poetischen Lob der Sinnlichkeit fest, indem er das Licht und das Sehen als die Medien eines wahrhaft humanen Weltbezugs feierte. Zwei Textbeispiele, ein episches und ein lyrisches, seien hier vorgestellt.
Im ersten Kapitel des Sinngedichts tritt ein junger Naturforscher auf, der das Licht auf eine ganz eigentümliche Art behandelt. Herr Reinhart ist mit anspruchsvollen optischen Experimenten befasst: „In der Mitte des Zimmers stand ein sinnreicher Apparat, allwo ein Sonnenstrahl eingefangen und durch einen Krystallkörper geleitet wurde, um sein Verhalten in demselben zu zeigen und womöglich das innerste Geheimnis solcher durchsichtigen Bauwerke zu beleuchten“. Eine derartige Untersuchung der Natur des Lichts erfordert es aber paradoxerweise, das Licht selbst zum größten Teil auszusperren und damit auch die „schöne Welt mit allem, was draußen lebte und webte“. Reinhart lässt „nur einen einzigen Lichtstrahl in den verdunkelten Raum durch ein kleines Löchlein, das er in den Laden gebohrt hatte“, und dieser Strahl wird sodann mittels der erwähnten Vorrichtung „sorgfältig auf die Tortur gespannt“ (7, S. 10).
Die Skepsis des Erzählers gegenüber Reinharts Verfahren ist deutlich zu spüren. Im Grünen Heinrich hatte Keller anhand der akademischen Studien des Helden sein Ideal von Naturforschung entworfen. Während aber die Anthropologie, die der Professor dort vorträgt, auf den organischen Zusammenhang der ganzen, lebendig sich entwickelnden Natur zielt, der nicht zuletzt auch den Menschen einschließt, geht Reinhart streng analytisch-zergliedernd vor und zerstört methodisch die umfassende Einheit der „schönen Welt“, um ein Einzelphänomen künstlich zu isolieren. Am Ende soll eine Reduktion stehen, die „den unendlichen Reichtum der Erscheinungen unaufhaltsam auf eine einfachste Einheit zurückzuführen scheint, wo es heißt, im Anfang war die Kraft, oder so was“ (S. 12). Wieder ist der Spott des Erzählers nicht zu überhören. Die Formel „im Anfang war die Kraft“ spielt vielleicht ironisch auf Ludwig Büchners Bestseller Kraft und Stoff von 1855 an, der einen monistischen und rein mechanistischen Materialismus propagierte, zitiert aber auch Fausts fragwürdige Übersetzung des Johannes-Evangeliums.33 Übrigens wird Reinharts Zimmer mit seinen wissenschaftlichen Utensilien ausdrücklich als die modernisierte „Studierstube eines Doctor Fausten“ bezeichnet (S. 9), und in der Tat ist der junge Mann in dieser Klause ebenso vom sinnlich-unmittelbaren Erleben der Welt und der lichten Natur abgeschnitten wie Goethes Held in der seinen: „Weh! steck’ ich in dem Kerker noch?/Verfluchtes, dumpfes Mauerloch!/Wo selbst das liebe Himmelslicht/Trüb durch gemalte Scheiben bricht.“34
Das von Reinhart repräsentierte exakte, analytische, auf Experimenten basierende Wissenschaftsverständnis erlebte zu Kellers Zeiten bekanntlich einen Siegeszug ohnegleichen. Isaac Newton hatte ihm nicht zuletzt mit seinen optischen Versuchen die Bahn bereitet, und im frühen 19. Jahrhundert war Joseph Fraunhofer mit Spektralanalysen beschäftigt, die gleichfalls stark an Reinharts Versuchsanordnung erinnern. Kellers literarischer Protest gegen einen solchen Zugriff auf die Natur, der deren Inneres geradezu gewaltsam erschließen will, knüpft wieder an Goethe an, genauer: an dessen Fehde mit Newton, seinem Erzfeind auf dem Gebiet der Optik. Das Eingangskapitel des Sinngedichts liest sich so, als hätte Keller Goethes Newton-Kritik mit erzählerischen Mitteln in Szene setzen wollen. In seinen Experimenten habe der Engländer „die Natur auf die Folter“ gespannt, „um sie zu dem Bekenntnis dessen zu nötigen, was er schon vorher bei sich festgesetzt hatte“, klagt Goethe in der Farbenlehre35, und an anderer Stelle spricht er in Anspielung auf das verdunkelte Zimmer, in dem Newton – wie Reinhart – seine Versuche durchführte, von der „düstern empirisch-mechanisch-dogmatischen Marterkammer“, aus der die „Phänomene“ endlich erlöst werden müssten.36 „Freunde flieht die dunkle Kammer/Wo man euch das Licht verzwickt“, rät eine der Zahmen Xenien und empfiehlt, lieber „an heitern Tagen“ die „Himmelsbläue“ zu betrachten, „der Natur die Ehre“ zu geben und damit „an Aug und Herz gesund“ zu werden.37
Den Gedanken, dass der Mensch mit Forschungen, wie Reinhart sie betreibt, nicht bloß der Vielfalt der Natur, sondern auch sich selbst Gewalt antue, greift Keller im Sinngedicht ebenfalls auf. Der Protagonist, der seit Jahren nur für die Wissenschaft lebt und sich dabei rückhaltlos der Funktionsweise seiner Apparate unterwirft, ist mittlerweile kaum noch mehr als ein Anhängsel dieser Gerätschaften und als Sinnenwesen geradezu verkrüppelt. Der „unaufhörliche Wechsel zwischen dem erleuchteten Krystall und der Dunkelheit“ hat bereits seine Sehkraft angegriffen, bis ihn schließlich akute Augenschmerzen zwingen, die Arbeit zu unterbrechen (S. 11) – der Körper begehrt gegen den fortgesetzten einseitigen Missbrauch seiner sinnlichen Vermögen auf. Die Krise erweist sich aber als heilsam, weil sie Reinhart zur Besinnung bringt. Erst jetzt wird er der traurigen Beschränktheit seiner Existenz gewahr, in der er schon fast zu jenen lebendig Begrabenen zählt, die man aus Kellers früher Lyrik kennt: „er hatte sich vereinsamt und festgerannt, es blieb still und dunkel um ihn her“. In der „Besorgnis um seine Augen“ dämmert ihm plötzlich die Möglichkeit, ein gesünderes Verhältnis zur äußeren Welt einzunehmen, bei dem die Sinne nicht mehr im Dienste der Trennung, Auflösung und Vereinfachung stehen, sondern „die menschliche Gestalt“ als solche erfassen, „und zwar nicht in ihren zerlegbaren Bestandteilen, sondern als Ganzes, wie sie schön und lieblich anzusehen ist und wohllautende Worte hören lässt“. Zunehmend fasziniert von diesen Aussichten, beschließt Reinhart, dem Appell der Zahmen Xenien gemäß, aus seinem finsteren Kerker auszubrechen, „auf das durchsichtige Meer des Lebens hinauszufahren“ und sich endlich wieder „den halbvergessenen menschlichen Dingen“ zu nähern. Als ersten Schritt öffnet er die Fensterläden, „damit es hell würde“ (S. 12). Wie es danach weitergeht und wie Reinhart schließlich Heilung findet, wird später weiter zu verfolgen sein.
Noch bevor Keller das Sinngedicht abgeschlossen hatte, schrieb er 1879 auch ein lyrisches Gedicht über die Augen, das Licht und das Sehen. Die vier Strophen nötigten sogar dem strengen Kritiker Theodor Storm Bewunderung ab, der hier neidlos das „reinste Gold der Lyrik“ erkannte (GB 3.1, S. 441). Spätere Leser haben sich seinem Urteil angeschlossen: Bis heute zählt das Abendlied zu Kellers berühmtesten Gedichten.
Abendlied
Augen, meine lieben Fensterlein,
Gebt mir schon so lange holden Schein,
Lasset freundlich Bild um Bild herein:
Einmal werdet ihr verdunkelt sein!
Fallen einst die müden Lider zu,
Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh’;
Tastend streift sie ab die Wanderschuh’,
Legt sich auch in ihre finst’re Truh’.
Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend steh’n
Wie zwei Sternlein, innerlich zu seh’n,
Bis sie schwanken und dann auch vergeh’n,
Wie von eines Falters Flügelweh’n.
Doch noch wandl’ ich auf dem Abendfeld,
Nur dem sinkenden Gestirn gesellt;
Trinkt, o Augen, was die Wimper hält,
Von dem goldnen Ueberfluß der Welt!
(9, S. 43)
Die äußere Form des Werkes mutet unkompliziert an. Keller verwendet ein trochäisches Metrum mit fünf Hebungen und ausschließlich männlichen Kadenzen, beschränkt sich in jeder Strophe auf einen einzigen Reimklang und schreibt in einem konsequenten Zeilenstil, der das Versende immer mit einem syntaktischen Einschnitt zusammenfallen lässt. Eine ebenso kunstvolle Einfachheit prägt den Sprachgestus zumindest der ersten drei Strophen, die mit ihrem gleichförmigen Singsang, ihren Diminutiven, ihren naiv-plastischen Bildern und der vertraulichen Anrede des Sprechers an seine eigenen Augen Assoziationen an Wiegenlieder oder Kinderreime wecken. Umso frappierender wirkt die inhaltliche Radikalität der Aussage, die hier formuliert wird: Da Körper und Seele des Menschen eine untrennbare Einheit bilden, müssen beide auch zugleich unwiderruflich sterben. Eine Fortdauer im Jenseits gibt es für das lyrische Ich nicht.
Leben wird dabei geradezu mit Sehen gleichgesetzt. Der Mensch lebt, solange er als Sinnenwesen der äußeren Wirklichkeit zugewandt und für ihre Eindrücke offen ist, solange also die „Fensterlein“ der Augen die Welt in Gestalt vielfältiger Bilder in die „Seele“ dringen lassen. Wenn sich diese Augen für immer schließen, wird es für die Seele Zeit, sich zur Ruhe zu legen: Keller personifiziert sie im Rückgriff auf einen christlichen Topos als Pilgerin auf Erden, die nun endlich ihre „Wanderschuh’“ ablegen kann. Die Bildvorstellungen der ersten beiden Strophen werden in der dritten mit verblüffender Stringenz weitergeführt. Gleichsam im dunklen Inneren des Körpers eingesperrt und nunmehr vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten, sieht die Seele des Sterbenden nur noch „zwei Fünklein“ glimmen, wie man sie ja in der Tat wahrnimmt, wenn man nach einem Blick ins Helle die Lider schließt. Aber auch diese Funken vergehen rasch, bis endgültig Finsternis herrscht. Todesschrecken kommen in Kellers Gedicht trotzdem nicht auf, denn der Sprecher findet sich gefasst mit der Begrenztheit seiner Existenz ab. Das Lebensende erscheint hier weder spektakulärer noch gewaltsamer als „eines Falters Flügelweh’n“.
Das „Doch“, das die letzte Strophe einleitet, kündigt eine unvermutete Kehre des Gedankengangs an. Jetzt wechselt auch das rhetorische Register plötzlich zum hymnischen Überschwang, und metrisch ist der Einschnitt durch den einzigen Hebungsprall im Gedicht gekennzeichnet: „Doch noch …“. Nach der gelassenen Besinnung auf den unausweichlichen Tod wendet sich das Ich nun emphatisch dem Leben zu, dessen Tiefe und Fülle gerade aus dem Bewusstsein erwachsen, dass es nicht ewig währt. Und wieder wird Leben praktisch mit Sehen identisch gesetzt, weil der Lebensgenuss für den Sprecher darin besteht, den „goldnen Ueberfluß der Welt“ begierig durch die Augen einzuschlürfen. Dieses poetische Motiv sinnlicher Weltfreude ist bei Keller bemerkenswert konstant geblieben, denn es begegnet bereits drei Jahrzehnte früher in den Neueren Gedichten im dreizehnten Stück des Zyklus „Aus dem Leben“: „Trink’, o Seele nur in vollen Zügen/Dieses heilig friedliche Genügen“ (13, S. 347).
Kellers Abendlied ist nicht nur nach dem Zeitpunkt seiner Entstehung ein Altersgedicht. Traditionsgemäß steht der Tag für das Leben, der Abend mit der hereinbrechenden Dunkelheit dagegen für das Alter und die Nähe des Todes, was in einem Text, der das Leben an die Aufnahme optischer Reize und somit an Licht und Farben bindet, umso plausibler wirkt. Bis zum letzten Augen-Blick und folglich auch auf dem „Abendfeld“ im Schein der sinkenden Sonne gilt es, den bunten Reichtum der Welt auszukosten – das ist die Lehre, die diese Verse aussprechen und die von vorbildlichen Figuren in Kellers Werk auch getreulich befolgt wird, etwa von Salomon Landolt im Landvogt von Greifensee, der noch im vorgerückten Alter ein „künstlerisches Auge“ bewahrt, das mit unermüdlicher Aufmerksamkeit „jeden Wechsel der tausenderlei Gestalten“ registriert, die sich vor ihm entfalten (6, S. 247). Tatsächlich ist der Übergang von Kellers Auffassung der menschlichen Sinnennatur zu seinen Anschauungen über Kunst und Dichtung fließend, da er auch den Künstler vornehmlich als ‚Seher‘, als passionierten Beobachter oder Betrachter begreift. Von dieser These ausgehend, wird das nächste Kapitel die Umrisse seiner Poetik nachzeichnen.