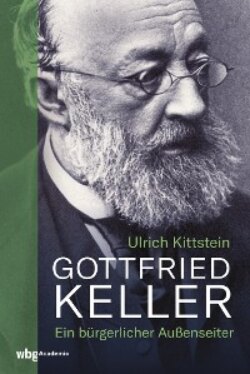Читать книгу Gottfried Keller - Ulrich Kittstein - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aus dem Leben eines bürgerlichen Außenseiters
ОглавлениеIn viele Schriften Kellers ist autobiographisches Material eingeflossen, das in der literarischen Fiktion freilich durchweg stilisiert und verfremdet wiederkehrt. Vor der Öffentlichkeit unverstellt über sich selbst zu reden oder zu schreiben, liebte der Autor dagegen nicht. Gleichwohl sah er sich mehrfach veranlasst, kleine Darstellungen seines Lebenslaufes zu verfassen, die je nach Gelegenheit und Adressatenkreis ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Wenigstens einer dieser Texte, der besonders lakonisch ausgefallen ist, sei hier im Zusammenhang wiedergegeben. Keller schickte ihn 1883 an den dänischen Dichter Holger Drachmann, der den Grünen Heinrich übersetzt und den Verfasser um einige biographische Daten gebeten hatte:
Ich bin 1819 in Zürich geboren, als Sohn eines jungen Handwerksmeisters, der starb, als ich kaum 5 Jahre zählte, und der Wittwe die Sorge für zwei Kinder hinterließ. Bis zu meinem fünfzehnten Jahre vermochte mich die Mutter in den Schulen zu halten; neue Lasten und die Ungewißheit der Zukunft auf sich zu nehmen, zögerte sie dennoch nicht, als ich nun ohne weiteres erklärte, ein Maler werden zu wollen. Theils bei unzulänglichen Lehrern, teils ganz auf mich selbst gestellt, verbrachte ich die Zeit bis zum zwanzigsten Jahre, wo ich mit wenig Mitteln als angehender Landschafter nach München ging, um mich auszubilden. Ohne an ein gutes Ziel gelangt zu sein, kehrte ich nach ein par Jahren zurück und verfiel im Wechsel der Gemüths-Stimmungen und des geistigen Suchens auf das Niederschreiben lyrischer Gedichte, deren Publication von ältern Gönnern veranlaßt wurde, die sich gefunden hatten. Erst jetzt bildete ich mich literarisch besser aus und erhielt endlich ein Staats-Stipendium zum Besuche der Universität Heidelberg, wo ich drei Semester blieb, und zu einem Aufenthalte in Berlin, wo ich den Grünen Heinrich schrieb, sowie den ersten Band der Leute von Seldwyla.
Später übernahm ich ein öffentliches Amt, dasjenige des Staatsschreibers des Cantons Zürich, welche Stelle ich während einer längeren Reihe von Jahren bekleidete, bis ich sie im Jahre 1876 niederlegte, um mich ausschließlich schriftstellerischen Arbeiten zu widmen. (15, S. 416f.)
Diese knappen Bemerkungen lassen bereits erahnen, wie wenig Kellers Werdegang dem Muster einer ordentlichen bürgerlichen Karriere entsprach. Sie enthalten, streng genommen, keine Unwahrheiten, geben aber doch ein recht lückenhaftes Bild, das im Folgenden korrigiert und ergänzt werden soll.
Die Eltern des Dichters, Rudolf und Elisabeth Keller, stammten aus dem Dorf Glattfelden im Nordwesten des Kantons Zürich und zogen erst 1817 in die Hauptstadt, wo Gottfried am 19. Juli 1819 zur Welt kam und drei Jahre später auch seine Schwester Regula geboren wurde. Zwei Katastrophen überschatteten Kellers Kindheit und Jugend: zum einen der frühe Tod des Vaters, eines Drechslermeisters, im Jahre 1824, zum anderen das abrupte Ende seiner schulischen Laufbahn im Sommer 1834, das in dem eben zitierten Text sehr euphemistisch umschrieben wird. Keller, der nach der Elementarschule das Züricher Landknaben-Institut besucht hatte und dann auf die Kantonale Industrieschule – eine Art Realschule – gewechselt war, beteiligte sich an einem Streich der Kameraden gegen einen unbeliebten Lehrer und wurde daraufhin als vermeintlicher Rädelsführer von der Schule geworfen. Nach dem Vater als dem Oberhaupt, Ernährer und Beschützer der Familie verschwand damit auch „die zweite wichtige Sozialisationsinstanz der bürgerlichen Gesellschaft“7 aus dem Dasein des Heranwachsenden. Zeitlebens empfand Keller den Schulverweis als eine empörende Ungerechtigkeit, die der staatlichen Pädagogik ein vernichtendes Zeugnis ausstellte: „ein Kind von der allgemeinen Erziehung ausschließen, heißt nichts Anderes, als seine innere Entwicklung, sein geistiges Leben köpfen“, liest man im Grünen Heinrich (11, S. 219). Die Sensibilität des Autors für die Bedeutung von Erziehung und Bildung und sein ausgeprägtes Interesse an der didaktischen Funktion von Literatur verdankten sich wohl zu einem guten Teil diesem bitteren Jugenderlebnis.
Keller gehörte fortan nicht mehr zu den beneidenswerten jungen Leuten, die, wie es in seinem Roman heißt, „unter dem doppelten Schutze des Staates und der Familie ununterbrochen lernend in’s männliche Alter und in die Selbständigkeit hinüberreifen“, womit „zugleich der sichere Eintritt in das bürgerliche Leben verbunden“ ist (12, S. 231). Was in Ermangelung einer gründlichen väterlichen und schulischen Anleitung übrig blieb, waren die unsystematischen Bildungsbemühungen eines Autodidakten, dem es in seinen beschränkten Verhältnissen zudem an finanziellen Mitteln und sozialen Kontakten gebrach. 1843 klagte Keller in seinem Tagebuch:
Es ist eine verfluchte Plackerei für einen armen Teufel, der sich gern um allerlei Erscheinungen der Zeit und der Litteratur bekümmern möchte, Jahre lang von verschiedenen Dichtern u Scribenten schwatzen hört, und dieselben nie zu lesen bekömmt; warum? weil er isoliert ist, weil kein Mensch weiß, daß er ein verkanntes, verflucht hoffnungsvolles Genie ist, und weil er lauter Plebs und Mistfinken in seiner Umgebung hat. Bücher kann er keine kaufen, höhere Bibliotheken stehen ihm keine offen, und wenn in der Leihbibliothek sich wunderbarer Weise ein verdauliches Buch findet, so muß er monathlang warten, bis er’s endlich ein Mal bekommt. (18, S. 83–85)
Die Berufswahl gestaltete sich für den unberatenen jungen Mann ebenfalls schwierig. Seine Entscheidung für die schon länger auf eigene Faust geübte Malerei verdankte sich, wie er erst später einsah, weitgehend dem „Zufall“ (15, S. 407), und zu einer professionellen Ausbildung kam es nie. Bei dem Züricher Lithographen und Kupferstecher Peter Steiger, bei dem er zunächst in die Lehre ging, konnte Keller nicht viel lernen, und der weitaus begabtere, aber psychisch labile Rudolf Meyer unterrichtete ihn im Winter 1837/38 nur wenige Monate lang – die beiden Männer lieferten übrigens die Vorbilder für die Herren Habersaat und Römer im Grünen Heinrich. „[E]he ich mich besann, war ich zwanzig Jahre alt geworden, ohne eigentlich etwas Rechtes zu können“, stellte Keller bereits 1847 in einem autobiographischen Rückblick selbstkritisch fest (S. 398). Auch der Aufenthalt in München, der vom Frühjahr 1840 bis zum Herbst 1842 dauerte und durch ein kleines väterliches Erbteil ermöglicht wurde, brachte nicht den ersehnten Durchbruch, obwohl die Stadt als eine Hochburg der bildenden Künste in Deutschland galt: „Ich war […] ohne Empfehlungen gekommen, lebte ohne nähere Bekanntschaft mit ausgezeichneten Künstlern, auf der Akademie war für die Landschaftsmalerei gar kein Lehrer, noch Raum: so war ich mir wieder selbst überlassen“ (S. 398). Als Maler gelangte Keller nicht über einen anspruchsvollen Dilettantismus hinaus, zumal er seine Zeit lieber in der geselligen Runde befreundeter Landsleute zubrachte, als ernsthaft seinen künstlerischen Ambitionen nachzugehen. Irgendwann war das Geld aufgebraucht. Keller lernte die Armut, die Schulden und den Hunger kennen und trat schließlich, wie er im Tagebuch notierte, die „Flucht in’s Mütterliche Haus“ in Zürich an (18, S. 19).
Die einschneidende Bedeutung des Jahres 1843, das er wieder daheim verbrachte, sollte sich erst im Nachhinein enthüllen. Keller, der bis dahin nur nebenher auch einige Gedichte, Aufsätze und kleine dramatische Versuche fabriziert hatte, entfaltete jetzt urplötzlich eine geradezu eruptive lyrische Produktivität, deren Schwung mehr als zwei Jahre lang anhielt. Literaturinteressierte Kreise in Zürich wurden auf ihn aufmerksam, es ergaben sich erste Publikationsmöglichkeiten in Zeitschriften und Almanachen, und 1846 erschien eine von seinem Mentor August Adolf Ludwig Follen redigierte Auswahl der Texte in einem Bändchen Gedichte. Der Weg zur Schriftstellerei war für Keller damit aber durchaus noch nicht klar und deutlich vorgezeichnet. Verkündete er 1845 selbstgewiss: „Das Malen ist nun an den Nagel gehängt, wenigstens als Beruf“ (GB 1, S. 233)8, so drückte er sich zwei Jahre später schon wieder vorsichtiger aus: „Ob ich wirklich zum Dichter geboren bin und dabei bleiben werde, ob ich wieder zur bildenden Kunst zurückkehren oder gar beides miteinander vereinigen werde, wird die nähere Zukunft lehren“ (15, S. 400). Tatsächlich jedoch griff er fortan nur noch gelegentlich zu Zeichenstift und Pinsel, etwa um Freunde mit einer persönlichen Gabe zu bedenken9; außerdem verfasste er im Laufe der Zeit immer wieder kleine kunstkritische Essays und Besprechungen.
Trotz des spektakulären Auftakts boten sich dem jungen Dichter vorerst weder konkrete Zukunftsperspektiven noch Verdienstmöglichkeiten. Keller muss seine prekäre Situation über lange Jahre hin als außerordentlich belastend empfunden und sich mit Ängsten und Selbstzweifeln geplagt haben – und mit Gewissensbissen, denn immerhin zehrte er von dem bescheidenen Besitz seiner Mutter und von dem, was Regula als Verkäuferin oder Näherin erwarb. Als die Schwester 1847 erkrankte, schrieb er im Tagebuch: „Die Mutter wacht nun ganz allein schon 14 Nächte bei ihr, ich kann nichts helfen, ich bin die unnütze Zierpflanze, die geruchlose Tulpe, welche alle Säfte dieses Häufleins edler Erde, das Leben von Mutter u Schwester aufsaugt“ (18, S. 139/141). Auch in Briefen verlieh er seinen Sorgen und seiner Ratlosigkeit beredten Ausdruck und beklagte das Unvermögen, sich endlich zu einer zielstrebigen Tätigkeit aufzuraffen. Schon im Juli 1839 hatte er dem Jugendgefährten Johann Müller gestanden: „Nun bin ich volle zwanzig Jahre alt, und kann noch nichts, und stehe immer auf dem alten Flecke, und sehe keinen Ausweg, fortzukommen, und muß mich da in Zürich herumtreiben, während andere in diesem Alter schon ihre Laufbahn begonnen haben.“ Sein Geburtstag verlief unter solchen Umständen nicht gerade heiter: „Ich saß eben trüb und verstimmt in meiner Kammer und übersah mein bisheriges regelloses und oft schlecht angewendetes Leben, welches wie ein verdorrter und abgehauener Baum strunk hinter mir im Dreck lag, und guckte neugierig in meine Zukunft, welche wie ein unfruchtbarer Holzapfelbaum ebenfalls vor mir im Dreck stund und mir durchaus keine erfreulichen Aspekten gewähren wollte“ (GB 1, S. 156f.). Wird hier die persönliche Not wenigstens noch mit Humor genommen, so spricht ein Brief, den der treue Malerfreund Johann Salomon Hegi 1841 aus München erhielt, in einem weit weniger schnoddrigen Ton von Kellers „Furcht, ein gemeines, untätiges und verdorbenes Subjekt zu werden“ (S. 191). Auch nach der Heimkehr in die Schweiz blieben die Verhältnisse und mit ihnen die Selbsteinschätzung des jungen Mannes im Wesentlichen unverändert. Mehrere Jahre, so klagte er im Rückblick, habe er damals wegen seiner notorischen „Gedankenlosigkeit und Faulheit […] in Zürich verlümmelt“ (S. 296).
Keller war, wie man sieht, kein munterer Seldwyler, der die Regeln der bürgerlichen Lebenswelt mit souveräner Leichtigkeit missachtete. Konnte er den gesellschaftlichen Erwartungen auch nicht gerecht werden, so hatte er sie doch in hohem Maße verinnerlicht und litt selbst unter seiner unproduktiven und ungewissen Existenz. Die Befürchtung, mit dieser „naiv beschaulichen u müßiggängerischen Weise zu Grund [zu] gehen“, die er einmal einer privaten Notiz anvertraute (18, S. 157), ließ sich nicht verdrängen, doch sie wurde zumindest literarisch fruchtbar, denn nach der Rückkehr aus München entwickelte Keller, wie er sich viel später erinnerte, den Plan, „einen traurigen kleinen Roman zu schreiben über den tragischen Abbruch einer jungen Künstlerlaufbahn, an welcher Mutter und Sohn zu Grunde gingen“ (15, S. 411). Wenn ihn sein Gedächtnis nicht trog, reichte seine Strategie, eigene Erlebnisse und Ängste im Medium der poetischen Fiktion zu verarbeiten, also bis in diese frühe Zeit zurück. Die lyrische Begeisterung, die ihn dann so unvermittelt überfiel, drängte das epische Projekt zwar vorerst in den Hintergrund, aber die Idee zu dem Roman Der grüne Heinrich war geboren.
Melancholische Reflexionen über seine Lage stellte Keller indes auch in der Lyrik an. In den Versen jener Jahre findet man viele Spuren der Angst vor einem zwecklos vergeudeten Leben, das nur Resignation, Wehmut oder tiefe Trauer übrig lässt, zum Beispiel in der umfangreichen dreiteiligen Terzinendichtung Eine Nacht, die der Verfasser – wie viele andere Gedichte, die ihm allzu persönlich und bekenntnishaft geraten waren – bezeichnenderweise nie publizierte.10 Selbstzweifel, Kummer, Leid, Erstarrung, Kälte und Tod sind zentrale Motive seines lyrischen Frühwerks, und immer wieder begegnet dort die Figur des einsamen Außenseiters, der seine Isolation schmerzlich empfindet. Eine makabre, aber höchst eindrucksvolle Gestalt gewinnt dieser Typus in der Person des lebendig Begrabenen, dem Keller in den Gedichten einen eigenen Zyklus von neunzehn Texten widmete. Um den Ton des Ganzen anklingen zu lassen, sei nur die erste Strophe des zweiten Stücks zitiert:
Da lieg’ ich nun, ohnmächtiger Geselle,
Geschieden von der ganzen, weiten Welt!
Versprengter Tropfen von der Lebensquelle,
Ein Baum, noch grünend, ist er auch gefällt!
(13, S. 93)
Erst 1848 schien sich Kellers Schicksal zum Besseren zu wenden, als die liberale Regierung des Kantons Zürich beschloss, die literarische Laufbahn ihres talentierten, aber allzu bequemen Mitbürgers durch ein Stipendium für eine längere Studienreise zu fördern. Keller griff begierig zu und fuhr im Herbst nach Heidelberg, wo er anderthalb Jahre verweilte, ehe er im April 1850 nach Berlin weiterzog. Erst Ende 1855 sollte er die Heimat wiedersehen. Die Zeit in Deutschland war in mancher Hinsicht ebenfalls schwierig und krisenhaft – „sieben Jahre in der Wüste“, wie Keller kurz vor der Rückkehr zusammenfasste (GB 4, S. 53) –, doch sie war für den Schriftsteller auch eine überaus ertragreiche Phase und wahrscheinlich sogar die entscheidende in seinem gesamten Entwicklungsgang. Nicht zuletzt trug die Dichtung jetzt endgültig den Sieg über die Malerei davon.
Eigentlich wollte Keller sich in Heidelberg und Berlin auf das Drama konzentrieren, das in der ästhetischen Theorie das höchste Ansehen genoss und eine besonders breite und unmittelbare Publikumswirkung versprach. Seine Bemühungen führten allerdings nur zu einer Anzahl von Plänen, Skizzen und Fragmenten; fertig wurde nichts. Dafür schrieb er, während ihn die vergebliche Hoffnung auf einen großen Theatercoup viel länger als ursprünglich geplant in Deutschland festhielt, in zähem Ringen mit dem Stoff und im Dauerkonflikt mit dem drängenden, mahnenden und drohenden Verleger Eduard Vieweg den großen Roman Der grüne Heinrich, der 1854/55 endlich erscheinen konnte. Auch einen zweiten Lyrikband legte er vor, der unter dem Titel Neuere Gedichte 1851 in erster, drei Jahre später in veränderter zweiter Auflage herauskam. Die Erzählungen, die den 1856 publizierten ersten Band der Leute von Seldwyla füllten, entstanden gleichfalls noch in Berlin, und darüber hinaus entwickelte Keller damals bereits Ideen und Einfälle, aus denen später auf verschlungenen Wegen die Sammlung der Sieben Legenden, der zweite Seldwyla-Band sowie der Novellenzyklus Das Sinngedicht hervorgingen. Die meisten seiner größeren Erzählwerke wurden also entweder in der Berliner Zeit verfasst oder hatten dort zumindest ihre Wurzeln.
Dennoch verbrachte der Autor in Heidelberg und vor allem in Berlin keine glücklichen Jahre. Unselige Liebesaffären spielten dabei eine Rolle, aber auch gesellschaftlich fühlte er sich nach wie vor isoliert und manchmal einer „gottvergessenen Einsamkeit“ ausgeliefert (GB 1, S. 329), besonders in der preußischen Hauptstadt, wo er sich an der Betriebsamkeit der professionellen Literaten störte und als ein recht ungeschliffener Bursche mit den Umgangsformen in den Salons und geselligen Zirkeln schlecht zurechtkam. Lange zögerte er, dem einflussreichen Karl August Varnhagen von Ense einen Besuch zu machen, weil es ihm „an aller Form für den norddeutschen Verkehr“ fehle (GB 2, S. 36), und in der Künstlervereinigung „Tunnel über der Spree“, der beispielsweise Theodor Fontane angehörte, konnte und wollte er ebenfalls nicht Fuß fassen, obwohl sie ihm die Chance geboten hätte, wertvolle Kontakte zu knüpfen. Noch viel später mokierte er sich über die Gepflogenheiten dieser Runde, deren Mitglieder eigene ‚Tunnel-Namen‘ führten und in ihren Sitzungen literarische Arbeiten vortrugen, die anschließend nach einem festen Ritual begutachtet wurden: „Zu jener Zeit war ich auch einmal […] in einer Sonntagssitzung der Tunnelgesellschaft, obskur wie eine Schärmaus und ungefähr auch von ihrer Gestalt. Auf dem Präsidentenstuhl saß Franz Kugler und hieß Lessing, ein Gardeoffizier las eine Ballade vor; bei der Umfrage kam ich auch an die Reihe und grunzte: Wrumb! worauf das Wort sofort dem nächsten erteilt wurde“ (GB 3.1, S. 33).
Seine eigenen, späterhin so gefeierten schriftstellerischen Leistungen zahlten sich bei den Zeitgenossen keineswegs unmittelbar aus, denn weder der Grüne Heinrich noch die Leute von Seldwyla erzielten auf Anhieb einen nennenswerten Publikumserfolg. Deshalb ließen sich Mangel und Not trotz des mehrfach verlängerten Staatsstipendiums nicht abschütteln, und aufs Neue verstrickte Keller sich in eine Schuldenwirtschaft von seldwylischen Ausmaßen. Da er seiner Mutter „nicht zu schreiben wußte, was sie wünschte und hoffte“ (GB 3.2, S. 53), verstummte er als Briefeschreiber zeitweilig ganz, so dass Elisabeth Keller beispielsweise zwischen Juni 1850 und Februar 1852 keine einzige Nachricht von ihrem Sohn erhielt. Wenn er aber doch einmal von sich hören ließ, erging er sich mitunter in prahlerischen Reden, mit denen er sich wahrscheinlich auch selbst Mut zusprach. Schon in der Münchner Zeit hatte er Versagensängste mit großspurigen Tiraden überspielt. „In einem Jahr werde ich wahrscheinlich für einige Zeit nach Berlin gehen und später nach Düsseldorf; wenn ich kein besonders schlechtes Schicksal habe, so hoffe ich in zwei Jahren nach Italien gehen zu können“, erklärte der verbummelte Malschüler damals seiner Mutter (GB 1, S. 65). Aus der Berliner Zeit sind ähnliche Äußerungen überliefert, in denen sich Trotz und gespielte Zuversicht mit dem Wunsch verbinden, die Angehörigen daheim zu beruhigen und zugleich ein wenig zu beeindrucken. „Ich will überhaupt mit gutem Ansehen nach Hause kommen und als ein selbständiger Mann in jeder Hinsicht“ (S. 118), teilte er Ende 1853 mit, und im Februar 1855 ließ er sich beinahe drohend vernehmen: „wenn ich erst einmal in Zürich bin, so wird man schon sehen, wer ich bin und daß man nicht so zur Not und aus Gnade mir ein Unterkommen zu gewähren braucht. Ich mache jetzt ein ganz anderes Gesicht, als wie ich vor sechs Jahren so traurig abzog. Brauchbare und tüchtige Leute kann man überall brauchen, und wenn sie es dort nicht können, so ist die Welt weit“ (S. 125f.).
Das Thema Heimkehr muss Keller intensiv beschäftigt haben, denn es taucht auch in seinem Werk häufig auf. Viele Helden seiner Romane und Erzählungen ziehen freiwillig oder unfreiwillig in die Fremde und kommen manchmal erprobt, gereift und wohlhabend, manchmal aber auch als gescheiterte Existenzen zurück. Eine einzige ausufernde Phantasie über das Heimkehren sind die Träume, die den grünen Heinrich am Ende seines Aufenthalts in jener deutschen ‚Kunststadt‘ heimsuchen, für die München als Vorbild gedient hat. Wenn sie in immer neuen Anläufen das ganze Spektrum unterschiedlicher Varianten durchspielen, das von der triumphalen Ankunft des verlorenen Sohnes auf einem goldenen Pferd bis zur tiefen Scham eines verkommenen, zerrissenen Herumtreibers reicht, fällt es nicht schwer, hinter diesen Romanpassagen die ureigenen Wunsch- und Angstphantasien des Autors zu erkennen.
Ein Triumphzug war dessen Heimkehr im Spätjahr 1855 jedenfalls nicht. Nachdem er seine „fruchtbringende Leidensschule“ endlich absolviert und Berlin, das für ihn „Bußort und Korrektionsanstalt“ in einem darstellte, in Richtung Zürich verlassen hatte (GB 1, S. 256f.), musste er sehr bald feststellen, dass einträgliche schriftstellerische Erfolge weiterhin ebenso fern lagen wie ein fester Platz in der bürgerlichen Gesellschaft. Übergangslos geriet Keller wieder in den alten Schlendrian. Zwar fand er jetzt vermehrt Zugang zu den gebildeten Kreisen in Zürich und verkehrte unter anderem mit einigen illustren Persönlichkeiten aus Deutschland, die sich damals – zum Teil als Revolutionsflüchtlinge – in seiner Vaterstadt aufhielten, etwa mit dem Architekten Gottfried Semper, dem Komponisten Richard Wagner und dem Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer. Beruflich und ökonomisch mangelte es aber nach wie vor an handfesten Aussichten, zumal der literarische Ertrag der nächsten Jahre spärlich ausfiel.
Kellers Arbeitsweise war daran nicht ganz unschuldig. Regelmäßig überschätzte er seine Energie und sein Schreibtempo gewaltig und bedachte seine Verleger mit voreiligen Zusagen und überzogenen Versprechungen, was schon Vieweg leidvoll erfahren musste, der ihm das Manuskript des Grünen Heinrich nur in jahrelangen Kämpfen portionsweise abringen konnte. Oftmals beschränkte Keller sich sogar ganz darauf, seine Einfälle in Gedanken auszuspinnen, statt sie zielstrebig zu Papier zu bringen, und gegenüber Paul Heyse beklagte er einmal das „Erbübel, das wirklich niederschreiben zu müssen […], was man sich peripatetisch zurechtgeträumt hat“ (GB 3.1, S. 51). „[E]s scheint“, schreibt Adolf Frey in seinen Erinnerungen an Gottfried Keller, der Dichter habe „eine Arbeit schon als eine vollendete behandelt und erörtert, sobald er mit sich darüber mehr oder weniger im reinen war oder doch zu sein glaubte“.11 So bezeichnete Keller den „Stoff“ für das Sinngedicht bereits 1855 als „vollständig durchgearbeitet und ausgebildet“ (GB 3.2, S. 113) und rechnete damit, den kompletten Text binnen weniger Wochen vorlegen zu können – tatsächlich wurde er erst gut fünfundzwanzig Jahre (!) später abgeschlossen. 1881 teilte er Julius Rodenberg mit, das Manuskript dieses Werkes, das er soeben für dessen „Deutsche Rundschau“ anfertigte, sei
die erste und einzige Niederschrift, während die Novellen und der Rahmen vor zwei Dezennien schon im Kopfe entworfen und seither meine stillen Begleiter auf Spaziergängen und beim Glase Wein gewesen sind. Dennoch wußte ich nicht viel davon, was aus jedem der Geschichtchen werden würde. Ich führe von der Berliner Zeit her ebenso ein paar Lustspiele als anonyme Passagiere im Hirnkasten mit, die aber wohl nicht mehr aussteigen werden. Jetzt denke ich allmählig auf einen einbändigen kleineren Roman; was daraus wird, mag der Herrgott wissen. (S. 387)
Kein Wunder, dass der Autor die Geduld der Verleger ein ums andere Mal auf eine harte Probe stellte! Aus dem „kleineren Roman“ sollte im Laufe der Zeit Martin Salander werden, während die erwähnten Lustspiele, wie Keller schon vermutete, ungeschrieben blieben und damit das Schicksal zahlreicher anderer Projekte teilten.
Vorläufig kamen Mutter und Schwester nicht umhin, den Müßiggänger weiter mit zu ernähren – eine Konstellation, die in Pankraz, der Schmoller ihren Niederschlag findet, wo der Titelheld sich zu Beginn ebenfalls „wie ein kleiner Indianer“ gebärdet, „der die Weiber arbeiten läßt“, ohne selbst einen Finger zu rühren (4, S. 15). Keller war natürlich nicht blind für die Peinlichkeit dieser Lage und kämpfte ständig mit seinem schlechten Gewissen. Düstere Stimmungen überkamen ihn, wenn er bedachte, wie viel Lebenszeit mittlerweile ungenutzt verstrichen war. „Meine Jugend ist nun einmal zum Teufel“, hatte er bereits 1852 geschrieben, „und ich habe mich schon in die Reihe derjenigen Menschen gestellt, welche erst mit dem Schwabenalter ihre rechte Bestimmung erreichen“ (GB 1, S. 306). Fünf Jahre später hieß es in einem Brief: „Es beschleicht und quält mich oft der Gedanke, daß ich bis jetzt der Welt noch gar nichts Reelles genützt habe“ (GB 2, S. 56). Zeitweilig erwog er, in seiner Heimatstadt eine Professur für Literaturgeschichte am neugegründeten Polytechnikum – der heutigen ETH Zürich – anzunehmen. Die Tätigkeit lockte ihn zwar eigentlich nicht, zumal er die hohe Arbeitsbelastung fürchtete. Andererseits waren die materielle Sicherheit und die Aussicht, wenigstens den Ruf eines bürgerlichen Versagers loszuwerden, nicht zu verachten. Als entsprechende Pläne schon in der Berliner Zeit zur Sprache kamen, ermahnte Keller sich selbst: „Ich muß mich mit Gewalt in ausgefüllte starke Beschäftigung werfen, sonst geht die Duselei ins Unendliche fort“ (GB 1, S. 389), und 1857 stand er erneut kurz vor einer Zusage, um wenigstens „während einiger Jahre den bürgerlichen Begriffen genugzutun“ und sich endlich „Amt und Einkommen“ zu verschaffen (GB 2, S. 67). Umgesetzt wurde das Vorhaben trotzdem nicht.
Ohne merkliche Veränderungen ging mit dem vierzigsten Geburtstag des Dichters auch der Eintritt in das sprichwörtliche Schwabenalter vorüber, auf das er seine Hoffnungen gesetzt hatte. Das Jahr 1861 wurde dann aber zu einem weiteren Schlüsseldatum in Kellers Biographie: Im September wählte ihn der Züricher Regierungsrat überraschend zum Ersten Staatsschreiber des Kantons und erhob den ‚armen Poeten‘ damit unversehens zum einflussreichsten Beamten seines Heimatländchens, ausgestattet mit einem beträchtlichen Gehalt und einer gesellschaftlichen Reputation, wie er sie nie zuvor gekannt hatte. Was die Regierung zu ihrer kühnen Entscheidung bewog, ausgerechnet diesem Bewerber, an dessen Qualifikation man doch mit guten Gründen zweifeln konnte, den Vorzug zu geben, ist bis heute nicht restlos geklärt. Einige unschöne Ereignisse rund um seinen Amtsantritt schienen auch sogleich sämtliche Vorbehalte zu bestätigen. Keller, der jederzeit grob und sogar handgreiflich werden konnte, wenn ihn der Ärger über missliebige Zeitgenossen packte, hatte noch am Vorabend im Wirtshaus randaliert und war dem deutschen Sozialisten Ferdinand Lassalle, der sich gerade in einer ziemlich angeheiterten Runde als Magnetiseur versuchte, mit einem Stuhl zu Leibe gerückt, und am folgenden Morgen musste er von einem der Regierungsräte eigens aus dem Bett geholt werden, um den Dienstbeginn nicht zu versäumen.12 Zum Glück blieb das aber der letzte Fehltritt des Herrn Staatsschreibers. Fortan versah er seinen Posten so diszipliniert und zuverlässig, dass die Kritiker rasch verstummten.
Elisabeth Keller genoss noch die Genugtuung, in die stattliche Dienstwohnung des Sohnes übersiedeln zu können, wo sie drei Jahre später verstarb. Keller seinerseits wurde durch die Berufspflichten unmittelbar in die kantonale und eidgenössische Politik verwickelt, und dies ausgerechnet in einer besonders heißen Phase, in der tiefgreifende Umbrüche stattfanden und heftige Parteikämpfe an der Tagesordnung waren. Die politischen Aspekte seiner Tätigkeit sollen aber bei anderer Gelegenheit behandelt werden. Hier sei zunächst nur erörtert, wie die neue Stellung Kellers persönliche Existenz und seine Beziehung zu den bürgerlichen Wertmaßstäben umgestaltete. Die lange Zeit des ziellosen Schlenderns lag nun hinter ihm, der strenge Ernst des Lebens forderte seinen Tribut. Der Dichter war sich darüber auch vollkommen im Klaren und traf mit der Übernahme des Staatsamtes eine ganz bewusste Entscheidung für die bürgerliche Seriosität. In einer autobiographischen Aufzeichnung, die er 1876/77 in der Zeitschrift „Die Gegenwart“ publizierte, schrieb er über die zurückliegenden anderthalb Jahrzehnte: „Indem ich während jener Zeit die Stelle des Staatsschreibers des Cantons Zürich versah, befolgte ich den bekannten Rath, dem poetischen Dasein eine sogenannte bürgerlichsolide Beschäftigung unterzubreiten.“ Sein Posten sei „weder eine ganze noch eine halbe Sinecure“ gewesen, vielmehr habe er sich „vom ersten bis zum letzten Augenblicke in den Geschäften tummeln“ müssen und zehn Jahre lang nicht einmal Urlaub nehmen können (15, S. 404f.). Das war keineswegs übertrieben, wie die Liste seiner Aufgaben zeigt, die Kellers erster Biograph Jakob Baechtold aufgestellt hat. Dem Staatsschreiber
stand die Oberleitung der Staatskanzlei zu. Er war zugleich Sekretär der Direktion der politischen Angelegenheiten. Über die Verhandlungen des Regierungsrates (der obersten vollziehenden Behörde des Kantons) führte er die Sitzungsprotokolle; er hatte den offiziellen Verkehr mit den übrigen Kantonsregierungen und dem Bundesrate zu unterhalten, mußte die jährlichen Rechenschaftsberichte sämtlicher Departemente zusammenstellen, Gesetzesentwürfe, Eisenbahnkonzessionen, Verordnungen aller Art registrieren oder endgültig redigieren, sowie die Unmasse von Ausfertigungen, Pässen, Heimatsscheinen u.s.w. mit seiner Unterschrift versehen. Kurz, das Amt nahm seinen ganzen Mann vom Morgen bis zum Abend in Anspruch […].13
Angesichts seiner beispielhaften Pflichterfüllung brauchte Keller sich nun nicht mehr vorzuwerfen, dem Vaterland und der Gesellschaft keinen Nutzen zu bringen. Er empfand die disziplinierende Wirkung der geordneten Berufsarbeit aber auch persönlich als wohltuend. Noch wenige Monate vor der Berufung zum Staatsschreiber hatte er hellsichtig geäußert, dass „die gänzliche Freiheit […] für Unbemittelte wie für Bemittelte auf die Dauer nicht erquicklich“ sei, und sich nach einem „Amt oder einer bestimmten bindenden und sicherstellenden Tätigkeit“ gesehnt (GB 3.2, S. 212), und später wusste er trotz der vielen unerfreulichen Seiten des Bürodienstes und des mechanischen Geschäftsgangs die heilsame „Regelmäßigkeit der Amtsgewöhnung“ immer zu schätzen (GB 3.1, S. 206). Sie konnte, wie er meinte, auch dem Schriftsteller nur zum Vorteil gereichen. Noch 1885 empfahl er einem jungen Mann, der poetische Ambitionen hegte, zunächst einmal die Schule abzuschließen und sich auf eine konventionelle Berufslaufbahn vorzubereiten, denn andernfalls werde er „überhaupt nicht geregelt arbeiten“ lernen, „und daraus entstehen nicht Dichter, sondern literarische unglückliche Bummler“ (GB 4, S. 295). Hier spricht jemand, dessen Bildungsweg sehr holprig war und der mit den Anforderungen der Arbeitswelt erst ungewöhnlich spät in Berührung kam, aus eigener bitterer Erfahrung.
Entsprechend skeptisch urteilte Keller über Schriftstellerkollegen, die ihr Künstlertum nie mit bürgerlicher Solidität zu verbinden vermochten und deshalb in seinen Augen nur allzu leicht den „festeren Halt im Leben“ (GB 3.2, S. 216) verloren. Das betraf zum Beispiel seinen Freund Paul Heyse, einen außerordentlich produktiven und seinerzeit auch sehr erfolgreichen Autor. Als er von dessen fortdauernder Kränklichkeit hörte, fürchtete Keller, „es räche sich, daß Heyse seit bald dreißig Jahren dichterisch tätig ist, ohne ein einziges Jahr Ableitung oder Abwechslung durch Amt, Lehrtätigkeit oder irgend eine andere profane Arbeitsweise genossen zu haben.“ Ein solches Dasein müsse die Kräfte eines Menschen frühzeitig erschöpfen: „Auch Tieck und Gutzkow ist diese Lebensart nicht gut bekommen“ (GB 3.1, S. 445f.). Wohin sie schlimmstenfalls führen konnte, demonstrierte der Poet Heinrich Leuthold, der 1879 in einem Züricher Irrenhaus starb. Keller vermisste bei diesem Landsmann jene Selbstdisziplin, die das unerlässliche Fundament eines fruchtbaren und inhaltsreichen Schaffens bilde. Leuthold sei „ohne genugsamen eigenen Gehalt“ gewesen und habe „die Lücke durch ein dissolutes Leben“ schließen wollen (S. 370). Gehässig nannte Keller den Unglücklichen „ein echt lyrisches Genie: Viel leben und nichts tun und darüber die Schwindsucht bekommen“ (S. 279). Mit solchen Ausfällen gegen die unbürgerlichen Attitüden einer verbummelten Pseudo-Genialität distanzierte er sich von einem Schicksal, das unter ungünstigeren Umständen auch das seine hätte werden können.
Der Staatsschreiber lief allerdings Gefahr, in das entgegengesetzte Extrem zu geraten und den dienstlichen Obliegenheiten alle literarischen Bestrebungen aufzuopfern. Hatte er das Amt zunächst unter der Voraussetzung übernommen, „daß der Poet und Schriftsteller dabei nicht verloren gehe“ (GB 3.2, S. 216), so musste er bald ernüchtert erleben, wie der Beruf seine Zeit fast vollständig verschlang. Lediglich zwei größere Werke wurden in dieser Phase publiziert, nämlich die Sieben Legenden (1872) und der zweite Teil der Leute von Seldwyla (1874). Nach fünfzehn Jahren war das Maß voll: Im Sommer 1876 erklärte Keller seinen Rückzug aus dem Staatsdienst, um „mit neuen Kräften das pure Schriftstellertum […] wieder aufzunehmen“ (GB 2, S. 176). Die im Amt erworbenen Tugenden sollten ihm dabei zugute kommen und den Rückfall in frühere Fehler verhüten. Humorvoll und doch mit ernstem Unterton schrieb der Endfünfziger einem Freund: „Erzogen bin ich nun endlich auch, wie ich glaube, so daß ich wohl wieder in die Freiheit hinaustreten darf“ (S. 483), und in der autobiographischen Skizze von 1876/77 formulierte er programmatisch: „Die Anlehnung an jene solide Bürgerlichkeit […] hat einmal stattgefunden, ihren Dienst gethan, und kann nun wieder mit einer andern ungetheilten Existenz vertauscht werden, denn die Hauptsache besteht, nach gewonnener Haltung und Elasticität, nicht sowohl in den sicheren Einkünften, als in der entschlossenen Lebensäußerung“ (15, S. 405).
Zum Glück erwies sich diese Zuversicht als wohlbegründet, denn das „neu eröffnete Geschäft eines bürgerlichen Dichters“ (GB 3.1, S. 276), der für seinen Lebensunterhalt ganz auf den literarischen Markt angewiesen war, florierte auf Anhieb. Keller benutzte die wiedergewonnene Unabhängigkeit, um mehrere ältere Projekte, die er teilweise schon seit Jahrzehnten mit sich herumtrug, in rascher Folge abzuschließen. 1876/77 veröffentlichte er die Züricher Novellen, 1879/80 eine gründlich umgestaltete Neufassung des Grünen Heinrich, 1881 den Novellenzyklus Das Sinngedicht und 1883 die Gesammelten Gedichte, die eine revidierte Auswahl aus seinen frühen Lyrikbänden boten und sie um zahlreiche neuere Texte ergänzten. Den Abschluss machte 1886, vier Jahre vor dem Tod des Autors, sein zweiter Roman Martin Salander.
Dass Keller von der Schriftstellerei nun recht komfortabel leben konnte, verdankte er nicht nur seiner zügigeren Produktionsweise und vorteilhaften Verlagskontrakten, sondern auch dem kräftigen Aufschwung, den der deutsche Literaturmarkt in jenen Jahren erlebte, nachdem er die Flaute im Gefolge der gescheiterten Märzrevolution von 1848/49 endgültig überwunden hatte. Besonders einträglich war das damals gängige Verfahren, erzählende Werke vor der eigenständigen Buchveröffentlichung stückweise in Zeitschriften zu publizieren, die unersättlich nach neuen Texten verlangten, beachtliche Honorare zahlten und außerdem ein breiteres Publikum erreichten. So wurde die anspruchsvolle „Deutsche Rundschau“, in der Vorabdrucke der Züricher Novellen, des Sinngedichts und des Martin Salander erschienen, zum wichtigsten Forum für Kellers Spätwerk. Der Bekanntheitsgrad des Autors – und damit sein Marktwert – stieg jetzt rapide an; Neuauflagen seiner Bücher, die selbstverständlich bares Geld eintrugen, folgten schneller aufeinander, und auch die Kritiker zollten ihm wachsenden Respekt. 1882 stellte Keller zufrieden fest, dass sich der riskante Schritt in die Freiheit gelohnt hatte: „Sonst geht es mir nicht übel; ich verdiene, ohne eigentlich viel zu tun, doppelt so viel Barschaft, als ich als Staatsschreiber einnahm“ (GB 2, S. 293).14
Mit den großen zeitgenössischen Erfolgsautoren wie Gustav Freytag, Joseph Victor von Scheffel oder dem schon erwähnten Paul Heyse konnte Keller freilich nicht konkurrieren, ganz zu schweigen von jenen Privilegierten, die ihre Werke in der populären Familienzeitschrift „Die Gartenlaube“ unterbrachten. Er hatte aber auch gar kein Interesse daran, ein „Geldvielschreiber“ zu werden (GB 3.2, S. 253), denn obwohl er mittlerweile um einiges konsequenter und disziplinierter zu Werke ging als früher, war ihm weiterhin jede fabrikmäßige Fließbandproduktion zuwider. Von der Hektik des Literaturbetriebs hielt er sich fern: „Ich bin kein tätiger und rühriger Literatus und mag daher auch nicht den Schein eines solchen annehmen“ (GB 4, S. 172). Sein Schreiben folgte einem eigenen Rhythmus, der von seiner Stimmungslage abhängig war und dem er sich zu fügen hatte, wie er Rodenberg einmal darlegte, um Engpässe bei den Manuskriptlieferungen für die Züricher Novellen zu erklären: „Ich bitte Sie zu bedenken, daß ich doch nicht alles übers Knie abbrechen kann und die Dinge, wenn eine Trockenheit der innern Witterung eintritt, wachsen und werden lassen muß, wie sie wollen, sonst gibt’s eine schlechte Arbeit für die ‚Rundschau‘“ (GB 3.2, S. 351). Auch die Abfassung des Martin Salander wurde mehrfach unterbrochen: „Dieses Opus hat nämlich nochmals einen Stillstand erfahren von jener Art, die mit einer Evolution verbunden ist und ruhig ertragen werden muß. […] In solcher Situation darf man das alte Recht, das Wesen eine Weile sich selbst zu überlassen, wohl benutzen oder soll es vielmehr“ (S. 407).
Reibereien mit den Verlegern und Ärger über den Druck, den fest vereinbarte Termine auf ihn ausübten, waren damit allerdings vorprogrammiert. Gerade die Fortsetzungen in Rodenbergs Zeitschrift, für die regelmäßig neues Textmaterial benötigt wurde, setzten Keller mächtig unter Zugzwang, und um nur halbwegs rechtzeitig fertig zu werden, kam er bisweilen doch nicht umhin, die verhassten „übereilten Schlüsse und deren Unfertigkeit“ in Kauf zu nehmen (S. 403). Immer wieder schwor er sich, künftig nur noch abgeschlossene, gründlich durchgearbeitete Manuskripte, die „wirklich fertig und reif“ waren, in Druck zu geben (S. 177), und ebenso oft sah er sich genötigt, mit diesem Vorsatz zu brechen. 1885 zog er während der Arbeit an Martin Salander das resignierte Fazit: „So sehr ich gewünscht habe, nur das fertige Ganze aus der Hand zu geben, wird es am Ende doch wieder darauf hinaus laufen, daß ich, wie bei den früheren Sachen, erst im Drange der Druckerschlacht entschlossen zu Ende kommen kann“ (S. 410). Die Umstände ihrer Produktion und Vermarktung blieben also nicht ohne Folgen für die Gestalt seiner literarischen Schöpfungen. Dennoch wird der heutige Leser Kellers Verlegern Dank wissen, denn ohne ihr beständiges Drängen hätte der Autor die meisten seiner Werke wahrscheinlich niemals fertiggestellt.
Mit „fünf-, sechsunddreißig Jahren“ erreicht der typische Seldwyler das Ende seiner übermäßig ausgedehnten Jugendzeit, ohne etwas Rechtes zustande gebracht oder gelernt zu haben (4, S. 8). Kann man es für einen Zufall halten, dass Gottfried Keller, als er in der Schlussphase seines Berliner Aufenthalts, immer noch ohne verheißungsvolle Zukunftsperspektiven, die Vorrede zum ersten Band der Leute von Seldwyla niederschrieb, exakt „fünf-, sechsunddreißig Jahre“ alt war? Und seine Adoleszenz sollte sogar ein gutes Stück über diese Grenze hinaus andauern. Erst in seinem fünften Lebensjahrzehnt gelangte er in eine feste berufliche Position, die ihm und seinen Angehörigen ihr Auskommen sicherte, ihn zu einer straffen Selbstbeherrschung nötigte und ihm zugleich die Gelegenheit bot, endlich seine Tüchtigkeit unter Beweis zu stellen. Weil Kellers Leben ganz und gar keine geradlinige bürgerliche Erfolgsgeschichte war, darf man auch Seldwyla nicht als heitere poetische Spielerei abtun. Das fiktive Städtchen erscheint vielmehr als konzentriertes Sinnbild einer Gefahr, die seinen Schöpfer nahe anging – und vielleicht als Inbegriff einer Versuchung, der er sich zu entziehen trachtete.
Jenes „schwierige Außenseitertum“, von dem Walter Muschg in seinem Keller-Porträt spricht15, prägte die Existenz des Dichters aber auch nach 1861 und im Grunde bis zu seinem Tod. Als Müßiggänger wie als Künstler, als Eigenbrötler, mürrischer Sonderling und früh alternder Junggeselle und schließlich auch aufgrund seiner eigenwilligen politischen und zeitkritischen Ansichten beobachtete Keller die gesellschaftliche Lebenswirklichkeit seiner Zeit stets aus einer prekären Randposition: als bürgerlicher Außenseiter im doppelten Sinne, nämlich distanziert von der Normalität einer bürgerlichen Existenz und doch zugleich stark von deren Wertvorstellungen geprägt. Er bezahlte seinen eigentümlichen Standpunkt mit vielen Jahren der persönlichen Ungewissheit und der Not, mit Einsamkeit und melancholischen Anwandlungen, aber er verdankte ihm auch tiefe Einsichten in die Fundamente und Gesetzmäßigkeiten der bürgerlichen Welt, die einer einmaligen Mischung aus Sehnsucht, Skepsis und scharfsinniger Reflexion entsprangen. Deshalb erzählte er als Dichter mit Vorliebe von Menschen, die nicht im selbstverständlichen Besitz der bürgerlichen Tugenden sind und die Lockungen der Trägheit und der unverbindlichen Phantasiespiele nur allzu gut kennen. Es sind Figuren, die um einen Platz in der gesellschaftlichen Ordnung kämpfen müssen und dabei durchaus nicht immer Erfolg haben. Mit anderen Worten: Keller bevorzugte in seinem Prosawerk das Modell der Entwicklungs- oder Sozialisationsgeschichte.
Das Bild Gottfried Kellers als eines bürgerlichen Außenseiters, wie es sich in seinem literarischen Schaffen spiegelt, wird in dieser Monographie nachgezeichnet. Sie bietet weder eine chronologische Lebensbeschreibung nach dem klassischen biographischen Muster noch eine systematische, nach Texten oder Textgruppen gegliederte Darstellung des Oeuvres, wie ich sie anderswo in knapperer Form vorgelegt habe.16 Statt dessen stellt sie Kellers Gesamtwerk unter gewissen thematischen Schwerpunkten und im Horizont des sozialen, politischen und geistesgeschichtlichen Umfelds seiner Epoche vor, übrigens im Einklang mit seiner eigenen Überzeugung, „daß jeder Dichter mehr oder weniger das Produkt seiner Umgebung, der Verhältnisse ist, aus denen er hervorgewachsen“ (GB 4, S. 366). Soweit möglich, werden in diesem Rahmen einzelne Werke in geschlossenen Interpretationen erörtert; andere wie der Grüne Heinrich kommen in unterschiedlichen Zusammenhängen unter jeweils neuen Aspekten zur Sprache. Als Leitlinie dient stets die Frage nach dem Bürgerlichen bei Keller. ‚Bürgerlichkeit‘ wird hier nicht in erster Linie auf objektive gesellschaftliche und ökonomische Verhältnisse bezogen, sondern als das Produkt der Mentalität, des Selbstverständnisses und der Sinndeutungen bestimmter Bevölkerungsgruppen aufgefasst, als „ein sozial bestimmter und kulturell geformter Habitus“17, der eine kollektive Identität stiftet. In seiner großen Studie zum Schweizer Bürgertum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts definiert Albert Tanner sie als
eine Art Daseins- und Lebensentwurf, der auf Arbeit, Leistung und Bildung, auf Rationalität, Selbstkontrolle und Eigenverantwortlichkeit, aber auch auf Individualisierung, Selbstreflexion und Intimität beruhte […]. Einen modellhaften Anspruch mit utopischem Beiklang hatte auch der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Das universal gedachte Ziel war eine sich selbst steuernde Gesellschaft freier und in rechtlicher und politischer Hinsicht gleicher Menschen, die ihr Zusammenleben vernünftig regeln.18
Besonderen unter Bürgerlichkeit verstand, soll dabei fortschreitend konkretisiert werden: im Blick auf Verhaltensweisen und Denkmuster, Familienver-hältnisse und Geschlechterrollen, Spielarten der Arbeit wie des ökonomischen Handelns, Politik und Zeitgeschichte sowie viele weitere Gebiete. So entsteht anhand dieses roten Fadens ein differenziertes Porträt des Autors Keller in seiner Zeit. Das zweite Kapitel und die erste Hälfte des dritten behandeln aber zunächst bestimmte weltanschauliche und poetologische Fragen, die für sein Denken und Schreiben von grundlegender Bedeutung sind.
Keller selbst wird in sämtlichen Abschnitten des Buches in Zitaten aus Werken und Briefen ausführlich zu Wort kommen. Die explizite Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Forschung muss dagegen schon wegen des beschränkten Platzes weitgehend in den Hintergrund treten, und aus demselben Grund enthält das Literaturverzeichnis im Anhang lediglich eine streng begrenzte Auswahl aus der mittlerweile kaum mehr zu überblickenden Fülle einschlägiger Arbeiten. Leser, die sich näher mit der Spezialliteratur befassen möchten, seien auf die Bibliographie von U. Henry Gerlach und das von Ursula Amrein herausgegebene Keller-Handbuch verwiesen.19