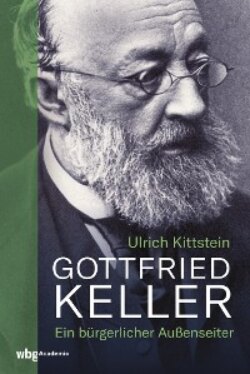Читать книгу Gottfried Keller - Ulrich Kittstein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Endlichkeit und Lebenslust
ОглавлениеDie wichtigsten lyrischen Zeugnisse für Kellers Feuerbach-Rezeption findet man in den Neueren Gedichten in einer Rubrik, die in der ersten Auflage des Bandes „Aus dem Leben“, in der zweiten „Aus der Brieftasche“ überschrieben ist. Dem Titel „Aus dem Leben“ fügte der Autor die Jahreszahl 1849 bei, womit er das gesamte Ensemble auf seine Heidelberger Zeit bezog, obwohl einige der Texte erst in Berlin entstanden waren. Die Gruppe bietet ein recht heterogenes Bild und umfasst mit den Nummern XIV bis XVI auch drei Gedichte, die auf eine unerfüllte Liebe Kellers zurückgehen (pikanterweise schwärmte die von ihm verehrte Johanna Kapp ihrerseits ausgerechnet für den verheirateten Ludwig Feuerbach!). Den Schwerpunkt der Abteilung machen aber die weltanschaulichen Thesen- und Bekenntnisgedichte aus, die Feuerbach’sches Gedankengut und zumal den Abschied vom Unsterblichkeitsglauben poetisch verarbeiten. Einige von ihnen seien hier näher betrachtet.
Mit einer trotzigen Absage an das „Trugbild der Unsterblichkeit“ und den „Wahn“ von einem „bess’re[n] Vaterland“ jenseits der irdischen Welt setzt schon das erste Gedicht der Reihe ein (13, S. 337). Es proklamiert überdies die innige Verbindung von memento mori und carpe diem, die gleichsam den Drehund Angelpunkt von Kellers neuer Haltung bildete. Das wache Bewusstsein von der Kürze des Daseins ruft bei dem Sprecher keine Wehmut hervor, sondern mahnt ihn vielmehr, der begrenzten Zeit eine größere Lebensintensität abzugewinnen, als sie das „Schrankenlose“ je gewähren könnte – das dritte Gedicht wird später bildkräftig vor der Torheit warnen, „die köstliche Neige Zeit/Mit dem Gedanken der Ewigkeit [zu] verdünnen“ (S. 338). Von den „holden Rosen“ lernt das lyrische Ich, seine Endlichkeit nicht nur fatalistisch hinzunehmen, sondern sich freudig mit ihr einverstanden zu erklären:
Zu glüh’n, zu blüh’n und ganz zu leben,
Das lehret euer Duft und Schein,
Und willig dann sich hinzugeben
Dem ewigen Nimmerwiedersein!
(S. 337)
Die Naturmotive, die in dem Zyklus auch sonst in großer Zahl begegnen, sind mehr als bloße poetische Schmuckelemente. Mit ihrer Hilfe macht Keller deutlich, dass der Mensch auf Erden keinen Sonderstatus als vermeintliches Ebenbild Gottes genießt, sondern wie alle anderen Wesen dem Naturgesetz der Vergänglichkeit unterliegt. Die natürlichen Phänomene werden für den Betrachter zum Medium der Selbsterkenntnis, zum anschaulichen Sinnbild und Gleichnis seiner eigenen Existenz.
Um einiges komplexer als das erste ist das zweite Gedicht der Gruppe mit seiner faszinierenden, aber auch etwas rätselhaften Bildersprache:
Die Zeit geht nicht, sie stehet still,
Wir ziehen durch sie hin;
Sie ist ein Karavanserai,
Wir sind die Pilger drin.
Ein Etwas, form- und farbenlos,
Das nur Gestalt gewinnt,
Wo ihr drin auf und nieder taucht,
Bis wieder ihr zerrinnt.
Es blitzt ein Tropfen Morgenthau
Im Strahl des Sonnenlichts –
Ein Tag kann eine Perle sein
Und hundert Jahre – Nichts!
Es ist ein weißes Pergament
Die Zeit und Jeder schreibt
Mit seinem besten Blut darauf
Bis ihn der Strom vertreibt.
An dich, du wunderbare Welt,
Du Schönheit ohne End’!
Schreib’ ich ’nen kurzen Liebesbrief
Auf dieses Pergament.
Froh bin ich, daß ich aufgetaucht
In deinem runden Kranz;
Zum Dank trüb’ ich die Quelle nicht
Und lobe deinen Glanz!
(13, S. 337f.)
Keller eröffnet die Verse mit einer frappierenden Wendung, die den vertrauten Topos vom unaufhaltsamen Gang der Zeit durch deren absoluten Stillstand ersetzt. Die Zeit ist für den Sprecher des Gedichts keine allgewaltige Macht, der sich der Mensch unterwerfen muss, sondern ein wesenloses „Etwas“, dem erst die lebendigen Individuen mit ihrem Tun und Treiben „Gestalt“ verleihen; sie ist das neutrale „weiße Pergament“, auf das jeder Einzelne mit seinem „besten Blut“ seine Lebensgeschichte schreibt. Darum wird das abstrakte Zeitmaß, das vom Empfinden einer persönlichen Existenz absieht, als leer und bedeutungslos verworfen. Es liegt allein beim Menschen, was er aus seiner Zeitspanne macht und wie er sie erlebt, und wo ein einziger Tag wie eine „Perle“ schimmern, ein volles Jahrhundert dagegen zu „Nichts“ zerrinnen kann, relativiert sich auch der Schrecken der Vergänglichkeit.
Da die Frist des Einzelnen aber nun einmal begrenzt ist und ein Werden und Vergehen – als ‚Auftauchen‘ und ‚Zerrinnen‘ – sich ohne die Vorstellung von einem übergreifenden Lauf der Zeit schwerlich denken lässt, kommt deren „Strom“ in der vierten Strophe doch noch ins Spiel, ohne dass der Widerspruch zu den Aussagen der vorangegangenen Verse geklärt würde. Ein wenig später preist der Sprecher plötzlich die „wunderbare Welt“ in ihrer Fülle, die damit unvermittelt neben die Farblosigkeit der neutralen Zeit tritt. Diese Welt scheint ewig, „ohne End’“ zu sein, während jeder Mensch nur als flüchtiges Phänomen in ihrer Sphäre erscheint. Dennoch ist es sein höchstes Glück, vorübergehend an ihr teilhaben zu dürfen, und so mündet das Gedicht in eine hymnische Liebeserklärung an die Schönheit der irdischen Wirklichkeit.
Immer wieder ist es Keller darum zu tun, das kurze Erdenleben zu verherrlichen und ihm gerade in seiner Begrenztheit Glanz und Leuchtkraft zu verleihen. „[U]nser aufblitzendes und verschwindendes Tanzen im Weltlichte“ nennt der weise Graf im Grünen Heinrich das Dasein des Menschen (12, S. 415), und das Gedicht XIII aus der Rubrik „Aus dem Leben“ wählt noch einmal andere Bilder, die diesmal auch breiter ausgeführt werden:
Liebliches Jahr, wie Harfen und Flöten,
Mit wehenden Lüften und Abendröthen
Endest du deine Bahn!
Siehst mich am kühlen Waldsee stehen,
Wo an herbstlichen Uferhöhen
Zieht entlang ein stiller Schwan.
Still und einsam schwingt er die Flügel,
Taucht vergnügt in den feuchten Spiegel,
Hebt den Hals empor und lauscht,
Taucht zum andern Male nieder,
Richtet sich auf und lauschet wieder,
Wie’s im klagenden Schilfe rauscht.
Und in seinem Thun und Lassen
Will’s mich wie ein Traum erfassen,
Als ob’s meine Seele wär’,
Die verwundert über das Leben,
Ueber das Hin- und Wiederweben,
Lugt und lauschet hin und her.
Trink’, o Seele nur in vollen Zügen
Dieses heilig friedliche Genügen,
Einsam, einsam auf der stillen Flur!
Und hast du dich klar und tief empfunden,
Mögen ewig enden deine Stunden:
Ihr Mysterium feierte die Natur!
(13, S. 347)
Thesenhaftigkeit und weltanschauliche Didaktik treten hier zunächst zugunsten der plastischen poetischen Gestaltung zurück. Ein Beispiel wohlkalkulierter Gedankenlyrik bleibt das Gedicht aber trotzdem, denn auf die in der ersten Hälfte entworfene Naturszenerie folgt in der zweiten deren Auslegung, wenn das lyrische Ich den Schwan mit seiner eigenen „Seele“ vergleicht und aus seinem Anblick wieder eine allgemeine Lebenslehre ableitet.
Obwohl der Herbst und der Abend traditionell Assoziationen an den Tod nahelegen, haftet dem einleitenden Bild keine Melancholie an; statt dessen gestaltet sich der Abschied des scheidenden Jahres als ein heiteres Fest für alle Sinne. Die zweite Strophe ist dann ganz dem einsam kreisenden Schwan gewidmet, der dem Sprecher anschließend zum Spiegel für das eigentümliche Wirklichkeitsverhältnis des menschlichen Individuums wird. Die sinnlichen Wahrnehmungen sind es, die den Bezug des Einzelnen zu seiner Umgebung herstellen. Dabei hebt der Dichter den tätigen, zielstrebigen Charakter dieser Weltaneignung hervor. ‚Lugen‘ und ‚lauschen‘ bezeichnen ja keine passive Reizaufnahme, sondern ein von Neugier getriebenes aktives Handeln, das zwischen Innen und Außen, Psyche und Welt vermittelt. So schlürft die Seele das „heilig friedliche Genügen“ der Natur „in vollen Zügen“ ein und findet dadurch wiederum zu einem klaren und tiefen Erleben ihrer selbst. Keller schließt sich Feuerbachs sensualistischem Einspruch gegen den philosophischen Idealismus an: Nicht in einem cartesianischen Akt der Reflexion, sondern in der höchstmöglichen Intensität sinnlich-leiblicher Weltzugewandtheit gelangt der Mensch auf den Gipfel seines Selbstgefühls und Selbstbewusstseins. Statt ‚Ich denke, also bin ich‘ müsste es jetzt heißen: ‚Ich empfinde, ich nehme wahr, also bin ich‘.
Wenn man berücksichtigt, dass der Schwan seit der Antike auch als Symbol des Dichters gilt, lässt sich überdies eine poetologische Lesart der Verse denken, und tatsächlich fasste Keller, wie später noch gezeigt werden soll, den echten Poeten als einen ‚Seher‘ im wörtlichen Verständnis auf, der das Schauspiel des Lebens aufmerksam verfolgt und es in seinen wesentlichen Zügen wiedergibt. Zwingend ist eine solche Deutung des Gedichts indes nicht, denn die sinnliche Freude an der irdischen Natur stellte für Keller „nach Feuerbach“ eine der humanen Kardinaltugenden schlechthin dar und bleibt in seinem Werk durchaus nicht auf Künstlerfiguren beschränkt. Kein Wunder, dass dieser Natur sogar das Attribut „heilig“ zugesprochen wird, hat sie doch als letzter Bezugspunkt des Menschenlebens die himmlische Seligkeit, die der christliche Glaube verspricht, abgelöst. Über das Diesseits hinauszudenken, verbietet sich das lyrische Ich. Ist der grandiose Höhepunkt des Erlebens einmal erreicht, so hat der Mensch sein Dasein erfüllt und kann gelassen den Augenblick erwarten, in dem es „ewig enden“ wird. Die schaffende „Natur“ – das ist nicht zufällig das letzte Wort des Gedichts! – zelebriert ihr fortwährendes „Mysterium“, indem sie stets aufs Neue individuelle Formen hervorbringt und wieder auflöst. Damit schlägt Keller den Bogen zu der festlichen Herbstabendstimmung des Anfangs: Der Einzelne soll seine „Bahn“ so heiter und sinnenfroh beschließen, wie es das zu Ende gehende Jahr tut.
Die übrigen Texte von „Aus dem Leben“ beziehungsweise „Aus der Brieftasche“ variieren die Feuerbach’schen Motive jeweils auf eigene Weise. Es finden sich unter ihnen spruchartige Verse in lehrhaftem Ton wie das Gedicht VIII, das dazu auffordert, „dem Tod in’s Aug’“ zu schauen, um das Leben wirklich genießen, aber auch mit „edle[m] Ernst“ führen zu können (S. 343); daneben stehen die entlarvende Rollenrede eines Heuchlers (XI) und das humoristische Genrebild eines philiströsen Pfäffleins, das seiner Gemeinde pflichtgemäß das ewige Leben anpreist, selbst aber noch nicht einmal mit einem einzigen freien Nachmittag etwas Vernünftiges anzufangen weiß (V). Mit dem Gedicht XVII setzt Keller einen gewichtigen Schlusspunkt (S. 349f.). Während die Zeitverhältnisse im zweiten Stück noch etwas unklar und widersprüchlich blieben, entfaltet dieser Text in einer präzisen Gedankenbewegung den Gegensatz zwischen der unendlich produktiven Natur und den vergänglichen individuellen Erscheinungen, der ein kosmisches Grundgesetz darstellt –
Aus dem tiefen blauen Raum
Perlt ihr leuchtend, goldne Sonnen,
Kommt und schwindet, wie ein Traum;
Doch gefüllt bleibt stets der Bronnen.
– und zugleich jeden einzelnen Menschen betrifft, wie sich der Sprecher bewusst macht:
Und nur du, mein armes Herz,
Du allein willst ewig schlagen,
Deine Lust und deinen Schmerz
Ewig durch die Himmel tragen?
Die eindringliche Mahnung, eine solche Hybris abzulegen, durchzieht als ethischer Imperativ den gesamten Zyklus und verdichtet sich noch einmal in den beiden Schlussversen: „Ewig ist, begreifst es du,/Sehnend Herz? nur deine Ruh!“
Den eben erörterten Gedichten, die ein vielgestaltiges lyrisches Zeugnis für Kellers Beschäftigung mit Feuerbach bilden, lässt sich der Grüne Heinrich als ein ebenso gewichtiges episches Dokument an die Seite stellen. Das betrifft vor allem die auf dem gräflichen Schloss angesiedelten Partien im vierten und letzten Band des Romans, weil Keller in der weltanschaulichen Bekehrung, die sein Protagonist dort erlebt, die eigenen Heidelberger Erfahrungen in künstlerischer Verfremdung nachgebildet hat. Insbesondere Dorothea Schönfund, auch Dortchen genannt, die Pflegetochter des Grafen, ist als glänzende Idealgestalt das Produkt einer poetischen Stilisierung. Sie repräsentiert in ihrer Schönheit, Güte, Unbefangenheit und Klugheit nicht nur ein weibliches Wunsch- und Sehnsuchtsbild des Autors, sondern vertritt auch die von Feuerbach verfochtenen Grundsätze in vollendeter Form. Ihre Ansichten basieren aber keineswegs auf mühevollen philosophischen Studien. Keller legt vielmehr großen Wert darauf, „daß Dortchen ganz auf eigene Faust“ alle metaphysischen Spekulationen verworfen hat, „und zwar nicht etwa in Folge angelernter und gelesener Dinge […], sondern auf ganz originelle Weise, so zu sagen von Kindesbeinen an“ (12, S. 413). Ihre „unschuldige gemüthliche Ueberzeugung“, die dem „kindlichsten und reinsten Herzen“ entspringt, erscheint als Frucht einer intuitiven Gewissheit, der keine Zweifel oder Einwände beikommen können. Sogar der gebildete Graf wurde, wie er Heinrich gesteht, erst durch Dorotheas entschiedene Haltung dazu bewogen, sich wieder näher mit „Gott und Unsterblichkeit“ zu befassen, und gelangte schließlich „auf dem Wege des Denkens und der Bücher“ dorthin, „wo das Kindsköpfchen von Hause aus gewesen“ (S. 414). Dass Keller diese strahlende Verkörperung der reinen Weltimmanenz ausgerechnet Dorothea nennt, ist übrigens eine tiefgründig-heitere Paradoxie, bedeutet der griechische Name doch nichts anderes als ‚Geschenk Gottes‘.
„Gott und Unsterblichkeit“ – so lautet Kellers feste Formel für den gesamten weltanschaulichen Komplex, auf den Feuerbachs Religionskritik zielt. Aber der Grüne Heinrich bestätigt, was schon in den Neueren Gedichten sichtbar wurde, nämlich dass den Dichter die beiden Elemente dieser Doppelwendung nicht im gleichen Maße interessierten. Dorothea leugnet zuerst und vor allem die individuelle Fortdauer nach dem Tode, weil sie „gar nicht absehen und glauben“ kann, „wie die Menschen unsterblich sein sollten“ (S. 414). Und wenn Keller nach seinem Feuerbach-Erlebnis behauptete, das Dasein werde durchaus nicht „prosaischer und gemeiner“, wenn man es als strikt begrenzt und endlich betrachte (GB 1, S. 275), sondern im Gegenteil „unendlich schöner und tiefer“, „wertvoller und intensiver“ (S. 290), so schuf er mit dem bezaubernden Dortchen eine leibhaftige Beglaubigung dieser These. In den Äußerungen des Grafen über seine Adoptivtochter klingen die einschlägigen Passagen aus den Heidelberger Briefen des Dichters fast wörtlich nach:
Wer sagt, daß es keine Poesie gebe ohne den Glauben an die Unsterblichkeit, der hätte sie sehen müssen; denn nicht nur das Leben und die Welt um sie herum, sondern sie selbst wurde durch und durch poetisch. Das Licht der Sonne schien ihr tausendmal schöner als anderen Menschen, was da lebt und webt war und ist ihr theuer und lieb, das Leben wurde ihr heilig und der Tod wurde ihr heilig […]. (12, S. 414)
Die Gottesfrage behandelt Dorothea dagegen nicht allein unabhängig von dem Problem der Unsterblichkeit, obwohl beides, wie der Graf einräumt, „[s]chulgerecht“ eigentlich „unzertrennlich“ ist, sondern auch mit größter Gelassenheit, indem sie sich zu einem souveränen Agnostizismus bekennt: „Ach Gott! es ist ja recht wohl möglich, daß Gott ist, aber was kann ich ärmstes Ding davon wissen? […] Ich gönne jedem Menschen seinen guten Glauben und mir mein gutes Gewissen!“ (S. 415) Sittlich notwendig erscheint also nur die strenge Diesseitsorientierung, die den Menschen darauf verpflichtet, sein unwiederholbares Dasein auf Erden im vollen Bewusstsein höchster Verantwortung zu gestalten, während die Meinungen über Gott ganz in das Belieben jedes Einzelnen gestellt sind.
Unter Dorotheas wohltätigem Einfluss legt auch Heinrich Lee, der bis dahin noch einem diffusen religiösen Glauben anhing, rasch den Weg zur „völligen Geistesfreiheit“ zurück (S. 423). Während „die anerzogenen Gedanken Dort duftete es gewaltig von tausend Blumvon Gott und Unsterblichkeit sich in ihm lösen und beweglich werden“, lernt er, die Welt mit den Augen eines echten Feuerbachianers zu sehen: „sie glänzte ihm in der That in stärkerem und tieferem Glanze“ (S. 416). Den Ernst und die Würde der neugewonnenen Haltung sichert, wie stets bei Keller, das Eingedenken des unausweichlichen Todes, auf das Dorothea Schönfund ihre diesseitig-weltliche Lebenslehre und Sittlichkeit gründet. Nicht von ungefähr findet Heinrichs erste Begegnung mit der jungen Frau auf dem Friedhof beim gräflichen Schloss statt. In ihren Gedanken ist der Tod allezeit gegenwärtig, aber natürlich nicht im Sinne christlich-barocker Weltflucht, sondern als Mahnung zum Leben: „Sie gewöhnte sich, zu jeder Stunde ohne Schrecken an den Tod zu denken, mitten in dem heitersten Sonnenschein des Glückes, und daß wir Alle einst ohne Spaß und für immer davon scheiden müssen. Dieser wirkliche Tod lehrt sie das Leben werth halten und gut verwenden und dies wiederum den Tod nicht fürchten“. Darum „vergeht kein Tag, an welchem sie nicht eine Stunde auf dem Kirchhofe zubringt. Dieser ist ihr Lustgarten, ihre Universität, ihr Schmollwinkel und ihr Putzzimmer, und bald kehrt sie fröhlich und übermüthig, bald still und traurig wieder zurück“ (S. 415).
Nicht nur in Dorotheas Umkreis entfaltet der Grüne Heinrich im Zeichen Feuerbachs eine förmliche Friedhofspoesie, die sich deutlich von der reichen Todes- und Gräbermotivik in Kellers früher Lyrik unterscheidet. Der Friedhof lehrt den Einzelnen, dass seine Zeit begrenzt ist, führt ihm aber zugleich den Naturprozess des unaufhörlichen Werdens und Vergehens vor Augen, dessen Rhythmus die flüchtige Existenz der Individuen überwölbt. So wird die Stätte des Todes zu einem Schauplatz des Lebens und Gedeihens. Ganz zu Beginn seiner Jugendgeschichte beschreibt Heinrich den „Gottesacker“ des Dorfes, aus dem seine Eltern stammen, und zeichnet das Bild eines Gartens, dessen fruchtbare Erde „das grünste Gras“ und „Rosen nebst dem Jasmin […] in göttlicher Unordnung und Ueberfülle“ hervorbringt (11, S. 64). Diesen Friedhof muss Heinrich überqueren, als er im Dorf zu Besuch ist und sich auf den Weg zu seiner Großmutter macht:
Dort duftete es gewaltig von tausend Blumen, eine flimmernde, summende Welt von Licht, Käfern und Schmetterlingen, Bienen und namenlosen Glanzthierchen webte über den Gräbern hin und her. […] Und unter diesem zarten Gewebe lag das Schweigen der Gräber und der Jahrhunderte, beredt und vollmächtig und schwoll hinunter bis in die Tage, wo dieser Zweig alemanischen Wandervolkes sich hier festgesetzt und die erste Grube gegraben. (S. 231)
Tod und Leben, Vergangenheit und Gegenwart verschlingen sich in einem ewigen Wechsel, der eine Mischung aus idyllischen und ehrfürchtigen Empfindungen, aber weder Furcht noch Grauen hervorruft. Das Romanfinale nimmt schließlich ein Motiv des Eingangs wieder auf und dämpft den verstörenden Eindruck, den der frühe Tod des Protagonisten auf den Leser machen muss, durch den tröstlichen Hinweis auf die unerschöpfliche produktive Kraft der Natur: Auch auf Heinrichs Grab ist mit der Zeit „ein recht frisches und grünes Gras gewachsen“ (12, S. 470).
Die Einstellung seiner Figuren zum Tod ist für Keller ein Probierstein, an dem sich ihr sittlicher Rang entscheidet. Beispielsweise schildern die Episoden um die wunderliche Frau Margreth im Grünen Heinrich zwei Männer, die beide von der Religion nichts wissen wollen, bis sich in der Todesstunde die Spreu vom Weizen trennt. Der eine nämlich, der Gott nur aus frivoler Spottlust geleugnet hat, stirbt „verzagt und zerknirscht, heulend und zähneklappernd und nach Gebet verlangend“, während der andere, ein gelassener, wortkarger Schreiner, „eben so ruhig und unangefochten seinen letzten Sarg hobelte, welchen er sich selbst bestimmte, wie einst seinen ersten“ (11, S. 117).
Ein Feuerbachianer avant la lettre ist Salomon Landolt in der Erzählung Der Landvogt von Greifensee aus den Züricher Novellen, die im 18. Jahrhundert spielt. Ihm gelingt es, einem zehnjährigen Kind, das unheilbar krank darniederliegt, die quälende Todesfurcht zu nehmen, ohne wohlfeile religiöse Tröstungen zu bemühen. Er spricht zu dem Jungen „in so einfachen und treffenden Worten von der Hoffnungslosigkeit seiner Lage, von der Notwendigkeit, sich zu fassen und eine kleine Zeit zu leiden, aber auch von der sanften Erlösung durch den Tod und der seligen, wechsellosen Ruhe, die ihm als einem geduldigen und frommen Knäblein beschieden sei“, dass der Kranke fortan wirklich „mit heiterer Geduld seine Leiden“ zu ertragen vermag (6, S. 152). Vollkommene, „wechsellose Ruhe“ ist, wie schon der Schlussstrophe des letzten Gedichts der Abteilung „Aus dem Leben“ zu entnehmen war, das Höchste, was ein Mensch, der dem Jenseitswahn entsagt hat, vom Tod erwarten darf. Als Gegenfigur zu Landolt kann der Pfarrer aus Kellers Seldwyler Erzählung Das verlorene Lachen gelten, der einem neumodischen Pseudo-Christentum huldigt, alle religiösen Dogmen, ohne sie offen preiszugeben, hinter einem Schwall unverbindlicher Worte verschwinden lässt und daher in der äußersten Probe kläglich versagt. Als ihn eine fromme Greisin auf dem Sterbebett „nach der Gewißheit des ewigen Lebens“ fragt, flüchtet er sich in „haltlose, unsichere Reden“, bis ihm die alte Frau den Rücken kehrt und ihre Angehörigen ihn nachdrücklich „ersuchen, [s]eine seelsorgerische Funktion hier einzustellen“ (5, S. 329).
Da ein Schüler Feuerbachs den Tod nicht scheuen soll, mag ihm auch ein greifbares Sinnbild der Sterblichkeit, wie es Landolts Großmutter ihr Eigen nennt, willkommen sein. Die alte Dame verwahrt in ihrer Kommode ein elfenbeinernes, „vier Zoll hohes Skelettchen mit einer silbernen Sense, welches das Tödlein genannt wurde“. Sie zieht in Kellers Augen jedoch die falsche Lehre aus diesem Menetekel, wenn sie ihrem heiratslustigen Enkel vorhält: „Sieh her, so sehen Mann und Frau aus, wenn der Spaß vorbei ist! Wer wird denn lieben und heiraten wollen!“ Salomon dagegen legt beim Anblick des „Tödleins“ die richtige Haltung an den Tag, denn der Gedanke „an die schnelle Flucht der Zeit und ihre Unwiederbringlichkeit“ treibt ihn erst recht dazu, mit aller Macht nach irdischer Liebe und Glück zu streben (6, S. 196). Seine Ehepläne scheitern zwar, doch das Leben versteht er trotzdem zu genießen, und zwar immer im mahnenden Schatten des Todes: Als er die Elfenbeinfigur später von der Großmutter erbt, stellt er sie „auf seinen Schreibtisch“ (S. 248).
Allerdings vermitteln Feuerbachs Lehren neben der intensiven Daseinsfreude eben auch ein tiefes Verantwortungsgefühl. Seit er dem Jenseitsglauben abgeschworen hatte, wurde der Tod für Keller „ernster“ und „bedenk licher“ (GB 1, S. 290), weil jemand, der sein Leben verpfuscht, keine Gelegenheit zur Wiedergutmachung mehr erhoffen darf. Das sollte die tragische Pointe des Grünen Heinrich sein, die leider nicht zum Tragen kam, da der Dichter das Romanfinale mit dem Tod der Mutter und des Sohnes nur in sehr verkürzter Form niederschreiben konnte. Besonders das „letzte Kapitel“ sei wegen des enormen Zeitdrucks „nicht ausgeführt“ worden, teilte er seinem Freund Hermann Hettner mit: „Dies Schlußkapitel sollte eigentlich ursprünglich etwa drei Kapitel stark werden und eine förmliche Elegie über den Tod bilden, indem hauptsächlich das aufgegebene Bewußtsein der persönlichen Unsterblichkeit dem Heinrich das Gewissen und Weiterleben schwer macht, da die Mutter dies einzige, einmalige und unersetzliche Leben für ihn verloren“ (S. 414).
Auch ganze Geschlechter und Nationen unterliegen nach Kellers Überzeugung dem Gesetz des ewigen Wandels, dem Rhythmus von Aufblühen und Vergehen. Der Graf im Grünen Heinrich macht sich keine Illusionen darüber, dass sein Stand mit dem Aufstieg der bürgerlichen Gesellschaft mehr und mehr zum Anachronismus wird, und würde am liebsten mitsamt seiner Familie sogleich „wieder untertauchen in die erneuende Verborgenheit. Ich selbst bin im Verfall des alten Reiches geboren und eigentlich schon ganz überflüssig, so daß sich unser Stamm müde fühlt in mir und nach kräftigender Dunkelheit sehnt“ (12, S. 395). In Das Fähnlein der sieben Aufrechten äußert der Zimmermeister Frymann ähnliche Gedanken sogar über die Schweizer Eidgenossenschaft, die ebenfalls nicht für die Ewigkeit gegründet sei:
Wie es dem Manne geziemt, in kräftiger Lebensmitte zuweilen an den Tod zu denken, so mag er auch in beschaulicher Stunde das sichere Ende seines Vaterlandes ins Auge fassen, damit er die Gegenwart desselben um so inbrünstiger liebe; denn alles ist vergänglich und dem Wechsel unterworfen auf dieser Erde. […] ein Volk, welches weiß, daß es einst nicht mehr sein wird, nützt seine Tage um so lebendiger, lebt um so länger und hinterläßt ein rühmliches Gedächtnis; denn es wird sich keine Ruhe gönnen, bis es die Fähigkeiten, die in ihm liegen, ans Licht und zur Geltung gebracht hat, gleich einem rastlosen Manne, der sein Haus bestellt, ehe denn er dahin scheidet. Dies ist nach meiner Meinung die Hauptsache. Ist die Aufgabe eines Volkes gelöst, so kommt es auf einige Tage längerer oder kürzerer Dauer nicht mehr an, neue Erscheinungen harren schon an der Pforte ihrer Zeit! (6, S. 277)
Dass Frymann hier als Sprachrohr Kellers fungiert, beweist dessen Prolog zur Schillerfeier in Bern 1859, der die Schweizer mit Blick auf „das Ende, das uns einst beschieden“, zu eifriger Tätigkeit und Pflichterfüllung aufruft, damit es in ferner Zukunft von ihnen heißen möge: „was diese werden konnten,/Das haben sie voll Lebensmut erfüllt!“ (9, S. 225) Der Gedanke der Vergänglichkeit ist demnach nicht nur für die private Sittlichkeit des Individuums fundamental, er bestimmt auch die öffentliche Moral und das politische Handeln. Kellers Verständnis der Historie betont weniger den universalen Entwicklungsgang der Menschheit, wie ihn die idealistischen Geschichtsphilosophen mit Hegel an der Spitze spekulativ zu konstruieren suchten, sondern eher das Nebenund Nacheinander unterschiedlicher Völker und Staaten mit jeweils beschränkter Lebensdauer. Von Skepsis und Geschichtsfatalismus wollte er gleichwohl nichts wissen, denn innerhalb jenes begrenzten Rahmens hielt er Fortschritte sehr wohl für möglich, weil jede individuelle Erscheinung, ob Einzelwesen oder Kollektiv, bestrebt sein müsse, in ihrer Zeitspanne alle ihre Möglichkeiten zu entfalten und auszuschöpfen. Als Paradebeispiel dafür dient im Grünen Heinrich die Geschichte der Schweiz in den dreißiger und vierziger Jahren, die Keller selbst miterlebt hatte und die ihm als ein „denkwürdiger, in sich selbst bedingter organischer Proceß“ erschien (12, S. 455).
Während der Dichter unter dem Eindruck von Feuerbachs Philosophie „Gott und Unsterblichkeit entsagte“ (GB 1, S. 246), lernte er von ihm noch obendrein, auf den Projektionscharakter religiöser Lehren und Überzeugungen zu achten. Wie die Menschen, so die Götter, die ihrer regen Einbildungskraft entspringen – das verkündet in burschikosem Ton der Apotheker von Chamouny:
Fische zeugen keine Vögel,
Feigen wachsen nicht auf Disteln,
Närr’sche Menschen, närr’sche Götter!
Keiner kann aus seiner Haut!
(14, S. 267)
In jedem Buch seines christlich-konservativen Landsmannes Jeremias Gotthelf erblickte Keller eine unfreiwillige, aber „treffliche Studie zu Feuerbach’s Wesen der Religion“, weil der „alte Donnergott und Wettermacher“, der in Gotthelfs bäuerlicher Welt regiert, exakt der Mentalität ihrer Bewohner angepasst sei (15, S. 91). Gott wird in diesen Romanen nicht auf subtile Weise symbolisch oder philosophisch aufgefasst, er belohnt vielmehr ganz direkt die Guten und straft die Bösen – nämlich die Ungläubigen –, denn das „Volk, besonders der Bauer, kennt nur Schwarz und Weiß, Nacht und Tag, und mag Nichts von einem thränen- und gefühlsschwangern Zwielichte wissen, wo Niemand weiß wer Koch oder Kellner ist“ (S. 92).
Von solchen Einsichten profitierte Keller auch bei der differenzierten Zeichnung seiner eigenen Figuren, vor allem im Grünen Heinrich. Äußert sich die phantastische Versponnenheit der alten Margreth in einer wunderlichen, magisch-mystisch eingefärbten und von vielen Elementen des Volksaberglaubens durchsetzten Christlichkeit, so ist Gott für Heinrichs Mutter, die sparsame Hausfrau mit dem „einfachen und nüchternen Gemüth“, nicht etwa der „Befriediger und Erfüller einer Menge dunkler und drangvoller Herzensbedürfnisse“, sondern schlicht der „versorgende und erhaltende Vater, die Vorsehung“ (11, S. 94), die das tägliche Brot garantiert. Heinrich selbst wiederum kultiviert, bis er Dortchen Schönfund kennenlernt, ein Gottesbild, in dem sich seine persönlichen „Zustände und Bedürfnisse“ unmittelbar abspiegeln (12, S. 118). Wenn er beispielsweise eine höhere Legitimation für seine Ambitionen als Maler sucht, stellt er sich einen „großen und mächtigen Kunstgönner“ im Himmel vor, der ihn als „Freund und Schutzpatron der Landschaftsmaler“ behüten und geleiten soll (11, S. 269). Schon als Keller mit der Arbeit an der Jugendgeschichte des Protagonisten begann, notierte er sich: „Nicht zu vergessen […] H’s Gott so schildern, wie H. selbst ist. Naivetät mit welcher er seine willkürl. genial. Subjektivität zu seinem Gotte macht“ (16.2, S. 185).
Während Dorothea und der Graf auf dem Standpunkt Feuerbachs stehen, weil sie eben großherzige und geistig freie Menschen sind, kommen die orthodoxen Christen im Grünen Heinrich begreiflicherweise sehr viel schlechter weg. Der „wegen seiner Frömmigkeit und Strenggläubigkeit berühmte Pfarrherr“ (11, S. 98) in der Binnengeschichte von der kleinen Meret repräsentiert das düstere Zerrbild einer unmenschlichen, lebensfeindlichen Religion. Sein brutaler Fanatismus veranschaulicht eine Kernthese aus Feuerbachs Wesen des Christentums, indem er zeigt, wie das christliche Liebesgebot durch eine dogmatische Intoleranz pervertiert wird, über die sich zudem allerlei sadistische Gelüste befriedigen lassen. Daneben weiß Heinrich von einem gewissen Herrn Oelfinger zu berichten, der die Angewohnheit hatte, „sich immer für etwas Anderes zu geben, als er war“ (S. 392), und dafür vehement den Glauben seiner Mitmenschen einzufordern. Gerade dieser geborene Lügner und Heuchler bekannte sich eifrig zum Christentum als „derjenigen Lehre, welche den unbedingten Glauben zum Panier erhebt“ (S. 393), bis ihm die fatale Verkehrtheit seines Wesens eines Tages zum Verhängnis wurde. Die Wurzeln engstirniger Religiosität liegen für Keller in Selbstbezogenheit, Geltungsdrang, Rechthaberei, Unwahrhaftigkeit und krasser Realitätsverkennung.
Heinrichs Oelfinger-Geschichte und die Auseinandersetzung mit der Frage des Glaubens gehören in den Zusammenhang seines Konfirmationsunterrichts, der ihm den Anlass liefert, die „inneren christlichen Grundlehren“ (S. 386) Punkt für Punkt einer radikalen Kritik zu unterziehen. Der Stellenwert dieses ausladenden Exkurses über die vermeintliche Sündhaftigkeit des Menschen, über den Glauben, die Liebe und den göttlichen Geist ist nicht leicht zu bestimmen. Über weite Strecken liest er sich wie eine kaum verhüllte weltanschauliche Positionsbestimmung des Autors Gottfried Keller20, doch gelegentlich treten auch die Auffassungen des fiktiven Ich-Erzählers Heinrich Lee in den Vordergrund, der zwar kein rechter Christ ist, zu diesem Zeitpunkt aber zumindest noch an Gott und der Vorsehung festhält.
Das Dogma von der Erbsünde, die angeblich auf jedem Menschen lastet, leuchtet Heinrich nicht ein. Er ersetzt das zerknirschte Sündenbewusstsein durch die pragmatische Ansicht, „daß man jeden Augenblick sich selbst klaren Wein einschenken soll, nie und in keiner Weise sich einen blauen Dunst vormachen, sondern das Unzulängliche und Fratzenhafte, das Schwache und Schlimme sich und Anderen offen eingestehen“ (S. 387). Eine solche aufrichtige Selbsterforschung schafft die Voraussetzungen für jede sinnvolle Tätigkeit und Pflichterfüllung. In der Tat trachten sämtliche positiven Gestalten bei Keller danach, mit sich im Reinen zu sein und ihre Stellung in der Welt illusionslos zu erfassen – eine Tugend, deren hoher Wert für den Dichter begreiflich wird, wenn man bedenkt, wie lange er selbst vergeblich auf eine Laufbahn als Maler hoffte, bis er endlich sein wahres Talent erkannte.
Vom Glauben, der im Konfirmationsunterricht als nächstes an die Reihe kommt, war bereits kurz die Rede. Heinrich polemisiert gegen die „nackte und gewaltsame Forderung des Glaubens“ (S. 396), die ihm widersprüchlich und psychologisch abwegig vorkommt. Er vermag im Glauben kein Verdienst zu erkennen und erklärt dessen Verknüpfung mit der ewigen Seligkeit für absurd. Der universalen Liebesethik des Christentums kann er ebenso wenig abgewinnen, weil er sich außerstande fühlt, „auf Befehl und theoretisch“ zu lieben (S. 397), und überdies starke Zweifel hegt, ob die christliche Religion die Liebe in der Welt wirklich vermehrt hat. Anklang findet bei ihm einzig „die Lehre vom Geiste, als welcher ewig ist und Alles durchdringt.“ Sie wird jedoch so eigenwillig ausgelegt, dass sie schon ganz pantheistisch-immanent klingt: „Gott ist nicht geistlich, sondern ein weltlicher Geist, weil er die Welt ist und die Welt in ihm; Gott strahlt von Weltlichkeit“ (S. 398).
Indem er den ursprünglichen „berechtigte[n] Gehalt“ der christlichen Lehre (S. 386) gegen ihre institutionelle Erstarrung und das fatale „Autoritäts- und Pfaffenwesen“ ausspielt (S. 399), äußert der Protagonist in diesen Romanpassagen Ansichten, wie sie auch sein Schöpfer Keller schon lange vor der Begegnung mit Feuerbach vertreten hatte. Mit Blick auf die biblischen Schriften wird ebenfalls eine wichtige Unterscheidung getroffen. Für Heinrich ist die Bibel „ein Buch der Sage, zart und luftig und weise wie alle Sage“ und faszinierend in ihrer „poetischen Meisterschaft und künstlerischen Vernunftmäßigkeit“. Sobald diese „wunderbarsten Ausgeburten menschlicher Phantasie“ aber, losgelöst von ihrem fernen historischen Ursprung und ihrer Eigenart als dichterische Schöpfung, zur Grundlage einer Staatsreligion erhoben und als Glaubensinhalt verbindlich gemacht werden, verwandeln sie sich „mit Einem Schlage zu einem beängstigenden Unsinn“, von dem nun die ganze gesellschaftliche Existenz des Bürgers abhängt (S. 385). Hier spricht Heinrich Lee wieder vollkommen im Sinne Kellers, der die Bibel als ein Produkt der Poesie außerordentlich schätzte und gerne Anspielungen auf sie in seine Texte einfließen ließ, in der Regel freilich in bezeichnenden Umdeutungen, die schwerlich orthodoxen Beifall gefunden hätten.
Man darf Keller indes nicht unterstellen, er habe gläubige Christen nach seinem Feuerbach-Erlebnis durchweg abwertend und missgünstig porträtiert. In der ersten seiner vier Rezensionen zu den Romanen Jeremias Gotthelfs erscheint das „strenge, positive Christenthum“ sogar in einem recht freundlichen Licht: „Etwas ist besser als gar Nichts, und mit einem Menschen welcher den gekreuzigten Gottmenschen verehrt ist immer noch mehr anzufangen als mit Einem der weder an die Menschen noch an die Götter glaubt.“ Wo die „reine Humanität“ noch nicht erreicht sei, könne die „Religiosität“ wenigstens vorläufig ihre Stelle vertreten (15, S. 78). So werden in Kellers Werk auch aufrichtige gottesfürchtige Menschen mit unverkennbarer Sympathie geschildert. Zu ihnen zählen neben der schon erwähnten Mutter des grünen Heinrich gleich mehrere Figuren aus Das verlorene Lachen. Die Großmutter der Heldin Justine ist „alt- und rechtgläubig“ (5, S. 284) und liest eifrig in der Bibel, aber sie zeigt sich zugleich großzügig, tolerant und voller Humor, sogar im Umgang mit der Religion. Auch eine greise katholische Pilgerin, die zu einem Marienwallfahrtsort wandert und dabei fleißig ihren Rosenkranz betet, zieht weder Spott noch Herablassung auf sich, weil sie ganz in ihrem Glauben aufgeht und sich darin „wohlgemut und sicher“ fühlt (S. 332). Und schließlich sucht Justine, von schweren Glaubenszweifeln gequält, zwei Frauen – Mutter und Tochter – auf, deren naive Frömmigkeit ihnen trotz Armut und Krankheit „eine vollkommene Zufriedenheit und Seelenruhe“ verschafft (S. 333). Die beiden gehören einer urchristlichen Sekte an, die das Jüngste Gericht nahe wähnt. Justines Hoffnung, „das Geheimnis ihres Friedens und ihres Glaubens zu erforschen und ihrer Glückseligkeit teilhaftig zu werden“ (S. 333), zerschlägt sich jedoch, denn Ursula und Agathchen haben nichts „Neues und Unerhörtes“ und schon gar kein religiöses Patentrezept zu bieten. Auf die drängenden Fragen ihrer Besucherin bringen sie lediglich mechanisch „die alte harte und dürre Geschichte vom Sündenfall, von der Versöhnung Gottes durch das Blut seines Sohnes, der demnächst kommen werde, zu richten die Lebendigen und die Toten, von der Auferstehung des Fleisches und der Gebeine, von der Hölle und der ewigen Verdammnis und von dem unbedingten Glauben an alle diese Dinge“ vor (S. 345). Justine muss einsehen, „daß die guten Frauen ihren Frieden wo anders her hatten, als aus ihrer Kirchenlehre, und ihn nicht mit dieser verschenken konnten“ (S. 346).
Für Keller entscheiden die Wesensart und das Tun und Lassen des Einzelnen über seinen sittlichen Rang und sein Glück, nicht das dogmatische Bekenntnis, das er auf den Lippen trägt. Im Grünen Heinrich versichert der Graf seinem jungen Gast:
Was nun Ihren lieben Gott betrifft, lieber Heinrich, so ist es mir ganz gleichgültig, ob Sie an denselben glauben oder nicht! Denn ich halte Sie für einen so wohlbestellten Kautz, daß es nicht darauf ankommt, ob Sie das Grundvermögen Ihres Bewußtseins und Daseins außer sich oder in sich verlegen, und wenn dem nicht so wäre, wenn ich denken müßte, Sie wären ein Anderer mit Gott und ein Anderer ohne Gott, so würden Sie mir nicht so lieb sein, so würde ich nicht das Vertrauen zu Ihnen haben, das ich wirklich empfinde. (12, S. 417)
In Kellers Werken können fromme Menschen durchaus auch gute Menschen sein, aber sie sind nicht deshalb gut, weil sie fromm sind.
Der Autor teilte zweifellos die Haltung seines grünen Heinrich, der bei aller Abneigung gegen das kirchliche Christentum doch beteuert: „Ich würde mich schämen, wenn ich jemals dahin kommen würde, Jemanden seines Glaubens wegen zu verachten oder zu verhöhnen, oder den Gegenstand desselben nicht zu ehren, wenn der Gläubige darin seinen Trost findet“. Die „nackte und gewaltsame Forderung des Glaubens“ weist Heinrich aber entschieden zurück (11, S. 396), und auch Keller überzieht jede religiöse Gesinnung, hinter der autoritäre Intoleranz oder Unwahrhaftigkeit und Selbstgefälligkeit stehen, mit bitterem Hohn. Der Pfarrer aus Das verlorene Lachen vereint alle diese Untugenden in einer Person, und in Die Jungfrau und der Teufel, einer der Sieben Legenden, liefert der Dichter mit der Schilderung des Grafen Gebizo das unübertreffliche Porträt eines religiösen Heuchlers. Als die exzessiven wohltätigen Spenden, die er aus purem Geltungsdrang tätigt, sein Vermögen erschöpft haben, lässt sich der Graf mit dem Leibhaftigen ein und verkauft ihm seine schöne Frau Bertrade, um den Lohn des Teufelspakts sogleich in neue fromme Stiftungen zu investieren. Der Erzähler spießt diesen grotesken Widersinn mit köstlicher Ironie auf: Gebizo lässt „eine mächtige Abtei für fünfhundert der frömmsten und vornehmsten Kapitularen“ errichten, „in deren Mitte dereinst seine Begräbnisstätte sein sollte. Diese Vorsicht glaubte er seinem ewigen Seelenheil schuldig zu sein. Da über seine Frau anders verfügt war, so wurde eine Grabstätte für sie nicht vorgesehen“ (7, S. 358f.).
Der kleine Zyklus der Sieben Legenden ist unter allen Erzählwerken Kellers wohl am deutlichsten von den in der Heidelberger Zeit erworbenen weltanschaulichen Grundsätzen geprägt. Die Idee zu dieser feuerbachianisch inspirierten Verfremdung einer traditionsreichen Gattung religiöser Zweckliteratur ging auf die Berliner Jahre zurück. Zeitweilig war sie Teil eines größeren Projekts, das Keller anfangs „Galatea“ betiteln wollte und aus dem später das Sinngedicht erwuchs. 1857/58 schrieb er die erste Fassung der Legenden nieder, deren Manuskript erhalten ist, unternahm aber vorläufig keine Schritte zur Veröffentlichung. Noch im April 1871 teilte er Heyse mit, er habe „eine Anzahl Novellen ohne Lokalfärbung“ in der Schublade liegen, „die ich alle 1½ Jahr einmal besehe und ihnen die Nägel beschneide, so daß sie zuletzt ganz putzig aussehen werden“ (GB 3.1, S. 19). Erst eine Anfrage des Verlegers Ferdinand Weibert im folgenden Sommer brachte Bewegung in die Sache, und 1872 – in Feuerbachs Todesjahr übrigens – lag das fertige Bändchen vor, das sich auf Anhieb gut verkaufte und bei den Zeitgenossen zu Kellers populärsten Schöpfungen zählte. Der Dichter, der damals bereits mit dem Gedanken spielte, das Staatsschreiberamt niederzulegen, betrachtete diesen Erfolg „als ein aufmunterndes Glückszeichen […] für eine anhaltende Wiederaufnahme und Abrundung [s]einer poetisch-literarischen Existenz“ (GB 3.2, S. 232).
Die Anregung und den Stoff für das Werk bezog er aus den 1804 publizierten Legenden des Pfarrers Ludwig Theoboul Kosegarten. Allerdings gewannen die erbaulichen Geschichten unter seiner Hand eine ganz ungewohnte Physiognomie, und die kleine Einleitung zu den Sieben Legenden bereitet den Leser schonend darauf vor: Der Verfasser habe in seinen Vorlagen neben der „kirchliche[n] Fabulierlust […] auch die Spuren einer ehemaligen mehr profanen Erzählungslust oder Novellistik zu bemerken“ geglaubt und sie in seiner „Reproduktion“ stärker herausarbeiten wollen, wobei den Erzählungen „freilich zuweilen das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend hingewendet wurde, als nach welcher sie in der überkommenen Gestalt schauen“ (7, S. 333). In einem Brief an Ferdinand Freiligrath aus dem Jahre 1860 hatte Keller sein Verfahren noch weitaus drastischer charakterisiert:
Ich fand nämlich eine Legendensammlung von Kosegarten in einem läppisch frömmelnden und einfältiglichen Stile erzählt (von einem norddeutschen Protestanten doppelt lächerlich) in Prosa und Versen. Ich nahm 7 oder 8 Stück aus dem vergessenen Schmöker, fing sie mit den süßlichen und heiligen Worten Kosegärtchens an und machte dann eine erotisch-weltliche Historie daraus, in welcher die Jungfrau Maria die Schutzpatronin der Heiratslustigen ist. (GB 1, S. 268)
Die Eigenart der Sieben Legenden als Gegenentwurf, als ‚Parodie‘ im wörtlichen Sinne, ist damit treffend bezeichnet. Während sie die groben Linien des Handlungsablaufs ihrer Vorlage verdanken, ersetzen sie die strenge „Entsagung, Aufopferung, Selbstverläugnung“, die Kosegarten in seiner Vorrede ausdrücklich ins Zentrum der christlichen Lehre rückt21, durch den irdischen Glücksanspruch des Menschen, der sich, wie so oft bei Keller, am besten in der ehelichen Liebe einlösen lässt. Daher trägt Maria als „Schutzpatronin der Heiratslustigen“ auch sehr weltliche, sinnenfrohe Züge und kann in der Legende vom schlimm-heiligen Vitalis sogar ohne weiteres mit Juno, der heidnischen „Beschützerin ehelicher Zucht und Sitte“, verschmelzen (7, S. 404).
Feuerbach hatte die katholische Marienverehrung in einem Aufsatz von 1842 als entstellte Manifestation legitimer menschlicher Bedürfnisse und Sehnsüchte gedeutet. Als ein „Kultus des Weibes“ und der „Frauenliebe“ sei sie eigentlich der Verherrlichung der Schönheit und des sinnlichen Verlangens gewidmet. Weil das Christentum den Liebesgenuss aber auf Erden verbiete und als einen rein geistigen vollständig in den Himmel verlagere, werde Maria zugleich zur asketischen Repräsentantin der Keuschheit, des „naturund geschmackwidrigen Prinzips der Abstinenz“, und damit zu einer höchst unpoetischen, ja geradezu perversen Gestalt.22 Ob Keller diese Ausführungen im Original gelesen hat, muss offen bleiben, ist aber auch nicht von Belang, da ihre Tendenz ohnehin durch das bekannte religionskritische Interpretationsschema des Philosophen vorgegeben war. In seinem Werk bemühte sich der Dichter jedenfalls, die entrückte Gestalt der Gottesmutter, in der auch er eine christliche „Maske“ für die nie restlos zu unterdrückende „heidnische Lebens- und Liebeslust“ erkannte23, auf den Erdboden zurückzuholen. Schon im Grünen Heinrich preist ein Schmied, der vornehmlich religiöse Kultgegenstände verfertigt und daher allgemein „der Gottesmacher“ genannt wird, Maria als den Inbegriff weiblicher „Milde und Schönheit“, als Schutzherrin der Künste und Verkörperung aller Reize der Natur: „sie war mir Mütterchen, Geliebte, göttliche Fürbitterin, Muse in Bild und Tönen, und überdies belebte sie wie eine allgegenwärtige Göttin die Fluren meiner schönen Heimath“ (12, S. 216). Da er offenkundig keine erhabene Himmelskönigin anbetet, sondern ein vom Menschen geschaffenes Sinnbild für die Herrlichkeit der Welt verehrt, ist es dem Gottesmacher ziemlich gleichgültig, „daß derlei katholische Dinge von aufgeklärten oder auch nur unbefangenen Leuten nicht mehr geglaubt werden“, denn einem poetischen Symbol können religiöse Zweifel nichts anhaben: „warum wollen wir die selige Menschgöttin unserer Jugendzeit, die uns Unschuld und Anmuth bedeutet, so ohne Weiteres absetzen?“
(S. 217)
Wenn einige der Sieben Legenden davon erzählen, wie Maria auf wundersame Weise die Sehnsucht nach Liebe und Glück erfüllt, enthüllen sie damit gleichfalls den Charakter dieser „Menschgöttin“ als Projektion, als Wunschbild, das einzig in der literarischen Fiktion eine konkrete Gestalt annehmen und handelnd in Erscheinung treten kann. Allerdings zählen, anders als es Kellers pauschale Bemerkung gegenüber Freiligrath suggeriert, mit Die Jungfrau und der Teufel, Die Jungfrau als Ritter und Die Jungfrau und die Nonne lediglich drei der sieben Geschichten zum Genre der Marienlegenden. Von ihnen sei vorerst nur die zuletzt Genannte für eine nähere Interpretation herausgegriffen. Kosegarten lieferte dem Dichter hier eine sehr dürftige Vorlage. Die Nonne Beatrix wird bei ihm „von sündlichen Gedanken gar heftig angefochten“ und verlässt heimlich ihr Kloster, um sich „dem gemeinen Leben“ zu ergeben, dessen Details sich der Leser selbst ausmalen muss.24 Als sie nach fünfzehn Jahren reumütig zurückkehrt, stellt sie fest, dass Maria während der ganzen Zeit in ihrer Gestalt ihre Stellung als Küsterin ausgefüllt hat. Dies alles wird in wenigen dürren Sätzen eher lakonisch referiert als wirklich geschildert.
Dass Kellers Version der Legende um ein Vielfaches umfangreicher ausfällt, ist hauptsächlich der ausführlichen Beschreibung geschuldet, die er dem profanen Leben der entwichenen Nonne widmet. Plastisch malt er schon die unstillbare Begierde der schönen Beatrix aus, die von dem hochgelegenen Kloster weit umher schauen kann „in das Weben der blauen Gefilde; sie sah Waffen funkeln, hörte das Horn der Jäger aus den Wäldern und den hellen Ruf der Männer, und ihre Brust war voll Sehnsucht nach der Welt“ (7, S. 377). Und als ihr dann nach ihrer Flucht die Freuden dieser „Welt“ in leibhaftiger Gestalt erscheinen, werden sie wie eine Epiphanie inszeniert und in glänzendes Licht getaucht: „Da kam die Sonne über die Baumkronen und ihre ersten Strahlen, welche durch die Waldstraße schossen, trafen einen prächtigen Ritter, der völlig allein in seinen Waffen daher geritten kam“ (S. 378). Der stattliche Mann trägt den vielsagenden Namen Wonnebold, und prompt werden die beiden ein Paar und ziehen auf die Burg des Ritters: „So ruhte denn Beatrix mit ihm und stillte ihr Verlangen“ (S. 380). Ein gefährliches Abenteuer, das ihre Liebesgemeinschaft beinahe zerstört, muss noch bestanden werden, aber dann führen Beatrix und Wonnebold ein vorbildliches Eheleben, dem nicht weniger als acht Söhne entspringen.
Die Heimkehr der Entflohenen ins Kloster übernimmt Keller wieder von Kosegarten, doch von Reue und Buße ist bei ihm keine Rede. Die gealterte Beatrix scheint nur „etwas müde […] vom Leben“ zu sein und Ruhe zu suchen (S. 384); erfolgte ihr Auf- und Ausbruch einst in einer schönen Juninacht, so fällt die Rückkehr in den Herbst, der auch den Herbst des Lebens bedeutet. Dank des Eingreifens der Gottesmutter hat niemand ihre Abwesenheit bemerkt. Aber was Kosegarten als unverdiente Gnade Marias für einen sündigen Menschen hinstellt, signalisiert bei Keller eher eine stillschweigende Billigung von Beatrix’ Handeln. Das abschließende Wunder, das sich einige Jahre später an einem Marienfest ereignet und das in der Vorlage natürlich kein Gegenstück hat, räumt die letzten Zweifel aus: Die Früchte des genussreichen Weltlebens der Nonne, ihre acht wohlgeratenen Söhne, die unter Wonnebolds Führung zufällig beim Hochamt in der Klosterkirche erscheinen, werden von Maria durch „acht Kränze von jungem Eichenlaub, welche plötzlich an den Häuptern der Jünglinge zu sehen waren, von der unsichtbaren Hand der Himmelskönigin darauf gedrückt“, als die „reichste Gabe“ bezeichnet, die man ihr an ihrem Festtag zum Geschenk machen konnte (S. 385). Damit führt Keller seine Umkehrung von Kosegartens orthodoxen Wertungen konsequent zu Ende. Und in ihrer wunderbaren Farbigkeit demonstriert seine Legende auch ganz augenfällig, welchen poetisch-ästhetischen Gewinn die Absage an die weltfeindliche Askese zugunsten der reichen Fülle der irdischen Wirklichkeit verspricht.
Während Die Jungfrau und die Nonne Daseinsfreude und Sinnengenuss feiert, sind andere Legenden Kellers komplexer angelegt und vermitteln tiefere psychologische Einsichten, insbesondere zu den verborgenen Motiven religiöser Überzeugungen und eines schwärmerischen Jenseitsverlangens. In Eugenia, der ersten Erzählung der Reihe, die im spätrömischen Alexandria spielt, wirft sich die Titelheldin so einseitig auf hochgeistige philosophische Studien, dass sie alle Weiblichkeit und Natürlichkeit einzubüßen droht. Nachdem sie den Heiratsantrag des Prokonsuls Aquilinus abgewiesen hat, weil der Bewerber ihre Gelehrsamkeit nicht hinreichend zu schätzen weiß, fühlt sie sich aber doch „nicht wohl und zufrieden“ (7, S. 341), ohne die Ursache dieses Unbehagens zu durchschauen. Einen Ausweg verheißt die Religion: Eugenia bekehrt sich nicht nur zum Christentum, sondern verleugnet nunmehr auch ihr Geschlecht ganz und gar, indem sie, als Mann verkleidet, in ein Mönchskloster eintritt. Indes entlarvt Keller den geistlichen Enthusiasmus auf subtile Art als verstellte Manifestation des so energisch verleugneten sinnlichen Liebesverlangens. Bei Kosegarten, der die Geschichte einer vorbildlichen Glaubensheldin erzählt, bekehrt sich Eugenia zum Christentum, als sie aus einer Kirche „die Worte des Psalms“ vernimmt: „Der Heiden Götter sind Götzen; der Herr aber hat den Himmel gemacht“ (Ps 96,5).25 Keller lässt die Gläubigen ein anderes Lied anstimmen, das sehr viel lockender und leidenschaftlicher tönt: „Wie eine Hindin nach den Wasserquellen, so lechzet meine Seele, o Gott! nach dir! Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott!“ (Ps 42,2f.) Darauf heißt es: Eugenias „Herz ward getroffen und schien zu wissen, was es wolle“ (7, S. 342). Wahre Befriedigung findet dieses Herz jedoch erst viel später, als die Heldin ihren Irrweg endlich verlässt, das Klosterdasein mit einem Leben als Gattin des Aquilinus vertauscht und sich „mit eben der gründlichen Ausdauer, welche sie sonst der Philosophie und der christlichen Askese gewidmet, dem Studium ehelicher Liebe und Treue“ hingibt (S. 353). Eugenias Mönchsgewand wird zum äußeren Zeichen der fatalen Entfremdung von den irdischen Genüssen, die dem Menschen bestimmt sind. Es abzustreifen, bedeutet die erlösende Rückkehr zu einer wahrhaft humanen Existenz.
Die Legende Dorotheas Blumenkörbchen legt ein ähnliches religionspsychologisches Verständnis nahe, denn hinter Dorotheas „zärtlichsten und sehnsüchtigsten“ Reden „von einem himmlischen Bräutigam, den sie gefunden, der in unsterblicher Schönheit auf sie warte“, verbirgt sich nur die „fruchtlose Liebe“ zu dem jungen Theophilus, die an unglücklichen Missverständnissen gescheitert ist (S. 415f.) – ein Motiv, das in Kosegartens Vorlage fehlt. Das christliche Vokabular muss hier also wieder uneigentlich verstanden werden und fungiert bloß als Medium irdischen Verlangens; die Religion wird „für die Liebenden zu einem ihnen unbewußten Kommunikationsträger ihrer Liebe“.26 Dementsprechend deutet Keller auch das Wunder um, das Dorotheas christliche Überzeugungen beglaubigt. Nach ihrer Hinrichtung durch den eifersüchtigen heidnischen Statthalter erscheint dem Theophilus ein schönes Kind, mehr Erosknabe als christlicher Engel, und überreicht ihm ein Körbchen mit Rosen und ein paar Äpfeln, „leicht angebissen von zwei zierlichen Zähnen, wie es unter den Liebenden des Altertums gebräuchlich war“ (S. 419). Folgerichtig eröffnet der Märtyrertod, den nun auch Theophilus bereitwillig auf sich nimmt, den Weg in ein höchst untypisches Jenseits, dessen Seligkeit in der vollkommenen Gemeinschaft des innig verbundenen Paares besteht: „wie zwei Tauben, die, vom Sturme getrennt, sich wieder gefunden und erst in weitem Kreise die Heimat umziehen, so schwebten die Vereinigten Hand in Hand“, wobei sie aber zugleich auch „alle Kreatur und alles Dasein mit süßer Liebe“ erfassen (S. 419).
Eine ähnliche Psychologie der christlichen Religiosität trifft man in einigen Geschichten jenseits des Legenden-Zyklus an, etwa in Das verlorene Lachen oder in Ursula, der letzten der Züricher Novellen. Auch Justines Glaubenseifer bietet ihr eine Zuflucht in Zeiten seelischer Bedrängnis. Nach einem Zerwürfnis mit ihrem Gatten Jukundus hofft sie, „ihre Gedanken zu beschäftigen und ihr Gemüt zu befriedigen“ (5, S. 320), indem sie sich aufopferungsvoll für die Belange der Kirchengemeinde einsetzt, ohne zu bemerken, wie hohl die neumodische Christlichkeit ist, die der Pfarrer in wohltönenden Worten verkündet. Und Ursula, die sich unter dem Einfluss einer Wiedertäufersekte noch vor der Hochzeit mit dem braven Hansli Gyr entzweit hat, verschiebt ihre enttäuschte irdische Neigung gleichfalls in die Sphäre der Religion, denn der Erzengel Gabriel, der „englische Herr und himmlische Baron“ (6, S. 375), von dem sie sich geliebt glaubt, ist nichts anderes ein verklärtes Spiegelbild des menschlichen Bräutigams. Beide Protagonistinnen finden am Ende doch noch mit dem geliebten Mann jenes Glück, das sie zeitweilig in schwärmerischer Verrückung vom christlichen Glauben erwarteten. Wer auf Erden ein erfülltes Leben führt, hat es nicht nötig, sich in der unbestimmten Sehnsucht nach einer chimärischen höheren Seligkeit zu verlieren.
Was könnte das Himmelreich dem Menschen überhaupt bieten? Einige Male hat Keller es tatsächlich gewagt, poetische Visionen einer jenseitigen Ewigkeit zu entwerfen, aber keine davon trägt rundum verlockende Züge. In dem Gedicht Creszenz aus dem Zyklus „Von Weibern“ in den Neueren Gedichten fühlt sich die einsame Sprecherin, die ihre Jugend und ihr Lebensglück verscherzt hat, der Welt entrückt und dem Himmel nahe, doch der ist seinerseits „kalt“ und von einer freudlosen Erstarrung geprägt:
Da sitzt Maria auf dem goldnen Thron,
Auf ihrem Schooße schläft ihr sel’ger Sohn.
Da sitzt Gott Vater, der den heil’gen Geist
Aus hohler Hand mit Himmelskörnern speist.
In einem Silberschleier sitz’ ich dann
Und schaue meine weißen Hände an,
Bis irgend eine Harfensaite springt
Und mir erschreckend durch die Seele klingt.
(13, S. 191f.)
Auch die Geschichte von Dorothea und Theophilus in Dorotheas Blumenkörbchen ist mit der beglückenden Gemeinsamkeit, die den beiden nach dem Tod zuteil wird, nicht abgeschlossen, denn es folgt noch eine letzte Wendung des Geschehens: „Aber einst gerieten sie in holdestem Vergessen zu nahe an das krystallene Haus der heiligen Dreifaltigkeit und gingen hinein; dort verging ihnen das Bewußtsein, indem sie, gleich Zwillingen unter dem Herzen ihrer Mutter, entschliefen und wahrscheinlich noch schlafen, wenn sie inzwischen nicht wieder haben hinauskommen können“ (7, S. 420). Was fromme Christen ersehnen, die Verschmelzung mit Gott in der unio mystica, schwankt bei Keller zwischen dem Gefühl absoluter Geborgenheit wie bei Kindern im Mutterleib und einer Gefangenschaft, die mit dem Verlust des eigenen Ich assoziiert wird. Verglichen mit dem freien Dahinschweben der Liebenden in seliger Zweisamkeit mutet dieser Schluss jedenfalls recht beklemmend an: „Der heidnische, lebendige Eros ist in den Gravitationsbereich des christlichen Dogmas geraten und dort entschlafen.“27
Schließlich entführt auch das Tanzlegendchen, das Schlussstück der Sieben Legenden, seine Leser in den Himmel. Anfangs folgt es ungewöhnlich getreu dem traditionellen Gattungsschema. Die Heldin Musa, ein „anmutvolles Jungfräulein“, kennt nur „ eine Leidenschaft“, nämlich eine „unbezwingliche Tanzlust“ (S. 421), den Inbegriff sinnlicher Lebensfreude. Doch eines Tages erscheint ihr der biblische König David, einen Trupp musizierender Engel im Gefolge, und preist ihr die Genüsse der „ewige[n] Seligkeit“ an, die in einem „unaufhörlichen Freudentanze“ bestünden, gegen den der weltliche „ein trübseliges Schleichen zu nennen sei“ (S. 422). Um dieses Glückes teilhaftig zu werden, habe Musa „nichts Anderes zu thun, als während ihrer irdischen Lebenstage aller Lust und allem Tanze zu entsagen und sich lediglich der Buße und den geistlichen Uebungen zu weihen“. Das Mädchen gehorcht dem Appell, sich „durch zeitliche Entsagung“ die „ewige Freude“ zu verdienen (S. 423), führt fortan ein streng asketisches Dasein und lässt sich, weil die Begierde zu tanzen nicht weichen will, sogar die Füße zusammenketten. Nach drei Jahren stirbt Musa an Entkräftung und geht sogleich ins Reich der Seligen ein: „Man sah noch, wie sie in den offenen Himmel sprang, und augenblicklich tanzend sich in den tönenden und leuchtenden Reihen verlor“ (S. 425).
Ganz ernst zu nehmen ist dieser Legendenhimmel aber nicht; er wirkt eher wie das kunstvoll-künstliche Produkt eines heiteren poetischen Spiels, das seinen Inszenierungscharakter nicht verleugnet. König David und seine mutwilligen Engelsmusikanten – augenscheinlich lebendig gewordene Putten! – sind geradewegs dem Rokoko entsprungen, und bei Musas Tod öffnet sich der Himmel vor aller Augen wie auf einer barocken Theaterbühne. Das Jenseits ist im Tanzlegendchen ein Ort, der die Freuden des Lebens von aller Erdenschwere befreit und obendrein ins Unendliche verlängert, und damit nur ein traumhaft gesteigertes Spiegelbild der vertrauten Welt, das unschwer als Sehnsuchtsprojektion begriffen werden kann.
Mit der Entrückung der Heldin in den Himmel, die auch die Vorlage bei Kosegarten beschließt, endet die Geschichte in der handschriftlichen Fassung von 1857/58 (vgl. 23.2, S. 223). Erst später führte Keller die Erzählung weiter und verlieh ihr damit ein Gewicht, das ihr in der Reihe der Sieben Legenden eine Sonderstellung verschafft. Der Einschnitt zwischen den beiden Teilen ist nicht zu übersehen, denn Musa tritt jetzt in den Hintergrund, um den neun Musen, ihren Namens- und Geistesverwandten, Platz zu machen, die für gewöhnlich mit den anderen antiken Sagengestalten in der Hölle sitzen, an hohen Festtagen aber befristet im christlichen Himmel aushelfen dürfen. Dort finden sie freundliche Aufnahme, und Maria verspricht sogar, „sie werde nicht ruhen, bis die Musen für immer im Paradiese bleiben könnten“ (7, S. 426) – ein hoff-nungsfroher und im Rahmen dieses Zyklus einmaliger Ausblick, der eine utopische Synthese von Christentum und heidnischer Sinnenlust, von Spiritualismus und Sensualismus verheißt, deren Widerspruch sich in Musas Geschichte noch so schroff manifestiert hat.
Doch auch dabei wollte es der Autor letztlich nicht bewenden lassen, und so fügte er noch während der Drucklegung der Sieben Legenden einige weitere kurze Abschnitte an, die die schöne Zukunftsvision unbarmherzig zertrümmern. Wenn die Musen, um „sich für die erwiesene Güte und Freundlichkeit dankbar zu erweisen und ihren guten Willen zu zeigen“, im Himmel einen eigens einstudierten Choral anstimmen, erzielen sie damit eine Wirkung, die keineswegs ihren Absichten entspricht: „Aber in diesen Räumen klang er so düster, ja fast trotzig und rauh, und dabei so sehnsuchtsschwer und klagend, daß erst eine erschrockene Stille waltete, dann aber alles Volk von Erdenleid und Heimweh ergriffen wurde und in ein allgemeines Weinen ausbrach“. Das „ganze Paradies mit allen Erzvätern, Aeltesten und Propheten, alles, was je auf grüner Wiese gegangen oder gelegen“, gerät durch den Gesang „außer Fassung“ (S. 427).
Keller verfolgt in der literarischen Fiktion ein kühnes Gedankenspiel: Wie erginge es dem Menschen wohl, wenn ihm das erträumte grenzenlose Glück im Jenseits, von dem die christliche Lehre spricht, tatsächlich offen stünde? Verlangt der Gläubige auf Erden inständig nach der himmlischen Seligkeit, so wird diese Richtung im Tanzlegendchen provozierend umgekehrt. Dabei ist die Kombination von „Erdenleid und Heimweh“ ebenso paradox wie folgerichtig, „weil das Irdische in all seiner Hinfälligkeit und seinem Schmerz das eigentliche Leben ist, höheren Realitätsgrad besitzt als das Ewige, das es sich gefallen lassen muß, hier als die Langeweile der undramatischen Vollkommenheit verstanden zu werden.“28 Intensität und Leuchtkraft gewinnt das menschliche Dasein für Keller ja gerade aus dem Bewusstsein seiner unwiderruflichen Begrenztheit, und ohne die Erfahrung von Schmerz und Kummer lässt sich auch eine echte Glückserfüllung schwerlich denken. Der einzige vorstellbare Raum einer wirklich humanen Existenz ist deshalb die sinnlich greifbare irdische Sphäre, die Welt, in der man „auf grüner Wiese“ gehen und liegen kann, mit allen ihren Mängeln und Gebrechen. Wer diese Einsicht unterdrücken und die traditionelle Hierarchie von Himmel und Erde aufrecht erhalten will, muss zu gewaltsamen Mitteln greifen, und genau das tut „die allerhöchste Trinität selber“, indem sie „die eifrigen Musen mit einem lang hinrollenden Donnerschlage zum Schweigen“ bringt und damit in einem drakonischen Akt der Zensur eine fragwürdige „Ruhe“ wiederherstellt (S. 427). Der Zutritt zum Himmelreich bleibt den neun Schwestern fortan verwehrt, weil schon ihre bloße Anwesenheit die Fundamente der christlichen Weltanschauung (und Weltverneinung) in Frage stellen würde.
Noch 1872, als Keller die Sieben Legenden publizierte, die so stark von Feuerbachs Ideen geprägt sind, dürfte er die Thesen des Philosophen als verbindlich und gültig erachtet haben. In einigen späteren Bemerkungen klingt freilich eine gewisse Distanz an. So beklagte der Autor 1882 in einem Brief an seine Vertraute Marie Frisch Feuerbachs „störrischen Ernst“ und seinen „etwas aufgeblasenen Idealismus“ (GB 2, S. 289), und ein Jahr zuvor hatte er sich einem anderen Korrespondenzpartner gegenüber einlässlicher zum Thema ‚Feuerbach und die Religion‘ geäußert:
Über die philosophische Zeitfrage ließe sich Weiteres sagen. Ich könnte mich nicht mehr ganz so fassen wie vor dreißig Jahren, ohne vom freien Gedanken abgegangen zu sein. Das seither entstandene Getümmel hat letzteren kühler und ruhiger werden lassen. Der Satz Ludwig Feuerbachs: Gott ist nichts anderes als der Mensch! besteht noch zu Recht; allein eben deshalb kann man nicht sagen: der Mensch ist Gott! insofern das zweite Substantivum nun doch wieder etwas Größeres ausdrücken soll als das erste. (GB 4, S. 227f.)
Diese Einschränkung war allerdings keineswegs neu und stand auch nicht im Widerspruch zu Feuerbachs Lehren. Dass die Absetzung Gottes dem Menschen zur klaren Erkenntnis seiner Endlichkeit und Sterblichkeit verhelfen müsse und nicht etwa in narzisstische Hybris münden dürfe, hatte Keller von Anfang an unterstrichen. Das philosophierende Schulmeisterlein im Grünen Heinrich zieht seinen Spott auf sich, weil es Feuerbachs Auffassung in diesem Punkt auf naive Weise missversteht:
[W]enn Feuerbach sagte: Gott ist nichts Anderes, als was der Mensch aus seinem eigenen Wesen und nach seinen Bedürfnissen abgezogen und zu Gott gemacht hat, folglich ist Niemand als der Mensch dieser Gott selbst, so versetzte sich der Philosoph sogleich in einen mystischen Nimbus und betrachtete sich selbst mit anbetender Verehrung, so daß bei ihm, indem er die religiöse Bedeutung des Wortes immer beibehielt, zu einer komischen Blasphemie wurde, was im Buche die strengste Entsagung und Selbstbeschränkung war. (11, S. 365)
Bei der Überarbeitung seines Romans, ein Vierteljahrhundert später, ließ Keller diese Passage unverändert stehen (vgl. 1, S. 314f.). Um die Grenze zwischen Feuerbachs authentischen Ansichten und manchen fragwürdigen Formen ihrer Rezeption noch stärker hervorzuheben, führte er in der Zweitfassung überdies eine weitere „Karikatur“ eines Feuerbach-Jüngers ein (3, S. 197), einen gewissen Peter Gilgus, der als „Apostel des Atheismus“ durch die Lande zieht und mit penetrantem Enthusiasmus die Schönheit der irdischen Welt preist, „nachdem der liebe Gott aus derselben weggeschickt worden“ (S. 194). Während aber der „Philosoph“, der diese Lehre zuerst verkündet hat – Feuerbachs Name wird hier nicht genannt –, als echter „Weltweise[r]“ in „freiwilliger Armut und Bedürfnislosigkeit“ lebt (S. 195), weiß Gilgus aus seinem Bekenntnis handfesten Profit zu ziehen, indem er sich fortwährend bei wohlhabenden Gesinnungsgenossen selbst zu Gast lädt. Diese einträgliche Angewohnheit führt ihn auch auf das Schloss des Grafen, wo er dem eben erst zur strikten Diesseitsorientierung bekehrten Heinrich Lee wie ein warnendes verzerrtes Spiegelbild entgegentritt. Torheit, Eitelkeit und Selbstsucht sind bei Keller keineswegs auf orthodoxe Gläubige beschränkt, sondern können sich mit jeder beliebigen Weltanschauung verbinden.
Auch Toleranz ist für Gilgus ein Fremdwort, und der zelotische Feuerbachianer wirkt um keinen Deut sympathischer als sein Gegenstück, der dogmatische christliche Eiferer: Den Bauern auf den gräflichen Gütern predigt er wortreich, „sie sollten Buße thun und von ihrem heidnischen Gottesglauben ablassen“ (S. 202). Für Keller dagegen, der alle ideologischen Verhärtungen zu vermeiden suchte, verbanden sich die Feuerbach’schen Vorstellungen mit einer großen Duldsamkeit in Glaubensdingen. „[I]ch werde nie ein Fanatiker sein und die geheimnisvolle schöne Welt zu allem Möglichen fähig halten, wenn es mir irgend plausibel wird“, beteuerte er schon in jenem Brief aus Heidelberg, in dem er Baumgartner seine Begegnung mit Feuerbachs Philosophie schilderte (GB 1, S. 275), und er weigerte sich, „jeden, der an Gott und Unsterblichkeit glaubt, für einen kompletten Esel zu halten“, auch wenn er zuversichtlich darauf rechnete, dass „nach und nach alle Menschen zur klaren Erkenntnis kommen“ würden (S. 290f.). Die Hoffnung, durch seinen eigenen Sinneswandel mit einem Schlag „ein besserer und strengerer Mensch“ zu werden, hatte er ohnehin rasch wieder aufgegeben (S. 246), und wenn er Baumgartner versicherte, gläubige Menschen, die „unter Atheismus nichts weiter als rohen Materialismus zu verstehen imstande sind, würden freilich auch als Atheisten die gleichen grob sinnlichen und eigensüchtigen Bengel bleiben, die sie als ‚höhere‘ Deisten schon sind“ (S. 290), bekräftigte er einmal mehr den Vorrang des Charakters und des individuellen Ethos vor dem weltanschaulichen Bekenntnis.
Vorurteilsfreie Offenheit gilt auch dem Grafen im Grünen Heinrich als höchstes Gut und als unverzichtbare Grundlage einer freien, humanen Gesellschaft. In einem Plädoyer, das nach wie vor äußerst zeitgemäß anmutet, fordert er „vollkommene Sicherheit des menschlichen Rechtes und der menschlichen Ehre bei jedem Glauben und jeder Anschauung, und zwar nicht nur im Staatsgesetz, sondern auch im persönlichen vertraulichen Verhalten der Menschen zu einander. […] Uebrigens geht der Mensch in die Schule alle Tage und keiner vermag mit Sicherheit vorauszusagen, was er am Abend seines Lebens glauben werde! Dafür haben wir die unbedingte Freiheit des Gewissens nach allen Seiten“ (12, S. 417f.). Von dem gelassenen Agnostizismus seiner Adoptivtochter war bereits an früherer Stelle die Rede, und in der zweiten Fassung des Romans stellt sich Dorothea sogar auf den Standpunkt: „Bei Gott ist alles möglich, auch daß er existiert!“ (3, S. 181) Zuletzt sei noch Jukundus Meyenthal aus Das verlorene Lachen zitiert, der nachdrücklich empfiehlt, sich im Blick auf religiöse Fragen „ganz vergnügt und friedlich still [zu] halten“ (5, S. 354) und nicht ständig „Lehrämter über das zu errichten, was keiner den andern lehren kann, wenn er ehrlich und wahr sein will“ (S. 304). Religion ist demnach Privatsache, mit der jeder es halten mag, wie es ihm gut dünkt. Ihre Bedeutung wird, wie man ergänzen darf, ohnehin schwinden, sobald der Mensch erst einmal die eigenverantwortliche Gestaltung der irdischen Welt als seine Aufgabe angenommen und gelernt hat, in der diesseitigen Wirklichkeit die Quelle seines Glücks und seiner Leiden zu sehen. Jukundus verliert deshalb kein Wort mehr über die Möglichkeit einer individuellen Unsterblichkeit. An ihre Stelle tritt mit der Zukunft der menschlichen Gattung auf Erden eine Art immanenter Transzendenz: Eine wohlgepflegte Baumschule wertet der Protagonist als hoffnungsvolles Zeichen für die selbstlose Aufmerksamkeit, mit der die Menschen „Pflichten der Vorsorge für die ihnen unbekannten künftigen Geschlechter“ erfüllen (S. 353).
Dass die eben erwähnten fiktiven Figuren Kellers eigene Gedanken im Munde führen, erhellt beispielsweise aus dem Kommentar zu einem neuen Gesetz über das kantonale Kirchenwesen, den er 1861 veröffentlichte. Er begrüßt darin ausdrücklich die Verpflichtung der Heranwachsenden zum Besuch der kirchlichen Kinderlehre „vom 12. bis 16. Altersjahre“ (15, S. 231) – aber eben nicht schon früher, wie von manchen Seiten gefordert. Zwar wird die „Selbstverliebtheit heutiger Priester“ angeprangert und auch bedacht, wie leicht Sprösslinge aus freisinnigen Familien in einen Zwiespalt zwischen den elterlichen Erziehungsmaximen und der kirchlichen Unterweisung geraten können, doch andererseits hält Keller es für „gut und nützlich, daß jedes Landeskind mit allen übrigen gleichmäßig bei der Landeskirche in die Lehre gehe“, um später kompetent beurteilen zu können, „was der kirchliche Staat eigentlich glaubt“ (S. 232). „Mit dem 16. Jahre“, so schließen seine Überlegungen, „ist Jeder frei und kann sich je nach den Eindrücken, die er empfangen, weiter verhalten.“ Der Gesetzgeber müsse solche Fragen souverän „als reine Geistesangelegenheiten, als Sache der freien menschlichen Bildung behandeln“ (S. 232f.). Ganz in diesem Sinne äußert sich später auch der Titelheld des Romans Martin Salander, der es „angesichts der Stellung, welche die christliche Religion in der Weltgeschichte wie im Leben der Gegenwart einnimmt“, für undenkbar hält, „den Kindern deren Inhalt zu unterschlagen“. Nur wenn sie wüssten, „was bis auf ihre Zeit bestanden hat“ und „was die Religion selbst von sich sagt“, könnten sie im „Alter der Mündigkeit“ aus eigener Kraft und Einsicht eine „freie Ueberzeugung“ entwickeln (8, S. 254). Offensichtlich hat Keller jene umfassende Toleranz in religiösen und weltanschaulichen Dingen, die er schon vor seiner Heidelberger Lehrzeit bekundete, ungebrochen in die Phase „nach Feuerbach“ hinübergerettet.