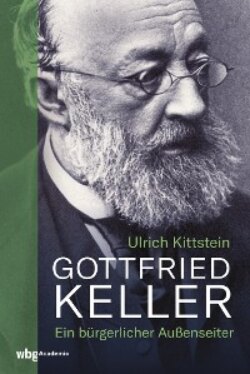Читать книгу Gottfried Keller - Ulrich Kittstein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. VOM DASEIN IM DIESSEITS: KELLER UND LUDWIG FEUERBACH Vor und nach Feuerbach
ОглавлениеKeller hatte erst wenige Monate in Heidelberg zugebracht, als er den Freunden in der Heimat bereits einen wichtigen Ertrag seiner Bildungsreise melden konnte. Er werde „in gewissen Dingen verändert zurückkehren“, kündigte er einem Bekannten am 8. Februar 1849 an (GB 2, S. 458), und gegenüber seinem engsten Vertrauten, dem Komponisten Wilhelm Baumgartner, war er ein paar Tage zuvor noch deutlicher geworden: „Ich werde tabula rasa machen (oder es ist vielmehr schon geschehen) mit allen meinen bisherigen religiösen Vorstellungen“ (GB 1, S. 274). Ausgelöst wurde diese folgenreiche Wende durch die Bekanntschaft mit Ludwig Feuerbach, dem „himmelstürmenden Philosophen“, wie Keller ihn noch Jahre später respektvoll titulierte (GB 2, S. 98), der die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele leugnete und den Menschen ganz auf das diesseitige, irdische Leben verwies. Feuerbach hielt im Winter 1848/49 in Heidelberg Vorlesungen, die als Einführung in seine Gedankenwelt konzipiert waren. Er las jedoch nicht an der Universität, da ihm der akademische Betrieb wegen seiner provozierenden Thesen zeitlebens verschlossen blieb, sondern im Rathaussaal vor einem sehr gemischten Publikum, in dem sich „Arbeiter, Studenten und Bürger“ zusammenfanden (15, S. 419). Keller gehörte von Anfang an dazu und pflegte bald auch privat einen freundschaftlichen Umgang mit Feuerbach, der einem guten Glas Rotwein nicht abgeneigt war. Die Persönlichkeit des Philosophen scheint den fünfzehn Jahre jüngeren Dichter damals ebenso tief beeindruckt zu haben wie seine Lehre.
Feuerbachs Philosophie markiert einen Höhepunkt jener säkularisierenden Tendenzen, die im 18. und 19. Jahrhundert den Einfluss religiöser Deutungsmuster und Orientierungen im Geistesleben wie im Alltag mehr und mehr zurückdrängten. Ihre Resonanz bei den Zeitgenossen war gewaltig, obwohl Feuerbach nicht im engeren Sinne schulbildend wirkte. In den Heidelberger Vorlesungen über das Wesen der Religion, die 1851 im Druck erschienen, bezeichnete er sein Räsonnement ausdrücklich als „aphoristisch“1, und in der Tat lag ihm mehr an produktiven Denkanstößen als an der Errichtung eines strengen philosophischen Systems. Dennoch kannten seine Reflexionen so etwas wie einen archimedischen Punkt, und der Autor des Grünen Heinrich hatte nicht ganz Unrecht, wenn er sie dort mit einem „monotonen […] Gesang“ verglich (12, S. 420), der unablässig denselben Grundgedanken umkreist. Dieser „einfache und klare Gedanke“, dessen „allseitige Ausführung“ Keller als Feuerbachs selbstgewählte „Lebensaufgabe“ bezeichnete (GB 1, S. 362), bestand in der Auffassung, dass religiöse Vorstellungen bloße Produkte der Einbildungskraft seien, Projektionen, in denen der Mensch sich, ohne es zu wissen, letztlich selbst anschaue. In Feuerbachs eigenen Worten – hier in einer Passage aus seinem 1841 veröffentlichten Hauptwerk Das Wesen des Christentums – lautet diese Kernthese:
Die Religion, wenigstens die christliche, ist das Verhältnis des Menschen zu sich selbst oder richtiger: zu seinem (und zwar subjektiven) Wesen, aber das Verhalten zu seinem Wesen als zu einem andern Wesen. Das göttliche Wesen ist nichts andres als das menschliche Wesen oder besser: das Wesen des Menschen, gereinigt, befreit von den Schranken des individuellen Menschen, verobjektiviert, d.h. angeschaut und verehrt, als ein andres, von ihm unterschiednes, eignes Wesen – alle Bestimmungen des göttlichen Wesens sind darum menschliche Bestimmungen.2
Bündiger drücken es die Heidelberger Vorlesungen aus: „meine Lehre ist kürzlich die: Die Theologie ist Anthropologie, d.h., in dem Gegenstande der Religion, den wir griechisch ‚theos‘, deutsch ‚Gott‘ nennen, spricht sich nichts andres aus als das Wesen des Menschen“3 – nicht des einzelnen freilich, sondern der gesamten Gattung in der Fülle ihrer Möglichkeiten. Wie Feuerbach diese Überzeugung begründete und welche Schlussfolgerungen er daraus zog, sei im Folgenden etwas näher erläutert. Um einen Eindruck vom Denk- und Schreibstil des Philosophen zu vermitteln, soll dabei ausführlich aus seinen Schriften zitiert werden, insbesondere aus den Vorlesungen, die Keller seinerzeit hörte.
Feuerbach war anfänglich ein Schüler Hegels gewesen, hatte sich dann jedoch von dessen Geist-Philosophie abgewandt, um fortan den ganzen Menschen mit allen seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten an die Stelle dialektischer Begriffsspekulationen zu rücken. Er verabschiedete damit die Tradition des vermeintlich ‚reinen‘ Denkens, die bislang in der abendländischen Philosophie der Neuzeit dominiert hatte. Für Feuerbach war Erkenntnis stets konkret und anschaulich und mit Gefühlen und Leidenschaften verbunden. Nicht die abstrakte Vernunft sei ihr Subjekt, sondern das ganzheitliche, erlebende, begehrende, nach Glück strebende, aber auch liebende und solidarische Individuum: „Der Mensch denkt, nicht das Ich, nicht die Vernunft.“4 Einen Zugang zur Realität und zur Wahrheit könnten nur der Leib und die Sinne gewähren, die deshalb auch als die „bleibende Grundlage“ jeder philosophischen Reflexion angesehen werden müssten.5 Die Religion stellte für Feuerbach ein Resultat der produktiven Tätigkeit solcher Individuen dar. Gott sei nichts anderes als eine idealisierte Vorstellung des menschlichen Gattungswesens, das man sich hier von sämtlichen peinlichen Einschränkungen der irdischen Welt losgelöst denke: „Das göttliche Wesen also ist das Wesen des Menschen, aber nicht, wie es der prosaischen Wirklichkeit nach ist, sondern wie es den poetischen Forderungen, Wünschen und Vorstellungen des Menschen nach ist oder vielmehr sein soll und einst sein wird.“6 Diese Argumentation gipfelt in der pointierten Umkehrung einer zentralen biblischen Aussage: „der Mensch schuf […] Gott nach seinem Bilde“.7
Religiöse Glaubenssätze waren für Feuerbach keineswegs abwegig oder nichtig. Er wollte die Theologie nicht einfach verwerfen, sondern sie vielmehr als verkappte, gleichsam entfremdete Anthropologie neu interpretieren: „Unser Verhältnis zur Religion ist daher kein nur negatives, sondern ein kritisches; wir scheiden nur das Wahre vom Falschen“.8 Was der Mensch jahrtausendelang auf Gott projiziert habe – beispielsweise reine Güte und Liebe oder auch schöpferische Kraft –, müsse er endlich zurückgewinnen und sich selbst aneignen, um so erst seine Gattungsbestimmung erfüllen zu können:
Der notwendige Wendepunkt der Geschichte ist daher dieses offne Bekenntnis und Eingeständnis, daß das Bewußtsein Gottes nichts andres ist als das Bewußtsein der Gattung, daß der Mensch sich nur über die Schranken seiner Individualität erheben kann und soll, aber nicht über die Gesetze, die positiven Wesensbestimmungen seiner Gattung, daß der Mensch kein andres Wesen als absolutes Wesen denken, ahnden, vorstellen, fühlen, glauben, wollen, lieben und verehren kann als das Wesen der menschlichen Natur.9
Der einzige denkbare Raum für diese Selbstverwirklichung der menschlichen Gattung sei die irdische Welt. Den Glauben an einen Schöpfer und ein himmlisches Jenseits wies Feuerbach kategorisch zurück. Die Natur sei „Ursache ihrer selbst, […] kein Geschöpf, kein gemachtes oder gar aus nichts geschaffnes, sondern ein selbständiges, nur aus sich zu begreifendes, nur von sich abzuleitendes Wesen“.10 Sie bilde den Rahmen, in dem der Mensch als eigenverantwortlicher Gestalter seines Schicksals sein Dasein einzurichten habe. Bildung, Kultur und vernünftige Selbstbestimmung sollten die religiösen Hoffnungen und den naiven Wunderglauben verdrängen, und der Mensch, der „an die Stelle des Himmels die Erde setzt“11, werde endlich auch Ziele anstreben, die seinen Bedürfnissen besser entsprächen als die asketischen Werte des christlichen Glaubens: „Unser Ideal sei kein kastriertes, entleibtes, abgezogenes Wesen, unser Ideal sei der ganze, wirkliche, allseitige, vollkommene, ausgebildete Mensch. Nicht nur das Seelenheil, nicht nur die geistige Vollkommenheit, auch die körperliche Vollkommenheit, die körperliche Wohlfahrt und Gesundheit gehöre zu unserem Ideal!“12
Feuerbach beschränkte sich, wie man sieht, nicht auf theoretische Überlegungen; sein Denken war eminent lebenspraktisch ausgerichtet und an verbindlichen ethischen Maximen interessiert. Die neue, atheistische Anthropologie verstand er als eine positive, aufbauende Botschaft: „die Verneinung des Jenseits hat die Bejahung des Diesseits zur Folge; die Aufhebung eines besseren Lebens im Himmel schließt die Forderung in sich: Es soll, es muß besser werden auf der Erde; sie verwandelt die bessere Zukunft aus dem Gegenstand eines müßigen, tatlosen Glaubens in einen Gegenstand der Pflicht, der menschlichen Selbsttätigkeit.“13 Gegen Ende der Heidelberger Vorlesungen tritt diese Tendenz immer deutlicher hervor. Feuerbachs finaler Appell an sein Publikum, sich die ganze Verantwortung des Menschengeschlechts bewusst zu machen, sei noch einmal vollständig wiedergegeben, denn er hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt:
Wenn wir nicht mehr ein besseres Leben glauben, sondern wollen, aber nicht vereinzelt, sondern mit vereinigten Kräften wollen, so werden wir auch ein besseres Leben schaffen, so werden wir wenigstens die krassen, himmelschreienden, herzzerreißenden Ungerechtigkeiten und Übelstände, an denen bisher die Menschheit litt, beseitigen. Aber um dieses zu wollen und zu bewirken, müssen wir an die Stelle der Gottesliebe die Menschenliebe als die einzige, wahre Religion setzen, an die Stelle des Gottesglaubens den Glauben des Menschen an sich, an seine Kraft, den Glauben, daß das Schicksal der Menschheit nicht von einem Wesen außer oder über ihr, sondern von ihr selbst abhängt, daß der einzige Teufel des Menschen der Mensch, der rohe, abergläubische, selbstsüchtige, böse Mensch, aber auch der einzige Gott des Menschen der Mensch selbst ist.14
Und wenn der Redner die „Aufgabe“ seiner Vorlesungen abschließend resümiert, fasst er die Zielsetzung aller seiner philosophischen Bestrebungen zusammen: Er beabsichtige, die Zuhörer „aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden, aus Gläubigen zu Denkern, aus Betern zu Arbeitern, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus Christen, welche ihrem eigenen Bekenntnis und Geständnis zufolge ‚halb Tier, halb Engel‘ sind, zu Menschen, zu ganzen Menschen zu machen.“15
Bevor seine Popularität in der zweiten Jahrhunderthälfte merklich zurückging, wurden Feuerbachs Ideen, die ein modernes, rein innerweltliches Menschenbild entwarfen, vor allem in den Kreisen der liberalen Vormärz-Intellektuellen, bei Frühsozialisten und Kommunisten und nicht zuletzt von zahlreichen Naturwissenschaftlern enthusiastisch aufgenommen. Widerspruch gab es jedoch ebenfalls schon früh, und er kam nicht nur von christlicher Seite. Zitiert sei hier lediglich der prominenteste Kritiker, nämlich der junge Karl Marx, dessen elf Thesen über Feuerbach bereits 1845 niedergeschrieben wurden.16 Marx, der Feuerbachs Materialismus wichtige Anregungen verdankte, warf ihm andererseits vor, das „menschliche Wesen“ allzu abstrakt mit der „Gattung“ zu identifizieren und dabei das geschichtlich konkrete Subjekt, das jeweils als „das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ begriffen werden müsse, zu übergehen. Die einseitige Konzentration auf die Auflösung der „religiösen Selbstentfremdung“ des Menschen vernachlässige die Widersprüche der sozialen und ökonomischen Lebenswirklichkeit, die doch den wahren Wurzelgrund aller metaphysischen Illusionen bildeten. Feuerbachs Lehren seien deshalb keine taugliche Basis für eingreifendes Handeln und für die Einlösung der berühmten Marx’schen Forderung: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“ Tatsächlich ist nicht zu leugnen, dass bei Feuerbach strukturelle Faktoren wie der Staat, die gesellschaftliche Ordnung und kulturell geprägte Denkmuster – von der Religion einmal abgesehen – in ihrer Eigenart und ihrem historischen Wandel allenfalls eine Nebenrolle spielen.
Solche Einwände dürften Gottfried Keller im Winter 1848/49 allerdings ferngelegen haben. Wie nahm er Feuerbachs Philosophie auf?17 Es empfiehlt sich, hier zunächst einmal zurückzublicken und seinen bisherigen weltanschaulichen Standort zu rekonstruieren, wofür viele einschlägige Äußerungen in Briefen, Gedichten und Tagebüchern reichliches Material liefern. Für den jungen Mann scheint der Glaube an einen göttlichen Schöpfer noch eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein. Das bezeugen beispielsweise jene „religionsphilosophische[n] Aufsätze“, die er damals, wie er sich später in einer autobiographischen Skizze erinnerte, „in Gestalt Jean Paul’scher Traumbilder in ein dickes Schreibbuch eintrug“ (15, S. 410). In einem davon schildert ein schwärmerischer Jüngling, wie ihm zu nächtlicher Stunde auf einem Berggipfel, dem klassischen Ort göttlicher Epiphanien, ein erhabenes Traumbild erschien: „da trat ein freundlicher Greis vor mich hin, von Ehrfurcht erregendem Anseh’n; der silberne Bart umfloß seine milden aber tiefen Züge u fiel in sanften Wellen auf das weiße blendende Gewand; majestätische Weisheit thronte auf der hellen Stirn’, aus den Augen leuchtete immerwährende jugendliche Kraft, gepaart mit heiligem Ernste des Alters; es leuchtete die Ewigkeit aus ihnen!“ (16.1, S. 110) Visionär erlebt der Erzähler, wie die ganze Menschheit diesen Vatergott unter den verschiedensten Namen anbetet – mit Ausnahme einiger „armseliger Kreaturen“, die sich in törichtem Stolz der Verehrung des Höchsten verweigern: „Dieß war die Rotte der kurzsichtigen Freigeister, der Gottesläugner. […] Diese Geschöpfe verlachten den vernünftigen Glauben; aber sie spotteten ihrer selbst, denn das Dasein eines Schöpfers zu läugnen, ist größerer Unsinn, als der finsterste Aberglaube“ (S. 114).
Diese weltanschauliche Position, die er mit achtzehn Jahren formuliert hatte, blieb für ihn bis auf weiteres gültig. Ahnungen von einer göttlichen Macht finden sich vielerorts in der frühen Lyrik, zum Beispiel im fünften Stück des Ensembles „Nacht“ oder im zweiten der Gruppe „Frühling“ aus den Gedichten, und in einer Schrift für seine Schweizer Landsleute in München warnte Keller ausdrücklich vor dem „kalten Hohne u Wegläugnen jedes religiösen Prinzipes“ und dem „frechen Spotte alles Heiligen“ und sprach von dem „göttlichen Funken der Ewigkeit in unser[er] Brust“ (16.1, S. 397/399). Noch ein um die Mitte der vierziger Jahre entstandenes, an den Mentor Follen gerichtetes Gedicht verherrlicht „Gott und Unsterblichkeit“ (17.2, S. 485), ein anderes aus dem gleichen Zeitraum bezeichnet „kalte Gottesläugner“ als ein großes Übel (17.1, S. 601). Und als in der Züricher Kolonie der deutschen Liberalen ein förmlicher Religionsstreit entbrannte, in dem Arnold Ruge und Karl Heinzen – nicht zuletzt unter Feuerbachs Einfluss! – den Atheismus proklamierten und Follen wegen seiner Gläubigkeit verhöhnten, sprang Keller dem Angegriffenen mit einigen Sonetten bei. Auch an die Ichel lautet in den Gedichten der Obertitel des vierteiligen Zyklus; diesen Spottnamen für seine angeblich hochmütigen, selbstherrlichen Kontrahenten hatte Follen ersonnen. Als sündhaft und erbärmlich verwirft Keller in seinen Versen Lehrsätze wie „Ein Ende macht das Leichentuch“ oder „Der Jenseitsglaube ist ein dürrer Fluch“ (13, S. 55), während er die Überzeugung von einem Leben nach dem Tod als Zeichen gerechten Stolzes und geistiger Tiefe wertet:
Es ist nicht Selbstsucht und nicht Eitelkeit,
Was sehnend mir das Herz grabüber trägt;
Was mir die kühngeschwungne Brücke schlägt,
Ist wohl der Stolz, der mich vom Staub befreit.
Sie ist so kurz, die grüne Erdenzeit,
Unendlich aber, was den Geist bewegt!
’sMuß wenig sein, was ihr im Busen hegt,
Da ihr so satt hier, so vergnüglich seid.
Ein „Atheist von Profession“, so schließt das letzte Sonett mit einem vernichtenden Hieb auf die ideologischen Widersacher, sei nichts anderes als „eine eingefleischte Blasphemie“ (13, S. 56). In den Zusammenhang dieser Kontroverse gehört noch eine Rezension von Ruges Gesammelten Schriften, die Keller 1848 kurz vor seiner Abreise nach Heidelberg veröffentlichte. Hier polemisiert er auch gegen Ruges „Freund Feuerbach“ und nennt dessen Ansichten über „Gott und Unsterblichkeit“, die ihm damals kaum näher bekannt gewesen sein dürften, „craß und trivial“ (15, S. 54). Nur wenige Monate später sollte er sich wegen dieser Sottise selbst einen „einfältige[n] Lümmel“ schelten (GB 1, S. 273)!
Kellers religiöse Haltung war indes keine eigentlich christliche und schon gar keine orthodox kirchliche. 1841 schrieb er seiner Mutter aus München: „Ich habe immerwährend das Bedürfnis, mit Gott in vertrauensvoller Verbindung zu bleiben, aber dessen ungeachtet ist es mir unmöglich, die nüchtern und kalten Predigten unserer reformierten Pfaffen zu hören und ihre alten tausendmal aufgewärmten Gemeinsprüche […] zu wiederkäuen“ (S. 62). Eine scharfe, grundsätzliche Kritik an der Institution Kirche übt das Gedicht Pfingstfest aus dem Sommer 1843 (17.1, S. 22–29). Das lyrische Ich erlebt zunächst die „heil’ge Andacht“ der Natur angesichts des Sonnenaufgangs und fühlt sich anschließend in „der ersten Christen heilige Gemeinde“ entrückt, wo der Geist Gottes noch unmittelbar zu den Menschen sprach. Dann aber drängen sich spätere Zeiten vor sein geistiges Auge, in denen der „finster[e] Fanatismus“ jedes echte religiöse Gefühl erstickt hat und der Glaube zu einem „Eisenthron“ geworden ist, „auf dem Tyrannen ihre Geißeln schwingen“. Diese Verse blieben zwar ungedruckt, aber auch das Sonett Reformation, das in den Gedichten unmittelbar auf den Ichel-Zyklus folgt, ruft dazu auf, das kostbare göttliche „Wort des Lebens“ der „Mumienhand“ der Kirche zu entreißen und es von Neuem auszusäen, damit es Frucht bringe (13, S. 57). Das dritte Gedicht aus dem Zyklus „Nacht“ illustriert die lebensfeindliche Wirkung des dogmatisch verfestigten Kirchenglaubens mit einer Szene aus der Geschichte des Kolonialismus. Auf einer fernen Südsee-Insel schlafen die Eingeborenen, umhegt von einer mütterlich sanften Natur, in unschuldiger Ruhe, bis sich mit unheilverheißendem Kanonendonner die Europäer ankündigen, die dieses Paradies im Namen einer Religion, deren zentrales Sinnbild nicht zufällig von Schmerz und Tod zeugt, ausplündern werden:
Zuvörderst aus des Schiffes schwarzen Wänden
Ragt, schwärzer, aus der giererfüllten Rotte
Der Christenpfaffe, schwingend in den Händen
Das blut’ge Kreuz mit dem gequälten Gotte.
(13, S. 22)
Zum Pfingstfest notierte Keller in seinem Tagebuch: „Das Herz klopfte mir hörbar während dem Schreiben […]. Es wurde mir klar, was es heißt, gegen zweitausendjährigen, positiven Glauben zu kämpfen“ (18, S. 87). Aber er war entschlossen, seine aufrichtige Überzeugung von dem Dasein und dem Wirken Gottes gegen die kirchliche Erstarrung, das individuelle Gefühl gegen das Dogma zu verteidigen. Nichts sei fataler als der „schwarze, keuchende, ertödtende Glaubenszwang“, statt dessen solle „jeder Mensch, jede wärmere Seele sich aus sich selbst erheben, und den Weg zu ihrem Schöpfer suchen, was mir die festeste und reinste Religion zu sein scheint“ (S. 63). So gelangte er zu einer programmatischen Verbindung von privater Gläubigkeit und Toleranz:
Ich werde ein positives religiöses, aber für den Menschen unerklärliches Element festhalten, aber ich werde, wenn ich je zu einer Stimme komme, mit aller Macht dagegen streiten, daß die Gottheit von Menschen mißbraucht und ausgelegt werde. Jeder Mensch soll sich seine religiösen Bedürfnisse selbst ordnen und befriedigen, und dazu sollen Aufklärung und Bildung ihm verhelfen. Ich werde indessen die christlichen Dogmen, sowenig als diejenigen irgend einer andern Religion, verspotten; aber die Schurken, welche dieselben mißbrauchen, und die Fanatiker oder Schwärmer, welche vermittels derselben Andersdenkende verfolgen und verdächtigen, werde ich mit allen mir zu Gebothe stehenden Mitteln angreifen. (S. 87)
Wenn Keller das Christentum 1843 im Tagebuch eine „zarte, schöne Sache“ nannte, die mit „Liebe“ behandelt werden müsse (S. 63), dachte er dabei an seinen ursprünglichen religiösen Gefühlsgehalt. Angesichts konfessioneller Selbstgerechtigkeit konnte er sich jedoch durchaus auch zum „Christenhaß“ bekennen, wie er es in einem Gedichtentwurf aus dem folgenden Jahr tat (17.1, S. 386).
Wir dürfen resümieren, dass Keller in seiner Jugend der Institution Kirche ausgesprochen kritisch gegenüberstand, weil er jeden äußeren Zwang in Glaubensdingen ablehnte, dabei aber eine ganz persönliche, deistisch gefärbte Religiosität kultivierte und an der Existenz eines außerweltlichen Schöpfergottes und an der Unsterblichkeit der Seele festhielt. Das dritte Stück aus der Reihe „Abend“ in den Gedichten bringt die verschiedenen Aspekte dieser Haltung auf engstem Raum zusammen. Während das Licht der sinkenden Sonne als „heil’ge[s] Todtenamt“ einen sterbenden Jüngling verklärt, gibt das anwesende „schwarze Pfäfflein“, der „arme Dunkelmann“, eine ebenso traurige wie überflüssige Figur ab. Die Schlussverse bekräftigen emphatisch die Gewissheit, dass der Verstorbene im Jenseits neu aufleben wird: „Nimmst, Teufel! du mir dieses Glaubens Lust,/Nimm mir zuvor das Herz aus meiner Brust!“ (13, S. 18) Auch mit dem Protagonisten des Grünen Heinrich hat Keller in religiösen Dingen offenbar ein getreues Abbild seines eigenen früheren Selbst geschaffen, denn der heranwachsende Heinrich Lee attackiert ebenfalls die dogmatische Verkrustung des Christentums, ohne deswegen vom Glauben abzufallen. Im Heimatdorf seiner Eltern disputiert er gern mit einem jungen Schulmeister, der nach ausgiebigen philosophischen Studien zum Atheisten geworden ist: „Ueber den christlichen Glauben waren wir bald einig und machten in die Wette unsern Krieg gegen Pfaffen und Autoritätsleute jeder Art; als ich aber den lieben Gott und die Unsterblichkeit aufgeben sollte und der Philosoph dieses mit höchst unbefangenen Auseinandersetzungen verlangte, da lachte ich eben so unbefangen, und es kam mir nicht einmal in den Sinn, die Sache ernstlich zu untersuchen“, weil die Natur und die ganze Welt ihren Reiz und ihre Würde in Heinrichs Augen nur behalten, solange er sie „als das Werk eines mir gleichfühlenden und voraussehenden Geistes betrachten“ kann (11, S. 367). Auch für den jugendlichen Keller waren Gott und Unsterblichkeit wohl keine Gegenstände der kritischen Reflexion, sondern Bedürfnisse des Gemüts, des inneren Gefühls.
Seine Weltanschauung umfasste damals aber noch weitere Elemente, die nicht unerwähnt bleiben dürfen, weil sie schon eine gewisse Verwandtschaft mit den Positionen Feuerbachs aufweisen und die Wende der Heidelberger Zeit nicht mehr ganz so abrupt erscheinen lassen. Manchmal klingt bei Keller bereits vor 1848/49 eine Sichtweise an, die vollkommen immanent bleibt und an die Stelle eines himmlischen Jenseits die allumfassende schöpferische Natur setzt. Ein Beispiel dafür bietet die triumphale Schlussstrophe der lyrischen Klage Bei einer Kindesleiche, deren Vision des melancholischen personifizierten Todes zu den eindrucksvollsten Bildern gehört, die in Kellers frühen Gedichten zu finden sind:
Zu der du wiederkehrst, grüß’ mir die Quelle,
Des Lebens Born, doch besser, grüß’ das Meer,
Das Eine Meer des Lebens, dessen Welle
Hoch fluthet um die dunkle Klippe her,
Darauf er sitzt, der traurige Geselle,
Der Tod – verlassen, einsam, thränenschwer,
Wenn ihm die Seelen, kaum hier eingefangen,
Laut jubelnd wieder in die See gegangen.
(13, S. 153)
Die unendliche Flut des Lebens bringt die einzelnen Individuen hervor und nimmt sie nach ihrem Tod wieder in sich auf – an solche Gedanken konnte der Dichter später anknüpfen, als er sich mit Feuerbachs Lehre von der Natur auseinandersetzte. Aber auch sein Deismus vertrug sich durchaus mit rauschhafter Naturbegeisterung und diesseitiger Lebensfreude, denn zu frommer Askese neigte Keller nie. In dem Gedicht Am Himmelfahrtstag, das den Lyrikband von 1846 beschließt, erlaubte er sich eine sehr weitgehende Säkularisierung dieses kirchlichen Festes. Frühlingsstimmung, Hoffnung und Zuversicht bringen den Gedanken einer „Himmelfahrt“ der ganzen Welt hervor, die jedoch nicht etwa in ein fernes Jenseits führen soll:
O sie braucht nicht weit zu fahren,
Die den Himmel in sich wahrt:
Selbst sich einmal offenbaren,
Ist die ganze Himmelfahrt!
(13, S. 157)
Andeutungsweise ersetzt hier die Politik die Religion und das Diesseits das Jenseits: Die „Schätze“ einer Welt, die im Zeichen der „Freiheit“ zu sich selbst gefunden hätte, würden „[d]er Märtyrer blaß Gebein“ verdunkeln (S. 158).
Kellers politisches Engagement in jenen Jahren soll an anderer Stelle gewürdigt werden. Vorläufig mag der Hinweis genügen, dass er sich entschieden zu einem republikanischen Liberalismus bekannte und auch dadurch in die Nähe Feuerbachs rückte, der die „Republik“ als „die geschichtliche Aufgabe, das praktische Ziel der Menschheit“ bezeichnete und mit seiner Philosophie den Weg dorthin bereiten wollte. Er interpretierte nämlich die wahre „Verfassung der Natur“, die nach seiner Überzeugung ja ohne das Eingreifen einer höheren Macht auskam, als „eine republikanische“, während er den traditionellen Gottesglauben aufs engste mit den überlebten monarchischen Strukturen verknüpft sah.18
Gegen die atheistischen „Ichel“ bot Keller unter anderem das Argument auf, dass viele Menschen die tröstliche Aussicht auf eine höhere Gerechtigkeit und ein glücklicheres Jenseits nicht entbehren könnten: „Was aber ward und wird aus den Millionen,/Die unversöhnt, bleich, siech von hinnen schwinden?“ (13, S. 55) Alle Versuche, die Leidenden und Benachteiligten mit dem Versprechen eines Himmelreichs, in dem sie Genugtuung erhalten würden, zu beschwichtigen, hielt er jedoch für blanken Zynismus. Ein Sonett aus den Gedichten, das die Überschrift Den christlichen Griesgrämlern trägt, verwahrt sich dagegen, den hehren Glauben an einen „ew’ge[n] Frühling“ und an die „Unsterblichkeit“ als ‚Opium des Volkes‘ zu missbrauchen:
Wir haben uns bescheidentlich erkoren,
Dem Volk zu lichten nur dies ird’sche Leben:
Ihr laßt verhungernd es gen Himmel schweben!
Wer sind die Schwindler nun? – Ihr, alte Thoren!
(S. 51)
In der Ansicht, dass es dem Menschen aufgegeben sei, das „ ird’sche Leben“ besser einzurichten, traf sich Keller wieder mit Feuerbach. In diesem Zusammenhang sei ein weiteres Gedicht, das zumindest unter thematischen Gesichtspunkten zu den faszinierendsten lyrischen Werken des Autors zählt, ausführlicher erörtert. Die Verse reagierten auf einige Strophen, die der schwäbische Spätromantiker Justinus Kerner 1845 im „Morgenblatt für gebildete Leser“ publiziert hatte und die Keller seinem eigenen Text voranstellte:
Erwiderung auf Justinus Kerner’s Lied: Unter dem Himmel.
Siehe Morgenblatt 1845.
Laßt mich in Gras und Blumen liegen
Und schaun dem blauen Himmel zu,
Wie goldne Wolken ihn durchfliegen,
In ihm ein Falke kreist in Ruh.
Die blaue Stille stört dort oben
Kein Dampfer und kein Segelschiff,
Nicht Menschentritt, nicht Pferdetoben,
Nicht des Dampfwagens wilder Pfiff.
Laßt satt mich schaun in diese Klarheit,
In diesen stillen, sel’gen Raum:
Denn bald könnt’ werden ja zur Wahrheit
Das Fliegen, der unsel’ge Traum.
Dann flieht der Vogel aus den Lüften,
Wie aus dem Rhein der Salmen schon,
Und wo einst singend Lerchen schifften,
Schifft grämlich stumm Britannia’s Sohn.
Schau’ ich zum Himmel, zu gewahren,
Warum’s so plötzlich dunkel sei,
Erblick’ ich einen Zug von Waaren,
Der an der Sonne schifft vorbei.
Fühl’ Regen ich beim Sonnenscheine,
Such’ nach dem Regenbogen keck,
Ist es nicht Wasser, wie ich meine,
Wurd’ in der Luft ein Oehlfaß leck.
Satt laßt mich schaun vom Erdgetümmel
Zum Himmel, eh’ es ist zu spät,
Wann, wie vom Erdball, so vom Himmel
Die Poesie still trauernd geht.
Verzeiht dies Lied des Dichters Grolle,
Träumt er von solchem Himmelsgraus,
Er, den die Zeit, die dampfestolle,
Schließt von der Erde lieblos aus.
Justinus Kerner
Dein Lied ist rührend, edler Sänger!
Doch zürne dem Genossen nicht,
Wird ihm darob das Herz nicht bänger,
Das, Dir erwidernd, also spricht:
Die Poesie ist angeboren,
Und sie erkennt kein Dort und Hier;
Ja, ging’ die Seele mir verloren,
Sie führ’ zur Hölle selbst mit mir.
Inzwischen sieht’s auf dieser Erde
Noch lange nicht so graulich aus;
Und manchmal scheint mir, Gottes: Werde!
Ertön’ erst recht dem „Dichterhaus.“
Schon schafft der Geist sich Sturmesschwingen
Und spannt Eliaswagen an –
Willst träumend Du im Grase singen,
Wer hindert Dich, Poet, daran?
Ich grüße Dich im Schäferkleide,
Herfahrend, – doch mein Feuerdrach’
Trägt mich vorbei, die dunkle Haide
Und Deine Geister schaun uns nach!
Was Deine alten Pergamente
Von tollem Zauber kund Dir thun,
Das seh’ ich durch die Elemente
In Geistes Dienst, verwirklicht nun.
Ich seh’ sie keuchend sprühn und glühen,
Stahlschimmernd bauen Land und Stadt:
Indeß das Menschenkind zu blühen
Und singen wieder Muße hat.
Und wenn vielleicht, nach fünfzig Jahren,
Ein Luftschiff voller Griechenwein
Durch’s Morgenroth käm’ hergefahren –
Wer möchte da nicht Fährmann sein?
Dann bög’ ich mich, ein sel’ger Zecher,
Wol über Bord, von Kränzen schwer,
Und gösse langsam meinen Becher
Hinab in das verlassne Meer!
G. K.
(13, S. 139–141)
Kerners beklemmende Dystopie, niedergeschrieben gerade einmal zehn Jahre nach der Jungfernfahrt der ersten Lokomotive auf deutschem Boden, mutet in der Rückschau des 21. Jahrhunderts verblüffend hellsichtig an. Das technisch-industrielle Zeitalter, das der Autor mit Dampfmaschine und Eisenbahn unaufhaltsam heraufziehen sieht, steht ganz im Zeichen von Schmutz und lärmender Hektik. Den Erdboden hat es in der Sicht des lyrischen Ich schon völlig vereinnahmt, aber das Gedicht projiziert die begonnene Entwicklung überdies kühn in die Zukunft und malt sich eine Epoche aus, in der die Menschheit auch den Luftraum erobern wird. Dabei siedelt Kerner die Antriebskräfte des technischen Fortschritts bemerkenswerterweise im ökonomischen Bereich, im Profitstreben an. Nicht kühne Abenteurer oder Entdecker schiffen in seiner Vision durch den Himmel, sondern „Britannia’s Sohn“, der einen „Zug von Waaren“ steuert – die zeitgenössische Rolle Englands, das nicht nur das Mutterland der Industrialisierung, sondern auch die führende Handelsnation war, wird hier gleichfalls in die kommende Ära weitergedacht.
Ökologische und ästhetische Gesichtspunkte verbinden sich in dieser pessimistischen Diagnose der kommenden Moderne. Als deren Widerpart, freilich ein völlig hilfloser, tritt der Dichter auf, den Kerner mit recht konventionellen romantischen Zügen ausstattet. Einer unberührten Naturidylle zugeordnet, ist er der Freund der Ruhe, der beschaulichen Muße und der poetischen Träumerei, den die neue Zeit unweigerlich ins Abseits drängt. Von der Erde bereits ausgeschlossen, findet er nur im Himmel noch einen stillen Fluchtraum, dessen Tage aber auch schon gezählt sind. Für die Poesie, wie Kerner sie auffasst, scheint es keine Rettung zu geben. Sie ist Teil einer untergehenden Welt, der man allenfalls wehmütig nachtrauern kann.
Kellers Erwiderung, für die er Kerners Strophenform übernahm, präsentiert einen radikalen Gegenentwurf, der die Errungenschaften der Moderne sehr viel günstiger beurteilt. Weil sie die „Elemente“ in den Dienst des menschlichen Geistes zwingen, verwirklichen sie endlich, was frühere Epochen vergebens von allerlei magischen Praktiken und Geheimlehren erhofften (die „alten Pergamente“ und der „tolle Zauber“ spielen auf die mystisch-okkultistischen Neigungen Kerners an, der sich sehr für Magnetismus, Somnambulismus und Geisterkunde interessierte). So wird die Menschheit bald imstande sein, die drängende Not des Daseins zu überwinden und sich ein Paradies auf Erden zu schaffen, in dem die schöne „Muße“ unangefochten herrscht und damit ein wahrhaft humanes Leben möglich ist. Was die Technik nach Kerners Befürchtungen unwiderruflich zerstört, das stellt sie für Keller als säkulare Heilsbringerin überhaupt erst her.
Keller konfrontiert auch Kerners Definition der Poesie mit einer weiter gefassten und flexibleren Alternative. Er versteht darunter ein angeborenes schöpferisches Vermögen des Menschen, das unter keinen Umständen verloren geht, wohl aber seine Gestalt verändern und sich andere Gegenstände wählen kann. Der schäferliche Träumer „im Grase“ mag auch künftig noch geduldet werden, aber ein wenig lächerlich wirkt er angesichts der neuen Ära doch. Ein zeitgemäßer Dichter lässt sich freudig auf die moderne Dynamik ein und genießt die bislang ungeahnte Intensität des sinnlichen Erlebens, die ihm ihre „Sturmesschwingen“ und der „Feuerdrach[e]“ der Lokomotive vermitteln. Die beiden Schlussstrophen, die „fünfzig Jahre“ vorausblicken und somit das direkte Gegenstück zu Kerners düsterer Zukunftsvision darstellen, entwerfen dafür ein imposantes Bild: Der „sel’ge Zecher“ in seinem „Luftschiff voller Griechenwein“, das hier den tristen „Zug von Waaren“ aus dem ersten Gedicht ersetzt, demonstriert, dass die von den Wundern der Technik geprägte Epoche keineswegs alle Schönheit aus der Welt vertreibt, sondern vielmehr ganz neue ästhetische Qualitäten hervorbringt. Das Trankopfer dieses Luftschiffers kündet von einer festlich gestimmten Weltfrömmigkeit und verherrlicht den sinnenfrohen Daseinsgenuss.
Kerners Unter dem Himmel und Kellers Replik belegen, wie frühzeitig einzelne Poeten im deutschsprachigen Raum auf den revolutionären weltgeschichtlichen Umbruch reagierten, den die Prozesse der Industrialisierung und der Technisierung mit sich brachten. Erst Jahrzehnte später sollte der Naturalismus solche Themen programmatisch ins Zentrum seiner Bemühungen um eine spezifisch moderne Literatur rücken. Einen besonderen Effekt erzielte Keller dadurch, dass er Kerners Gedicht, das ihn zu seinen Versen angeregt hatte, mit abdruckte. Natürlich musste er das schon deshalb tun, weil die Kenntnis des Bezugstextes für das Verständnis seiner Erwiderung unentbehrlich war, aber das unmittelbare Nebeneinander von These und Antithese erzeugt auch eine spannungsvolle Doppelperspektive auf die moderne Welt. Die Werke von Kerner und Keller gestalten in markanter Zuspitzung zwei gegensätzliche Antworten auf die Herausforderungen des technisch-industriellen Zeitalters, die man in mancherlei Variationen bis in die Gegenwart hinein beobachten kann. Indem Keller im Rahmen seines Gedichtbandes beide Sichtweisen präsentiert und damit ihren Widerspruch offenlegt, macht er sie der kritischen Reflexion des Lesers zugänglich.
Kellers euphorische Zukunftsvision wäre ohne weiteres mit Feuerbachs Appellen an die Verantwortung der mündigen Menschheit für die Gestaltung ihrer Lebenswelt zu vereinbaren, und wie zu sehen war, gab es noch mehr Berührungspunkte zwischen den Ansichten des Dichters und den Lehren des Philosophen. Die Bekanntschaft mit Feuerbach stürzte also nicht etwa sämtliche Überzeugungen Kellers von Grund auf um, aber sie vermittelte ihm, wie er es selbst ausdrückte, „endlich eine bestimmte und energische philosophische Anschauung“ (GB 2, S. 458), die seinem Denken ein festes Fundament und eine stabile Ordnung gab. Und zwei große Ideen, die ihm bislang am Herzen gelegen hatten, ließ er damals tatsächlich fahren, nämlich den Glauben an einen persönlichen Gott und, wichtiger noch, die Hoffnung auf individuelle Unsterblichkeit. An Baumgartner schrieb er in seinem großen Rechenschaftsbericht vom Januar 1849 über Feuerbach:
Die Welt ist eine Republik, sagt er, und erträgt weder einen absoluten, noch einen konstitutionellen Gott (Rationalisten). Ich kann einstweilen diesem Aufruf nicht widerstehen. Mein Gott war längst nur eine Art von Präsident oder erstem Konsul, welcher nicht viel Ansehen genoß, ich mußte ihn absetzen. […] Die Unsterblichkeit geht in den Kauf. So schön und empfindungsreich der Gedanke ist – kehre die Hand auf die rechte Weise um, und das Gegenteil ist ebenso ergreifend und tief. Wenigstens für mich waren es sehr feierliche und nachdenkliche Stunden, als ich anfing, mich an den Gedanken des wahrhaften Todes zu gewöhnen. Ich kann Dich versichern, daß man sich zusammennimmt und nicht eben ein schlechterer Mensch wird. (GB 1, S. 274)
Keller beschloss, sich fortan allein an die irdische Natur und an das vergängliche, aber dadurch nur umso kostbarere Dasein des Menschen zu halten, dessen Glanz nun nicht mehr von illusorischen Erwartungen getrübt wurde, die über die Grenzen der Erde hinausschweiften: „Für mich ist die Hauptfrage die: Wird die Welt, wird das Leben prosaischer und gemeiner nach Feuerbach? Bis jetzt muß ich des bestimmtesten antworten: Nein! im Gegenteil, es wird alles klarer, strenger, aber auch glühender und sinnlicher“ (S. 275).
Das radikale Bekenntnis zum Diesseits markierte für Keller einen tiefen Einschnitt in seiner geistigen Entwicklung: Wie die Wendung „nach Feuerbach“ andeutet, begann in seinen Augen mit dem Auftreten dieses Philosophen geradezu eine neue Zeitrechnung. Und das bezog er keineswegs nur auf seine persönliche Existenz. In dem satirischen Versepos Der Apotheker von Chamouny, das aus den fünfziger Jahren stammt, zeigt der Erzähler am Beispiel des sterbenskranken Heinrich Heine, wie existenzielle Not und Todesfurcht den Menschen dazu bringen können, seine Hoffnungen auf göttlichen Beistand zu richten, und verwirft einen solchen verzweifelten Schritt zum Glauben, indem er, wie es die zugehörige Randglosse ausdrückt, folgende „Philosophie der Geschichte in zwei Versen“ vorträgt:
Ueber sich hinaus zu schnappen
Scheint des Menschen große Gabe,
Die ihn von dem Thiere scheidet,
Ist die Hälfte der Geschichte!
Von dem Schnapp zurückzukommen
Der Geschichte an’dre Hälfte,
Welche anfängt zu beginnen.
(14, S. 269)
Was hier salopp formuliert wird, ist nichts anderes als Feuerbachs Kernthese: Die Menschheit hat sich lange Zeit, von Gott und dem Jenseits träumend, „[ü]ber sich hinaus“ verirrt, bis sie schließlich ihre Illusionen und Projektionen abstreift, um sich auf sich selbst zu besinnen und ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. In der Tat war Feuerbach überzeugt, mit der Verwandlung der Theologie in Anthropologie einen „notwendige[n] Wendepunkt der Geschichte“ der menschlichen Gattung herbeizuführen.19
Gerade für den Künstler erwartete Keller fruchtbare Wirkungen von der neuen Weltanschauung. Ein weiterer Brief an Baumgartner verbindet die ethischen Implikationen der Feuerbach’schen Philosophie unmittelbar mit den ästhetischen:
Wie trivial erscheint mir gegenwärtig die Meinung, daß mit dem Aufgeben der sogenannten religiösen Ideen alle Poesie und erhöhte Stimmung aus der Welt verschwinde! Im Gegenteil! Die Welt ist mir unendlich schöner und tiefer geworden, das Leben ist wertvoller und intensiver, der Tod ernster, bedenklicher und fordert mich nun erst mit aller Macht auf, meine Aufgabe zu erfüllen und mein Bewußtsein zu reinigen und zu befriedigen, da ich keine Aussicht habe, das Versäumte in irgend einem Winkel der Welt nachzuholen. […] für die Kunst und Poesie ist von nun an kein Heil mehr ohne vollkommene geistige Freiheit und ganzes glühendes Erfassen der Natur ohne alle Neben- und Hintergedanken, und ich bin fest überzeugt, daß kein Künstler mehr eine Zukunft hat, der nicht ganz und ausschließlich sterblicher Mensch sein will. (GB 1, S. 290f.)
Von dieser Zeit an identifizierte Keller, wie es im Grünen Heinrich heißt, das „Poetische“ schlechterdings mit dem „Lebendige[n] und Vernünftige[n]“, dem Sinnlich-Konkreten (12, S. 18). Feuerbachs Thesen mussten ihm da ausgesprochen heilsam erscheinen: „Für die poetische Tätigkeit aber glaube ich neue Aussichten und Grundlagen gewonnen zu haben, denn erst jetzt fange ich an, Natur und Mensch so recht zu packen und zu fühlen, und wenn Feuerbach weiter nichts getan hätte, als daß er uns von der Unpoesie der spekulativen Theologie und Philosophie erlöste, so wäre das schon ungeheuer viel“ (GB 2, S. 458). So sah er sich damals genötigt, den bereits begonnenen Grünen Heinrich grundlegend umzuschreiben und seinem neuen „Standpunkt“ anzupassen (S. 459). Den Spuren Feuerbachs in diesem Roman und in anderen literarischen Texten des Dichters soll der folgende Abschnitt nachgehen. Die Bekanntschaft mit dem Philosophen verhalf Keller zwar, wie sein weiterer Lebensweg zeigt, keineswegs schlagartig zu vollkommener innerer Reife und Festigkeit, aber sie hat sein Schaffen in der Folgezeit, in Heidelberg und vor allem in Berlin, in hohem Maße beflügelt und geprägt, in jener Phase also, in der fast alle seine größeren Werke ihren Ursprung hatten.