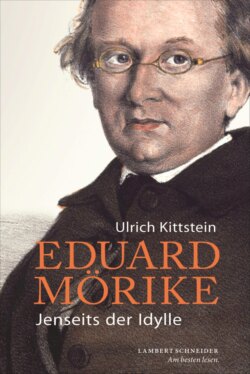Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lektüren
ОглавлениеDie Jahre seiner akademischen Studien machten Mörike nicht nur mit Literatur und Kultur der Antike vertraut, sie waren auch für seine Bekanntschaft mit der älteren und neueren deutschsprachigen Dichtung von entscheidender Bedeutung. Hierbei ist weniger an den offiziellen Unterricht als vielmehr an selbständige Lektüre zu denken, die häufig durch Freunde und Kommilitonen angeregt und in deren Kreis diskutiert wurde. So avancierte der ungemein belesene Wilhelm Waiblinger für den Uracher Schüler Mörike und einige seiner Kompromotionalen zu einer Autorität bei der Auswahl ihres Lesestoffs, wie schon der erste Brief bezeugt, den Mörike ihm schrieb und der vom Oktober 1821 stammt: „Sie rekommandieren uns den Jean Paul – leider hatt ich noch nicht viel Gelegenheit, diesen originellen Schriftsteller näher kennen zu lernen, außer aus Sentenzensammlungen – Almanachen u. dergl. – ferner empfehlen Sie uns die Wanderjahre, auch sie hab ich troz meines Bemühen’s noch nicht bekommen“ (10, S. 21). Einige Monate später schwärmte Mörike dem Freund unter anderem von Shakespeare vor – er nennt Hamlet, Lear und Macbeth – und begeisterte sich für The Vicar of Wakefield von Oliver Goldsmith, der in einer Übersetzung in Urach zirkulierte, sowie für Johann Martin Millers empfindsamen Klosterroman Siegwart.6 Auch andere Briefe Mörikes lassen erkennen, was für eine eminente Rolle das Lesen und das Gespräch über Literatur im Leben der jungen Leute spielten, denen sich die Welt jenseits von Klosterschule und Stift fast nur über das gedruckte Wort erschloss. Den intensiven mündlichen Austausch in seinem Freundeskreis können wir freilich nicht mehr im Einzelnen rekonstruieren. Im Folgenden soll jedoch zumindest der allgemeine literarische Horizont des Heranwachsenden und des jungen Mannes umrissen werden (mit manchen unvermeidlichen Vorgriffen auf spätere Jahre), ohne dass damit etwa eine erschöpfende Aufzählung alles dessen beabsichtigt wäre, was Mörike gelesen hat oder gelesen haben könnte.
An erster Stelle ist zweifellos Goethe zu nennen, dessen Name in der Korrespondenz mit Waiblinger schon im November 1821 fällt, als die Freunde gerade zum Du übergegangen waren: „Daß Du Göthen als unsern Größ’sten anerkannt, weiß ich; daß ich manches von ihm geleßen, vermuthest Du villeicht; in dem Fall aber, hoff ich zweyfeltest Du nicht daran, daß ich Deinem Urtheil wahrhaft beytreten werde“ (10, S. 23). Dabei war Mörike sehr darauf aus, durch die Lektüre von Goethes Werken auch dem Menschen, der sie geschrieben hatte, näher zu kommen und gleichsam ein intimes persönliches Verhältnis zu ihm aufzubauen – eine für die zeitgenössische Goethe-Rezeption durchaus typische Haltung. Die autobiographischen Schriften kamen diesem Wunsch natürlich am ehesten entgegen:
Die beyden ersten Baende v. Dichtung und Wahrheit hab ich nunmehr gelesen. Sie hatten eine wunderbar anmuthige Wirkung für mich; Es thut einem wohl, den Grossen, so menschlich zu sehn, man meynt keine Ursache zur Schüchternheit vor ihm zu haben, fühlt sich ihm naeher gebracht, wenn man hier liest, wie er so umgänglich und menschlich war, – an jedem aus seiner Umgebung findet er etwas Gutes. (10, S. 25)
Die Begeisterung für Person und Werk Goethes blieb eine Konstante in Mörikes Leben. 1828 feierte er in Antike Poesie (1.1, S. 187) „Iphigeniens Dichter“ als einzigen legitimen Erben der Kunst des Altertums, der seine Inspiration unmittelbar aus der Musenquelle am griechischen Helikon schöpft, und drei Jahre später rühmte er seiner Verlobten Wilhelm Meisters Lehrjahre: „Das Buch ist in der That unerschöpflich und was künstliche Composition betrifft unendlich lehrreich“; er stellte es sogar auf eine Stufe mit Homer, dem Maß aller Dinge (11, S. 239). Auch Publikationen über Goethe las er mit großem Interesse, und noch die „Damen-Vorlesungen“, die er später in Stuttgart veranstaltete, legten auf diesen Autor besonderes Gewicht. Eine herausragende Bedeutung gewann für ihn Goethes Briefwechsel mit Schiller. Er erhielt das Buch 1829 von Mährlen, der damals bei Cotta, dem Verleger der Weimarer Klassik, als Korrektor arbeitete, und war auf der Stelle davon gefesselt:
Das tolle Büchlein klebte aber in meinen Händen fest – seine Blätter flogen eilig wie besessen von der Rechten zur Linken, ich stand bald mitten in heiliger klassischer Atmosphäre, las endlich sachte und sachter, ja ich hielt den Athem an, die ruhige tiefe Fläche nicht zu stören, in deren Abgrund ich nun senkrecht meinen Blick hinunterließ, als dürfte ich die Seele der Kunst anschauen. […] Mein Kopf war aufs äußerste angespannt – meine Gedanken liefen gleichsam auf den Zehenspitzen, ich lag wie über mich selbst hinausgerückt und fühlte mich neben aller Feyerlichkeit doch unaussprechlich vergnügt. Statt mich niederzuschlagen hatte der Geist dieser beiden Männer eher die andere Wirkung auf mich. Gar manche Idee – das darf ich Dir wohl gestehen – erkannte ich als mein selbst erworbenes Eigenthum wieder, und ich schauderte oft vor Freuden über seiner Begrüßung. (11, S. 30)
Kaum anderthalb Jahre später ließ Mörike Mährlen wissen, dass er die „Schiller u. Goethe Correspondenz“ soeben bereits „zum fünftenmal“ durchgehe (S. 152). 1845 las er den Briefwechsel „wieder mit unsäglicher Befriedigung“ (14, S. 286), und in den fünfziger Jahren empfahl er ihn einem jungen Verwandten als die beste Quelle für „Studien über deutsche Literatur u. Göthe insbesondere“ (16, S. 102) und nannte ihn „ein Buch aller Bücher“ (S. 276).
Mörikes Achtung vor der überragenden Autorität von „Vater Göthe“ (11, S. 131) hatte nichts Bedrückendes und Einengendes an sich. Er sah hier offenbar wirklich „keine Ursache zur Schüchternheit“ und pflegte, wie die oben zitierte erste Reaktion auf den Goethe-Schiller-Briefwechsel anschaulich zeigt, einen ganz vertraulichen, entspannten geistigen Umgang mit dem „alten DichterVater“ (S. 276). In der Situation eines Epigonen, der angesichts der Last der Tradition und des schon Geleisteten an der eigenen schöpferischen Kraft zweifelt, fühlte er sich jedenfalls nicht – Emil Staigers vielzitierte Einschätzung, Mörike habe als unsicherer „Spätling“ nur voller Sehnsucht und Wehmut auf die klassisch-romantische Epoche zurückblicken können7, erweist sich schon an diesem Punkt als fragwürdig.
Die Werke seines schwäbischen Landsmannes Schiller las Mörike ebenfalls gerne, auch wenn die Zeugnisse dafür spärlicher sind. 1838 verfasste er als Auftragsarbeit für einen Festakt in Stuttgart die Cantate bei Enthüllung der Statue Schillers, aber er kam auch in unmittelbare Berührung mit biographischen Spuren des Dichters. Auf dem Friedhof von Cleversulzbach entdeckte er zu seiner großen Rührung das Grab von dessen Mutter Elisabetha Dorothea, die 1802 im Hause ihres Schwiegersohnes, eines Amtsvorgängers von Mörike, gestorben war. Mörike begnügte sich nicht damit, die Stätte in den Distichen Auf das Grab von Schillers Mutter zu feiern, sondern nahm sich ihrer auch auf ganz praktische Weise an, indem er einen festen Grabhügel aufwerfen und bepflanzen ließ und ein altes Steinkreuz eigenhändig mit den eingemeißelten Worten „Schillers Mutter“ versah, um sicherzustellen, dass der Ort nicht in Vergessenheit geriet. Der Freund Hermann Kurz erhielt im Juni 1837 einen ausführlichen Bericht von diesem Akt der „Heiligenpflege“, auf den Mörike nicht wenig stolz war (12, S. 107). Vier Jahre später wurde seine eigene Mutter unmittelbar neben der verehrten Grabstätte beigesetzt, um deren würdige Erhaltung er sich sogar noch in seiner späteren Stuttgarter Zeit als Mitglied des Schiller-Festkomitees von 1859 sorgte.8 Von Cleversulzbach aus korrespondierte er überdies mit einer Schwester Schillers und vermittelte für den Verleger Schweizerbart den Ankauf einiger Familienbriefe, die er dann als Beitrag zu einer größeren Werkausgabe publizierte. Seine in der Vorbemerkung zu dieser Edition geäußerte Hoffnung, Schiller werde dem Leser in den Briefen „als ächter Mensch, treuherzig, fromm, in schlichter Liebenswürdigkeit“ begegnen (7, S. 215), bezeugt einmal mehr, dass ihn die Persönlichkeit eines Schriftstellers, sozusagen dessen menschliche und moralisch-sittliche Seite, ebenso sehr interessierte wie seine Werke.
Klassizistische Bestrebungen waren in Deutschland um und nach 1800 nicht auf Weimar beschränkt. In Schwaben wurden sie von einigen Angehörigen der älteren Generation vertreten, darunter Karl Philipp Conz, der lange Jahre in Tübingen klassische Literatur lehrte, und der Lyriker und Epigrammatiker Johann Christoph Friedrich Haug. Ihre Werke waren Mörike sicherlich frühzeitig vertraut, und an die persönliche Bekanntschaft mit Haug, der im Hause Georgiis verkehrte, erinnerte er sich noch im hohen Alter.9 Um einiges wichtiger wurde für ihn jedoch die eigentümliche schwäbische Ausprägung der romantischen Dichtung, die ihre bedeutendsten Repräsentanten in Ludwig Uhland, Justinus Kerner und Gustav Schwab fand. Mit diesen Männern trat Mörike im Laufe der Jahre auch in ein mehr oder weniger enges persönliches Verhältnis, und vor allem dem Erstgenannten brachte er zeitlebens eine tiefe Verehrung entgegen. Ihre Zusammenfassung zu einer schwäbischen ‚Dichterschule‘ verdankt sich allerdings in erster Linie der polemischen Außensicht eines Heinrich Heine und sollte über die ausgeprägte Individualität der einzelnen Autoren nicht hinwegtäuschen.
Seltener erwähnt Mörike die großen Poeten der Jenaer, Heidelberger und Berliner Romantik. Er kannte Schriften und Gedichte von Novalis, den er schon 1822 in einem Brief an Waiblinger zitierte10, schätzte zumindest in jungen Jahren die Werke Ludwig Tiecks, dem er mit einem ehrfurchtsvollen Begleitbrief ein Exemplar des Maler Nolten zukommen ließ11, und las in Tübingen mit seinen Freunden E.T.A. Hoffmanns Serapions-Brüder.12 Die „Grimm’schen Volksmährchen“ zählte er zu seinen „Lieblingsspeisen“ (14, S. 34); auch das Gedicht Wald-Idylle nimmt auf dieses „lieblichste“ aller Bücher Bezug (1.1, S. 159). Zu Joseph von Eichendorff gibt es dagegen lediglich eine einzige und nicht gerade überschwängliche Bemerkung: „Von Eichendorf kenn ich nur die Gedichte. So weit in ihnen phantastische Elemente enthalten sind und sofern ein Schluß hieraus auf s. etwaigen Arbeiten im Fach des Märchens gemacht werden darf, möchte man bezweifeln, ob diß sein Feld seyn kann, da er wenig Objektives u. Plastisches hat“ (14, S. 27). Intensiv beschäftigte sich Mörike spätestens in Tübingen mit Jean Paul, dessen Titan er seiner Schwester Luise dringend empfahl.13
Ein weiterer Dichter der Vätergeneration, bei dem wir ein wenig verweilen müssen, war Friedrich Hölderlin. Wieder mischte sich in diesem Fall Mörikes literarisches Interesse auf eine schwer zu durchschauende Art mit der persönlichen Anziehungskraft des Poeten. In Tübingen las er nicht nur den Roman Hyperion14, sondern lernte durch Waiblingers Vermittlung auch den Autor selbst kennen, der damals schon seit vielen Jahren, geistig umnachtet, in der Obhut des Tischlermeisters Zimmer in dem berühmten Turm am Neckarufer hauste. Mörike und Ludwig Bauer ließen sich von Waiblingers schwärmerischer Begeisterung für den wahnsinnigen Dichter-Propheten anstecken, den sie gelegentlich zu Ausflügen in die Umgebung der Stadt mitnahmen. Zu dieser Zeit gelangte Mörike in den Besitz einiger Autographen, die er in Briefen und Schriften verschiedentlich erwähnt.15 Aber auch nach dem Abschied von Tübingen verschwand Hölderlin nicht aus seinem Gesichtskreis. Anfang 1843 kramte er bei einem Aufenthalt in Nürtingen hingebungsvoll in einem „großen Korb mit Manuscripten“ des Poeten, die ihm dessen Schwester zur Verfügung gestellt hatte (14, S. 84); später publizierte er in einigen kleinen Beiträgen handschriftliches Gedichtmaterial des inzwischen Verstorbenen16, und noch im Alter korrespondierte er unter anderem mit Robert Vischer und Christoph Theodor Schwab über philologische Fragen, die Hölderlins lyrische Werke betrafen.17
Doch obwohl er Hölderlin einmal einen „liebenswerthen, lange noch nicht genug erkannten Dichter“ nannte (7, S. 321), war ihm bei der Beschäftigung mit diesem Schriftsteller nie ganz wohl. Den Hyperion beurteilte er zwiespältig – „Am Ende sieht das Ganze doch nur wie ein rührendes Zerrbild aus, lauter einzelne unvergleichlich wahre u. schöne Lyrika, ängstlich auf eine Handlung übergetragen“ (11, S. 286) –, und beim Studium der Handschriften in Nürtingen war er froh, wenn ihm bisweilen eine Besucherin ein wenig Ablenkung verschaffte, denn „sonst könnte man vor solchen Trümmern beinahe den Kopf verlieren“ (14, S. 84). Bei aller Faszination, die von Hölderlin ausging, blieb Mörike doch stets auf eine heilsame Distanz bedacht, die wir künftig im Lichte seiner ängstlichen diätetischen Selbstschutzmaßnahmen noch besser verstehen werden. Und bezeichnenderweise hielt er gerade Heidelberg für das „schönste Hölderlinische Gedicht“ (15, S. 143), eine Ode also, die nicht mit dem Pathos einer idealisierten Antike oder mit gewichtigen philosophischen Gedanken beschwert ist, sondern sich als plastisches lyrisches Situationsbild lesen lässt und damit Mörikes eigenen ästhetischen Vorstellungen entgegenkam.
Auch die Literatur des 18. Jahrhunderts war für Mörike wenigstens in Ausschnitten noch ganz gegenwärtig. Die geläufige Epocheneinteilung der Literaturgeschichte und der Glanz der poetischen Gipfelleistungen um 1800 verstellen heute leicht den Blick dafür, wie lebendig die vorklassischen und vorromantischen Traditionen bis in die Biedermeierzeit hinein blieben. Die Autoren der Aufklärung spielen bei Mörike zwar keine große Rolle; mit Lessing beispielsweise scheint er sich erst näher befasst zu haben, als er am Stuttgarter Katharinenstift Lektionen in deutscher Literaturgeschichte erteilte.18 Dagegen werden wir vor allem in seiner Lyrik Belege für eine produktive Aufnahme jener gesellig-witzigen Dichtung entdecken, die für das Rokoko und die Anakreontik typisch war und deren spielerische Anmut Mörike als besonders reizvoll empfand. Auch einzelne Klopstock-Spuren sind nicht zu übersehen, so in dem Gedicht Im Freien aus der Tübinger Zeit, das den Ton Klopstock’scher Hymnen wie der berühmten Frühlingsfeyer aufnimmt. In späteren Jahren weckten Klopstocks pathetischer Überschwang und sein hochgestimmtes Selbstverständnis freilich Mörikes Skepsis, die er in humoristischer Einkleidung zum Ausdruck brachte: In dem Gedicht Waldplage von 1841 verwandelt sich ein Band mit Klopstocks Gedichten unter den Händen eines verbissenen Schnakenjägers in ein teuflisches Mordwerkzeug!
Näher verwandt fühlte sich Mörike den Poeten des Göttinger Hains: „Diese Periode der deutschen Literatur, oder vielmehr diese besondere Gruppe darin, steht auch vor meiner Einbildung immer von einem eignen Sonnenschein umgeben, wobei es einem, nicht ohne die fühlbarsten Gegensätze der heutigen Zeit, ganz wahrhaft, menschlich und treuherzig ankommt“ (13, S. 243). Bereits in Urach erwärmte er sich für Ludwig Christoph Heinrich Hölty, den bedeutendsten Dichter unter den Hainbündlern: „Das sind gewiß seelige Augenblicke, wenn ich draußen an einem Lieblingsplaze den Hölty auf dem Schooß habe, seinem ächten, frommen Liede zuhöre, mit ihm weinen muß, u. bey dem Gedanke an Jenseits mir vorstelle, daß ich einmal mich dort, dem lieben, blassen Getrösteten zutraulich nahen darf u. ihm dankend ins freundliche Auge blicken“ (10, S. 23). Wie bei der Goethe-Lektüre richtete sich die Aufmerksamkeit des jungen Mörike also auch bei seinem empfindsam getönten Umgang mit Höltys Lyrik gleichsam durch die Werke hindurch unmittelbar auf deren Schöpfer. Er erklärte sogar ausdrücklich: „Was ihn besonders liebenswürdig macht, ist wohl auch seine Persönlichkeit, wie sie in der Biographie durch Voß trefflich geschildert ist“ (ebd.). Von seiner Vorliebe für diesen Poeten zeugt noch das 1836 entstandene Gedicht An eine Lieblingsbuche meines Gartens, in deren Stamm ich Hölty’s Namen schnitt. Des Weiteren ist hier der mittlerweile fast vergessene Lyriker Friedrich von Matthisson zu erwähnen, der gleichfalls in der Tradition der Empfindsamkeit stand, sie aber mit klassizistischen Elementen verband. Er verbrachte seine Altersjahre überwiegend in Stuttgart und war damals in der württembergischen Literaturszene ein ebenso angesehener wie einflussreicher Mann, dessen Werke Mörike kannte, obwohl er seinen Namen nur selten und meist beiläufig erwähnt.
Dass Mörike den Weimarer Klassikern großen Respekt zollte, mit der schwäbischen Romantik vertraut war und die empfindsame Lyrik eines Hölty schätzte, wird man nicht sonderlich überraschend finden. Anders sieht es vielleicht mit einem weiteren prominenten Namen auf seiner Lektüreliste aus, der den Abschluss unseres knappen Überblicks bilden soll: Georg Christoph Lichtenberg. Erste Hinweise auf die Schriften des Göttinger Professors, der durch seine satirische Menschenbeobachtung und seine Kunst des Aphorismus berühmt wurde, finden sich bereits in Briefen aus der Studienzeit19, und von da an begleitete der „über Alles werthe Lichtenberg“ Mörike durch sein ganzes Leben (11, S. 63) – noch 1874 las er ihn „mit neuer Lust“ (19.1, S. 819). Mörike war eben nicht nur der gefühlvolle Natur- und Liebeslyriker, der Sänger im Volkston, der Märchendichter und der feingeistige Kenner der Antike, sondern pflegte auch das Komische, das Wortspiel und einen mitunter grotesken Humor sowie ein reges Interesse an den Abgründen und Widersprüchen des menschlichen Seelenlebens. Wir werden mit diesen Seiten seiner Persönlichkeit und seines Schaffens, die ihn als einen Geistesverwandten Lichtenbergs erscheinen lassen, noch näher bekannt werden.
Von eigenen Vorlieben und Anregungen aus seinem Freundeskreis geleitet, eignete sich Mörike also schon frühzeitig eine recht ausgebreitete Kenntnis der deutschsprachigen Literatur mit einigen deutlich erkennbaren Schwerpunkten an. Neben seiner Belesenheit auf dem Feld der Dichtung verdient aber auch das Gebiet der Philosophie unsere Aufmerksamkeit. War Mörike insbesondere mit den großen Entwürfen des deutschen Idealismus vertraut? Im Ruf eines philosophischen Kopfes stand er wahrlich nie, und Staigers lapidare Bemerkung, er habe „zu ernsthaftem Denken keine Lust und kein Geschick“ gehabt20, dürfte eine verbreitete Auffassung widerspiegeln. Eine sorgfältige Prüfung der Quellen ergibt indes ein differenzierteres Bild. Fraglos verspürte Mörike keine Neigung, dickleibige Wälzer, die abstrakt-gedankliche Systeme entwickelten, gründlich durchzuarbeiten. 1832 schrieb er seinem Freund Friedrich Theodor Vischer: „Ein rechtes, im Ernste dankenswerthes, Verdienst würdest Du Dir um meine philosoph. Wenigkeit erwerben, wolltest Du mir die HauptSätze des Hegelschen Systems zusammschreiben. Du sollst sehen, daß ich bei solchen Communikationen viel lernbegieriger bin als wenn ich ein langes u. breites Buch vor mir liegen habe“ (11, S. 283f.). Mit einem zeitgenössischen Antipoden Hegels verfuhr er noch dreißig Jahre später ähnlich: „Ich lese gegenwärtig (Nachts im Bett) Arth. Schopenhauers Leben mit einer kurzen Darstellung seiner Lehre. Beides höchst merkwürdig“ – wobei das Prädikat „merkwürdig“ im älteren Wortsinne so viel wie ‚bemerkenswert‘ bedeutet (17, S. 181). Ein Interesse an Philosophie war bei Mörike also durchaus vorhanden, nur zog er es vor, solch anspruchsvolle Kost in möglichst leicht verdaulicher Form zu sich zu nehmen.
Die großen kunstphilosophischen Arbeiten des Hegelianers Vischer müssen ihn schon wegen seiner engen Bekanntschaft mit dem Verfasser, aber auch aufgrund ihres Gegenstandes angezogen haben. 1837 pries er die Schrift Über das Erhabene und Komische überschwänglich, wobei er besonders „die Tiefe u. Feinheit“ ihrer Psychologie rühmte (12, S. 146), und 1851 versuchte er sich sogar an der umfangreichen Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen. Diesen trockenen Stoff fand er jedoch recht ungenießbar, wie er Vischer dezent andeutete: „Indessen will ich fleißig in Deinem Buche seyn, nach dem ich mehrmals das größte Verlangen verspürte. Ein Theil, der erste, war einmal zwei Tage lang in meinen Händen; ich suchte daran herum wie der Hund mit der Schnauze an einer festen Kugel, wo keine Ecke ist um so in der Geschwindigkeit was loszukriegen“ (16, S. 13). Einige Monate später bekannte er dann, zu einem „ordentliche[n] Studium Deiner 2 Bände Ästhetik noch nicht“ gekommen zu sein und lediglich einige Auszüge gelesen zu haben (S. 37). Seine Lobesworte für das monumentale Werk fielen denn auch recht pauschal aus.
Aufgeschlossenheit für philosophische Fragen bewahrte sich Mörike bis ins Alter. 1859 war er beispielsweise mit Spinoza beschäftigt21, und 1868 schrieb er Moriz von Schwind, dass er sich gerade eifrig mit „Geschichte und Philosophie“ abgebe, wobei er hinzufügte: „So etwas ist mir, wenn auch blos als Geistesübung und Erfrischung von Zeit zu Zeit Bedürfnis“ (19.1, S. 33). Wenn es für ihn aber einen wirklichen Leitstern am Himmel der philosophischen Denker gab, so war dies Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Wieder mögen dabei persönliche, biographische Beziehungen eine Rolle gespielt haben. Schelling, Sprössling einer alten schwäbischen Pfarrersfamilie und Absolvent des Tübinger Stifts, hatte 1810 in Stuttgart im Hause Georgiis Privatvorlesungen gehalten, und sein jüngerer Bruder, ein studierter Mediziner, fungierte zeitweilig als Hausarzt der Familie Mörike – solche überraschenden Verbindungen erhellen schlaglichtartig, wie überschaubar der Kreis der württembergischen Ehrbarkeit war. 1826 lernte Mörike in Nürtingen zu seiner Freude zwei Söhne Schellings kennen, den er bei dieser Gelegenheit einen „großen Philosophen“ nannte; bezeichnenderweise wünschte er sich sehr, einen Brief von der Hand ihres Vaters lesen zu können, was sich aber leider nicht machen ließ (10, S. 125). Noch das Gedicht Auf die Nürtinger Schule von 1860 preist Schelling als „Genius“ (1.1, S. 312), und zwei Jahre darauf äußerte sich Mörike nach einem erneuten Studium seiner Werke enthusiastisch über den „frischen belebenden Eindruck des Schellingischen Geistes“ (17, S. 195). 1870/71 genoss er schließlich die Lektüre einer Edition von Schellings Briefen.22
Wie weit er Schellings Lehren schon in jungen Jahren aus eigener Lektüre kannte, ist schwer festzustellen. In Tübingen könnte Adolf Karl August Eschenmayer, der dort über Medizin und Philosophie dozierte und im Investiturlebenslauf unter Mörikes Lehrern genannt wird, als Vermittler gewirkt haben, und darüber hinaus ist stets die Möglichkeit zu bedenken, dass Mörike aus Gesprächen mit Freunden und Kommilitonen Kenntnisse bezog, deren Spuren kaum mehr nachweisbar sind. 1831 war Schelling jedenfalls Gegenstand einer Unterhaltung mit Mährlen, die Mörike im Rückblick folgendermaßen charakterisierte: „Unsere Gedanken, indem sie dem Schellingschen Urgrund beykommen wollen, sind gleich zweien Bohrern, die von entgegengesezten Seiten ein Bret durchbohren und im Dunkeln zusammentreffen. Sie ziehen sich hernach langsam zurück und erzählen einander bei Tag was für Ungeheuer ihnen unterwegs begegnet“ (11, S. 285). Unter dem „Urgrund“ hat man hier jenes mit Gott identische unvordenkliche Sein zu verstehen, aus dem nach Schelling die Welt hervorgegangen ist, um sich dann im universalhistorischen Prozess zu immer komplexeren und bewussteren Formen zu entwickeln. Die Briefpassage bezeugt nicht nur Mörikes prinzipielle Vertrautheit mit solchen Überlegungen, sondern taucht die angestrengten Bemühungen des spekulativen Denkens, den Ursprung aller Dinge zu erfassen, durch ihren verblüffenden Vergleich auch in ein merklich ironisches Licht.
Die Einsicht, dass Mörike sich mit Schellings Philosophie auseinandersetzte, hilft bei dem Verständnis eines lyrischen Werkes aus der Tübinger Zeit, das gewiss zu seinen rätselhaftesten zählt. Nach Mörikes eigenen Angaben wurde das Gedicht Die Elemente 1824 geschrieben23; die älteste überlieferte Version findet sich in einer Handschrift von 1828. Zehn Jahre später nahm der Verfasser für die erste Ausgabe seiner gesammelten Gedichte gewichtige Änderungen an dem Text vor, und 1841 überarbeitete er die Strophen abermals. Ihr Protagonist ist in sämtlichen Fassungen ein Riese, „der Elemente Meister“ (1.1, S. 213), der offenbar als allegorische Gestalt die Kräfte der Natur verkörpert, dabei aber selbst unter ihrem zerstörerischen Wirken leidet. Trost findet er allein in den Verheißungen einiger engelsgleicher himmlischer Gestalten, die ihm für die Zukunft eine Versöhnung und Läuterung der Natursphäre versprechen.
Man kann diesen Text als eine eigenwillige poetische Umsetzung der naturphilosophischen Thesen Schellings auffassen. Bei seinen späteren Eingriffen hat Mörike freilich auch Bezüge zu christlichen Erlösungshoffnungen hergestellt und das anonyme Schicksal, das über dem Riesen waltet, mehr im Sinne einer göttlichen Vorsehung aufgefasst. In der Sammlung versah er das Gedicht mit einem griechischen Motto aus dem Römerbrief des Paulus (Röm 8,19) – in Luthers Übersetzung: „Denn das endliche harren der creatur wartet auff die offenbarung der kinder Gottes“24 –, und 1841 baute er mit der Wendung vom „Wort von Anfang“ (1.1, S. 215) noch eine Anspielung auf den berühmten Eingangsvers des Johannes-Evangeliums ein. Damit vollzog er im Grunde aber nur die Bewegung von Schellings Spätphilosophie nach, die, etwa in der Lehre von den Weltaltern, gleichfalls christliche Vorstellungen in ihre pantheistisch gefärbte Konzeption integrierte, wobei sie nicht zuletzt auf das Gedankengut des schwäbischen Pietismus zurückgriff. Für Schelling sind in Gott, dem „Urgrund“, von jeher Reales und Ideales, Stoff und Geist miteinander verbunden. Die Geschichte der Welt ist dann nichts anderes als die unaufhörliche Bearbeitung und liebende Beseelung des dunklen, materiellen Prinzips durch die ideale, geistige Kraft, die ihren Widerpart auf dem Wege vom Anorganischen über die Pflanzen und die Tiere bis hin zum Menschen einer fortschreitenden Läuterung unterwirft. Der Sündenfall hat diese Kontinuität und damit den Gang der Schöpfung jedoch auf fatale Weise unterbrochen und mit der Menschheit zugleich auch das ganze Reich der Natur, der Materie, von der höheren Geisterwelt losgerissen, weshalb es seither, dem blinden Streit der Elemente preisgegeben, in Schmerz und Trauer verharrt. Gottes Streben geht aber dahin, „die ausgestoßene und ausgeschlossene Natur nicht in dieser Verstoßung zu lassen, sie geistig wieder ins Göttliche zu verklären und das ganze Universum zu Einem großen Werk der Liebe zu verschmelzen“; damit wird dereinst „die höhere Potenz des eigentlich ewigen und absoluten Lebens“ verwirklicht sein.25 In seinen Notizen für die Stuttgarter Privatvorlesungen bezieht sich Schelling in diesem Zusammenhang ebenfalls ausdrücklich auf Paulus: „Die Natur ist ohne Schuld unterworfen dem jetzigen Zustand (Pauli Stelle), sie sehnet sich nach der Verbindung“.26 Tatsächlich behält auch der Römerbrief die künftige Erlösung nicht dem Menschen allein vor, sondern dehnt sie auf die ganze Schöpfung (bei Luther: die „creatur“) aus: „Denn auch die creatur frey werden wird von dem dienst des vergenglichen wesens/zu der herrlichen freiheit der kinder Gottes“ (Röm 8,21). Dazu vergleiche man nun die Schlussstrophen von Mörikes Gedicht mit den eschatologischen Verheißungen der himmlischen Genien:
Einst wird es kommen, daß auf Erden
Sich höhere Geschlechter freun,
Und heitre Angesichter werden
Des Ewigschönen Spiegel sein,
Wo aller Engelsweisheit Fülle
Der Menschengeist in sich gewahrt,
In neuer Sprachen Kinderhülle
Sich alles Wesen offenbart.
Und auch die Elemente mögen,
Die gottversöhnten, jede Kraft
In Frieden auf und nieder regen,
Die nimmermehr Entsetzen schafft;
Dann, wie aus Nacht und Duft gewoben,
Vergeht dein Leben unter dir,
Mit lichtem Blick steigst du nach Oben,
Denn in der Klarheit wandeln wir.
(1.1, S. 215)
In Die Elemente versuchte Mörike, sich auf seine Weise Schellings spekulative Ideen zu eigen zu machen, wobei ihm deren Nähe zu den vertrauten Lehren des Neuen Testaments den Zugang erleichtert haben mag. Eine solche zur Allegorie tendierende bildhafte Einkleidung abstrakter philosophisch-theologischer Vorstellungen bildet allerdings eine Ausnahme in seinem Werk, das der Gedankenlyrik sonst sehr fern steht. Seine Texte deshalb für gedankenleer zu halten, wäre jedoch voreilig: Die Elemente der Reflexion bleiben dort zwar in der Regel implizit, können aber gleichwohl äußerst komplex sein. Im Vorgriff auf Späteres sei hier nur darauf verwiesen, dass es Mörike gelungen ist, mit einem einzigen Vers, nämlich mit der Schlusszeile des Gedichts Auf eine Lampe, die eine Lehre über das Wesen des Schönen formuliert, ganze Generationen von Auslegern ins Grübeln zu bringen – eine beachtliche Leistung für einen Mann, der angeblich „zu ernsthaftem Denken keine Lust und kein Geschick“ hatte! Wir werden bei der Beschäftigung mit Mörike immer wieder bestätigt finden, dass Dichtung ebenso gedankenreich sein kann wie der philosophische Diskurs, auch wenn sich ihr spezifisches Denken nicht in begrifflichen Abstraktionen vollzieht, sondern unmittelbar in ihre ästhetische Gestalt eingelassen ist.