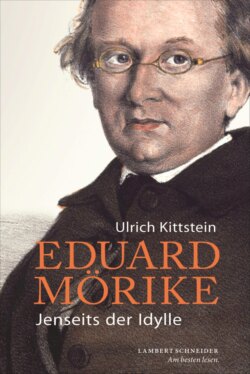Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. KINDHEITSHEIMAT UND FAMILIENBANDE Ludwigsburg
ОглавлениеDas kleine dramatische Intermezzo Der lezte König von Orplid, das Mörike in seinen Roman Maler Nolten eingebaut hat, spielt auf einer fiktiven Insel irgendwo im südlichen Pazifik. Orplids Ureinwohner sind einst dem Zorn der Götter zum Opfer gefallen, nur die gleichnamige Metropole steht noch, völlig menschenleer, „als ein traurig schönes Denkmal vergangener Hoheit“ da (3, S. 96), bis sie viele hundert Jahre später von einigen europäischen Schiffbrüchigen wiederentdeckt wird. Einer dieser Neusiedler schildert rückblickend, wie sich die Ankömmlinge mit Schrecken und Verwunderung der Geisterstadt näherten:
Nun es aber gegen Morgen dämmerte, kam sie beinahe noch ein ärger Grauen an; es kräheten keine Hähne, kein Wagen ließ sich hören, kein Bäcker schlug den Laden auf, es stieg kein Rauch aus dem Schornstein. Es brauchte dazumal Jemand das Gleichniß, der Himmel habe über der Stadt gelegen, wie eine graue Augenbraun über einem erstarrten und todten Auge. Endlich traten sie Alle durch die Wölbung der offenen Thore; man vernahm keinen Sterbenslaut als den des eigenen Fußtritts und den Regen, der von den Dächern niederstrollte, obgleich nunmehr die Sonne schon hell und goldig in den Straßen lag. Nichts regte sich auch im Innern der Häuser. (S. 100)
Die Märcheninsel Orplid wurde von Mörike und seinem Freund Ludwig Bauer in gemeinschaftlicher Fabulierfreude erfunden, während sie beide in Tübingen studierten. Doch scheinen in das im Roman entworfene Bild der verlassenen Stadt auch sehr konkrete Erfahrungen eingeflossen zu sein, die Mörike schon in frühester Jugend gemacht hatte, und zwar in Ludwigsburg, wo er am 8. September 1804 zur Welt kam und die ersten dreizehn Jahre seines Lebens verbrachte. Ein „traurig schönes Denkmal vergangener Hoheit“ war dieser Ort damals nämlich ebenfalls.
Ludwigsburg mit seinem riesigen Barockschloss, wenige Kilometer nördlich von Stuttgart gelegen, entstand im frühen 18. Jahrhundert als Gründung des württembergischen Herzogs Eberhard Ludwig. Im Gegensatz zu Stuttgart oder Tübingen, die sich aus mittelalterlichen Wurzeln entwickelt hatten, wurde es buchstäblich auf dem Reißbrett entworfen und im Stil des absolutistischen Zeitalters äußerst großzügig geplant, mit breiten Straßen in moderner rechtwinkliger Anordnung, prächtigen Alleen und weitläufigen Parkanlagen. Als neue Residenz Württembergs war die Stadt von Anfang an stark vom Hof, vom Militär und von der Beamtenschaft geprägt. Doch 1775 verlegte Herzog Karl Eugen – der Landesvater des jungen Schiller – den Regierungssitz endgültig nach Stuttgart, und obwohl Ludwigsburg fortan immerhin noch als zeitweiliger Sommeraufenthalt des Hofes diente, war seine Glanzzeit unwiderruflich vorüber. Justinus Kerner, der Arzt und Dichter, der gleichfalls aus Ludwigsburg stammte, allerdings achtzehn Jahre älter war als Mörike, berichtet in seinem Bilderbuch aus meiner Knabenzeit, wie die Vaterstadt in den Sommermonaten auflebte: „in dieser Zeit füllten sich die weiten, menschenleeren Gassen, Linden- und Kastanienalleen Ludwigsburgs mit Hofleuten in seidenen Fräcken, Haarbeuteln und Degen und mit den herzoglichen Militärs in glänzenden Uniformen und Grenadierkappen, gegen welche die andern wenigen Bewohner in bescheidenen Zivilröcken verschwanden.“1 In der Rückschau kommen dem Erwachsenen die verschwenderischen Feste Karl Eugens mit ihren Feuerwerken, Maskenbällen und künstlichen Zaubergärten wie „bunte Träume“ vor. Kerner weiß aber ebenso anschaulich von der melancholischen Stimmung zu erzählen, in die Ludwigsburg verfiel, wenn der Hof abwesend war:
Bevölkerung und Gewerbe waren ohnedies klein und desto auffallender die Menschenleere in den langen, weitgebauten Straßen. Ich erinnere mich noch mancher Sonntage, wo nachmittags der große Marktplatz vor unserm Hause so still war, daß man auf demselben fast die Perpendikel der benachbarten Turmuhr gehen hörte. In den Arkaden waren oft die einzige Bevölkerung die Hühner des Italieners Menoni und nur das Krähen derselben unterbrach die Stille, die oft ringsherum herrschte. […]
Besondere Gefühle von Verlassenheit und Trauer wandelten einen in den vielen langen und menschenleeren Alleen der Stadt an. So hatten auch die großen verlassenen Räume des Schlosses und namentlich die Gegend des Corps de Logis etwas Unheimliches, Gespensterhaftes.2
Der Zeitgenosse Carl Theodor Griesinger nannte Ludwigsburg sogar kurzweg die „Todtenresidenz Württembergs“: „nirgends sind die Straßen breiter und die Häuser entvölkerter.“3 Man darf annehmen, dass diese Umgebung seiner Kindheit einigen Einfluss auf Mörikes Imagination des verödeten Orplid ausgeübt hat, wo das kleine Häuflein europäischer Siedler, eng zusammengedrängt, ganz am Rande der riesigen alten Königsstadt haust. Übrigens hatte schon Kerner ein Beispiel dafür gegeben, wie man ihre gemeinsame Heimat in die Welt der poetischen Fiktion hinüberspielen konnte, denn der Ort Grasburg in seinen romantisch-phantastischen Reiseschatten ist unverkennbar ein verfremdetes Abbild Ludwigsburgs:
Durch die schönen Gänge von Linden- und Kastanienbäumen führte uns der Weg in die Stadt Grasburg ein.
Totenstille herrschte, die nur von dem Gesumse der Bienen um die Blüten der Bäume unterbrochen wurde. Lange, weite Straßen eröffneten sich, sie wurden durch niedliche, gelbgefärbte Häuser gebildet.
[…]
An den Häusern sproßte hohes Gras auf, Schmetterlinge, Goldvögel und Maienkäfer durchflogen die sonnenhellen Straßen und setzten sich bald auf die Dächer der Häuser, bald auf dies Stadtgras, welches wunderlich anzusehen war.4
Die schmerzlich-süße Wehmut, die sich an Vergänglichkeit und Verfall knüpft und aus der Einsicht in den Abstand zwischen Einst und Jetzt erwächst, gehört zu den auffallendsten Konstanten in Mörikes seelischem Leben, und sie dürfte eine ihrer Wurzeln in der eigentümlichen Atmosphäre Ludwigsburgs gehabt haben, die er in den Kinderjahren gleichsam in sich aufsog. Bestätigt wird diese Vermutung durch ein Leitmotiv in seinen Schriften, das mit solchen Empfindungen eng verbunden ist und ebenfalls in die Ludwigsburger Zeit zurückweist. In der Emichsburg, einer künstlichen Ruine im dortigen Schlosspark, war eine Äolsharfe installiert, wie sie dem Geschmack der Empfindsamkeit und später der Romantik entsprach, und dieses Instrument muss mit seinen geisterhaften Klängen nachhaltigen Eindruck auf den jungen Mörike gemacht haben. In einem Brief vom Mai 1831, in dem er seiner Verlobten Luise Rau von einer Fahrt nach Ludwigsburg berichtet, liest man: „Wir durchstrichen die melankolischen Gänge der königl. Anlage; in der Emichsburg hört ich die Windharfen flüstern wie sonst, die süßen Töne schmolzen alles Vergangene in mir auf“ (11, S. 201). Die „Klage der Äoleusharfe“ (10, S. 247) erwähnte der Dichter auch sonst gerne, wenn ihn Wehmut überkam, und für gewöhnlich glitten seine Gedanken dann zur Emichsburg zurück.5 Das Gedicht An eine Äolsharfe, das dieses Motiv in den Mittelpunkt rückt, wird uns an anderer Stelle noch beschäftigen, und auch die Eingangsverse von Ach nur einmal noch im Leben! assoziieren die Windharfe mit Melancholie und Vergänglichkeit.
Mörike blieb Ludwigsburg zeitlebens innig verbunden. Noch im vorgerückten Alter zelebrierte er jede Reise, die ihn dorthin führte, pietätvoll wie eine „Wallfahrt“ (17, S. 223, und 18, S. 104), und in dem eben zitierten Brief an Luise Rau erzählt er: „es war beschlossen daß die wenigen Stunden rein nur den heiligsten Erinnerungen, d.h. der Stadt selbst und ihren alten Plätzchen sollten gewidmet [sein] – nichts wollte man sehen was an das neuere Zeitalter mahnte und auf alle Besuche wurde verzichtet“ (11, S. 200). In Mörikes poetischem Werk zeugt nicht allein das Orplid-Spiel in Maler Nolten von dieser Nostalgie. In der Novelle Lucie Gelmeroth spiegelt die Haltung des fiktiven Ich-Erzählers, der nach langer Abwesenheit erstmals wieder seine „Geburtsstadt“ betritt, offenkundig die seines Schöpfers wider: „ich theilte daher in der Stille die Stunden des übrigen Tags für mich ein. Ich wollte nach Tische die nöthigsten Besuche schnell abthun, dann aber möglichst unbeschrien und einsam die alten Pfade der Kindheit beschleichen“ (6.1, S. 13). Jahrzehnte später erläuterte Mörike seinem Altersfreund Moriz von Schwind, dass er für eine Episode aus der Jugend dieses Erzählers den sogenannten „Salon“ als Schauplatz gewählt habe, „eine Art von Park mit alten dunkelschattigen Kastanienalleen bei meiner guten Vaterstadt Ludwigsburg“ (19.1, S. 39).
Mörike scheint in seiner „guten Vaterstadt“ tatsächlich eine ausgesprochen glückliche Zeit verlebt zu haben. Aber in den einschlägigen Selbstzeugnissen, die natürlich aus späteren Jahren stammen, leuchtet das Licht der Kindheit stets durch den Schleier einer wehmütigen Trauer um das unwiederbringlich Verlorene. Noch einmal der Brief an Luise von 1831: „Es war das heiterste Wetter, wir durchzogen die Straßen, die Alleen, ich betrat – als ein Fremder mit wunderlichem Schauder das Haus meiner Eltern – o! wie viel Schönes ist da im Hof und Garten umgestaltet! Als ich einen Stumpf der herrlichen Maulbeerbäume, die mit den Zweigen sonst das Dach erreichten, so kläglich aus der Erde blicken sah brannte mein Inneres von Schmerz“ (11, S. 200f. Gern dachte Mörike auch an die schon mehrfach erwähnten Ludwigsburger Kastanienalleen zurück, die so wundervolle Spielplätze abgaben. 1845 schrieb er folgendes Gedicht, das er zusammen mit einer Handvoll Kastanien aus dem Schlossgarten von Mergentheim seiner jüngeren Schwester Klara überreichte:
Mir ein liebes SchauGerichte
Sind die unschmackhaften Früchte,
Zeigen mir die Pracht-Gehänge
Heimatlicher Schattengänge,
Da wir in den Knabenzeiten
Sie auf lange Schnüre reihten,
Um den ganzen Leib sie hiengen
Und als wilde Menschen giengen,
Oder sie auch wohl im scharfen
Krieg uns an die Köpfe warfen. –
Trüg ich, ach, nur eine Weile
Noch am Schädel solche Beule,
Aber mit der ganzen Wonne
Jener Ludwigsburger Sonne!
(14, S. 277)
Die von strahlendem Licht erfüllte Kindheit ist hier die Zeit vor all jenen Entfremdungen und Entzweiungen, die der Eintritt in die Welt der Erwachsenen und der gesellschaftlichen Ordnung unweigerlich mit sich bringt, und damit der einzige Lebensabschnitt, in dem der Mensch, noch ganz im Einklang mit sich selbst, uneingeschränkte „Wonne“ genießen kann. Diese Auffassung hat ihre Vorläufer in der Kindheitsutopie der Romantik. Deren Dichter fanden im Kind den paradiesischen Urzustand der Menschheit wieder, der mit dem Sündenfall der Bewusstwerdung sein Ende gefunden hatte, und integrierten das verklärte Ideal der Kindheit damit in ein geschichtsphilosophisches Verlaufsschema. „Wo Kinder sind, da ist ein goldnes Zeitalter“, lautet die einprägsame Formulierung in einem Fragment aus der Blüthenstaub-Sammlung des Novalis.6 Solche weit ausgreifenden Spekulationen waren Mörikes Sache nicht. Für ihn bedeutete die glückliche Kindheit zuallererst eine ganz persönliche, individuelle Erfahrung, die er im Gedicht noch einmal sehnsüchtig heraufbeschwor, wobei die humoristische Einfärbung der Verse freilich weder steifes Pathos noch übertriebene nostalgische Schwärmerei aufkommen lässt. Was Mörike aber mit der Romantik verbindet, ist der Umstand, dass Kindheit immer als vergangene, als ein verlorenes Paradies in den Blick kommt. Die vom Atem der Vergänglichkeit angehauchte Stimmung milder Wehmut hat in Mörikes Biographie also einen doppelten Ursprung. War schon Ludwigsburg selbst von der melancholischen Atmosphäre vergangener Schönheit und verblassten Glanzes erfüllt, so trat für den Dichter später noch der unüberbrückbare Abstand zu den seligen Jahren der eigenen Kindheit und Jugend hinzu, die, wie er einmal in einem Brief schrieb, stets „im warmen Sonnenschein“ vor seinem inneren Auge lagen (11, S. 88).