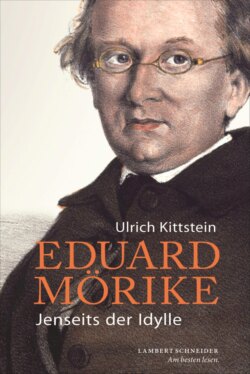Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. URACH, TÜBINGEN UND ORPLID: BlLDUNGSWEGE UND FREUNDSCHAFTSBÜNDE Akademische Studien
ОглавлениеMit der Entscheidung, den jungen Eduard für eine Laufbahn als Geistlicher zu bestimmen, traf die Familie keine originelle, aber eine vernünftige Wahl. Längst war die württembergische Ehrbarkeit mit den evangelischen Pfarrern und ihren Familien zu einer verhältnismäßig einheitlichen Führungsschicht verschmolzen, und die Karriere im Kirchendienst stellte einen gängigen Weg für die Sprösslinge der bürgerlichen Honoratioren dar. Sie bot handgreifliche Vorteile, verhieß sie doch eine angesehene gesellschaftliche Position und ein lebenslanges sicheres Auskommen. Überdies wurde die Ausbildung durch staatliche Stipendien finanziert. Ihr genau festgelegter Ablauf ging auf die „Große Kirchenordnung“ zurück, die Herzog Christoph im 16. Jahrhundert erlassen hatte, als man in Württemberg nach der Durchsetzung der Reformation für den dringend benötigten geistlichen Nachwuchs Sorge tragen musste. Die erste Hürde für angehende Theologen bildete das sogenannte Landexamen. Wer sich in dieser strengen Prüfung bewährte, ging anschließend auf ein Niederes theologisches Seminar und bezog dann zum eigentlichen Studium das Höhere evangelisch-theologische Seminar an der Landesuniversität Tübingen – kurz: das Tübinger Stift. Dem Examen folgte normalerweise eine Phase als Vikar, der an unterschiedlichen Orten befristet als Helfer oder Stellvertreter eines Pfarrers eingesetzt wurde, bevor schließlich die eigene Pfarrstelle winkte.
Mörike besuchte zunächst die Lateinschule in Ludwigsburg, deren Name bereits verrät, was es dort hauptsächlich zu lernen gab: Nach wie vor galt die lateinische Sprache als Grundlage jeder höheren Bildung. Nach dem Tod des Vaters wechselte der Junge im Herbst 1817 auf das Gymnasium illustre in Stuttgart, wo er sich unter Georgiis Fittichen noch ein Jahr lang auf das Landexamen vorbereitete. Seine Leistungen waren freilich bestenfalls mittelmäßig, und daran sollte sich auch in der Folgezeit nichts ändern. Vor allem an Fleiß ließ er es oftmals fehlen: „arbeitet nicht gern wenn er nicht muß“, lautete später das lapidare Urteil eines Professors am Niederen theologischen Seminar.1 So wäre der Vierzehnjährige eigentlich schon am Nadelöhr des Landexamens gescheitert, bei dem es lediglich für einen mageren 64. Platz unter 81 Prüflingen reichte. Gnadenhalber wurde er dennoch zum weiteren Ausbildungsweg zugelassen, wobei seine familiäre Situation, aber auch das Ansehen des Onkels den Ausschlag gegeben haben dürften. Mörikes Investiturlebenslauf übergeht dieses peinliche Detail begreiflicherweise und erwähnt nur beiläufig die „bestandene lezte Schulprüfung“ (7, S. 332).
Das Gefüge der Niederen theologischen Seminare war damals gerade erst reformiert und umstrukturiert worden. Fortan gab es mit Blaubeuren, Maulbronn, Schöntal und der neugeschaffenen Lehranstalt in Urach auf der Schwäbischen Alb nur noch vier derartige Einrichtungen im Lande. Mörike gehörte im November 1818 mit rund vierzig weiteren Jungen zum ersten Jahrgang – der ersten „Promotion“ –, der in Urach einzog. Das Seminar war wie ein Internat organisiert, doch der Unterrichtsstoff glich dem eines humanistischen Gymnasiums: Den Schwerpunkt bildeten die alten Sprachen und die Dichter, Denker, Redner und Historiker des klassischen Altertums; daneben legte man besonderen Wert auf Geschichte und Philosophie. Den neuhumanistischen Geist, der in den Theologischen Seminaren Württembergs herrschte, verdeutlicht ein Passus aus den Statuten der Uracher Schule:
Das Princip des Humanismus, das bisher in den Seminarien dem Unterricht zum Grunde gelegt wurde, soll es auch ferner werden. Studium der Meisterwerke der alten Claßiker sey daher die Hauptbeschäftigung. Nur die vorzüglichsten dieser Claßiker werden so behandelt, daß Sprach- und Sachkunde in möglichster Vereinigung getrieben, die Lehrlinge zu gründlichen Philologen gebildet, aber auch zugleich an diesen Meisterwerken der Geschichte, der Poesie der Redekunst und der Philosophie ihre Geisteskräfte allseitig entwickelt, geübt, geschärft, und diese als praktische Belehrungsmittel über Geschichte, Poesie, Rhetorik, Aesthetik und Philosophie, und als Hauptmittel einer umfaßenden Bildung des Geistes und des Gemüths benüzt werden.2
Am Höheren Seminar in Tübingen, wo Mörike von 1822 bis 1826 studierte, sah es anfangs ganz ähnlich aus, denn auch dort hatte er sich in den ersten Semestern vorwiegend mit Philologie und Philosophie zu befassen, bevor endlich die Theologie in den Vordergrund rückte. Mit dem Griechischen und Lateinischen wurde er nach und nach vertraut, obwohl er im Unterricht nie brillieren konnte. Das Hebräische aber bereitete ihm immer große Pein und verfolgte ihn sogar im Schlaf, wenn man dem Jahre später entstandenen humoristischen Gedicht Scherz (1.1, S. 360) Glauben schenken darf. In diesen Versen erscheint dem Sprecher im Traum sein „alter hebräischer Lehrer“ in Gestalt eines hebräischen Schriftzeichens, von dem der Schulversager nicht einmal zu sagen weiß, ob es nun ein „Kamez“ oder ein „Komez Chatuf“ ist. Als das „grammatikalische Scheusal“ ihm ans Leben will, ruft der Bedrohte in höchster Not den Kompromotionalen Dettinger, der sich im Hebräischen besonders auszeichnete, als Schutzpatron an und vermag sich so im letzten Augenblick zu retten … Moderne Fremdsprachen kamen im Unterricht allenfalls am Rande vor. Mörike bekannte später seine „mangelhafte Kenntniß des Französischen“ und seine „gänzliche Fremdheit im Englischen“ (16, S. 20), das im Curriculum überhaupt keinen Platz fand. So musste er für die lyrische Nachdichtung Ritterliche Werbung auf eine wörtliche Übersetzung der englischen Vorlage ins Deutsche zurückgreifen3 und bedauerte einmal, dass ihm der „Urtext“ von Shakespeares Gedichten „unzugänglich“ sei (18, S. 213). Dagegen machte er 1830 im Hinblick auf eine mit Johannes Mährlen geplante, aber nie ausgeführte Reise nach Venedig auf eigene Faust „Anstalten […] ein wenig Italiänisch zu lernen“ (11, S. 151). Ganz fruchtlos können diese Bemühungen nicht geblieben sein, denn er war später zumindest imstande, einen italienischen Brief einigermaßen zu verstehen.4
Zu den Sprachkenntnissen, die Schule und Studium vermittelten, trat die intensive Beschäftigung mit Rhetorik und Poetik. Der reflektierte, kunstvolle Umgang mit dem gesprochenen und geschriebenen Wort bildete, wiederum ganz in humanistischer Tradition, einen gewichtigen Bestandteil des Unterrichts, und da die Schüler in Urach zu Übungszwecken selbst lateinische und deutsche Verse anfertigen mussten, lernten sie auch, konventionelle Gedichtformen praktisch zu handhaben. Davon zeugen einige lyrische Werke Mörikes aus den Jahren am Niederen Seminar, die in den Bereich der Kasualpoesie gehören, also für den feierlichen Vortrag bei öffentlichen Anlässen bestimmt waren und sich an den entsprechenden Regeln orientieren. Überliefert sind mit Württembergs Trauer seit dem 9ten Januar 18195 und Auf Erlenmayers Tod, 2. Juni 1820 zwei Texte, die der bis in die Antike zurückreichenden Gattung des Epicediums, des formvollendeten Trauergedichts, angehören – der erste beklagt den frühen Tod der Königin Katharina von Württemberg, der zweite gilt einem Mitschüler –, sowie Die Liebe zum Vaterlande. Auf den 31. Dezember 1819, ein nicht minder schulgerechtes Festgedicht zum Jahresausklang mit mancherlei zeitgeschichtlichen Anspielungen.
Schon allein das Wissen um Mörikes Bildungsweg in Ludwigsburg, Stuttgart, Urach und Tübingen sollte vor dem verbreiteten Klischee vom naiv-provinziellen Liederdichter warnen. Mörike war ein poeta doctus, auch da, wo er für seine Lyrik keine antikisierenden Versformen wählte, sondern sich etwa des vermeintlich schlichten Volksliedtons bediente. Seine Dichtung entsprang nicht bloß dem Gefühl und der Intuition, sie ruhte ebenso sehr auf dem Fundament einer gediegenen philologischen und rhetorischen Bildung. Zumindest im Rückblick hat er den Wert seiner humanistischen Studien auch dankbar anerkannt, wie sich beispielsweise aus dem Brief ersehen lässt, den er 1848 an Karl Ludwig Roth schrieb, seinen „geliebtesten Lehrer“ aus der Gymnasialzeit, der ihm damals in seinem Hause „einigeMal lateinische PrivatLektion ertheilt“ hatte (15, S. 279f.). Roth wird übrigens als einziger unter den Stuttgarter Lehrern auch im Investiturlebenslauf namentlich und „mit besonderer Achtung u. Anhänglichkeit“ genannt (7, S. 332). Der im engeren Sinne theologische Anteil der Ausbildung scheint Mörike dagegen wenig interessiert zu haben. Davon wird später zu reden sein, wenn es um seine Haltung zur christlichen Religion und zu seinem geistlichen Beruf geht.
Indem sie die Pfarrer für die lutherische Landeskirche und die weltlichen Beamten für den Staat heranbildeten, prägten das Stift und die Tübinger Universität über Jahrhunderte hin das württembergische Geistesleben. Die weitaus meisten Männer, die in Schwaben als Dichter und Denker hervortraten – Frauen hatten keinen Zugang zu solchen Bildungschancen! –, waren Absolventen dieser Institutionen, die allenfalls im späten 18. Jahrhundert mit der von Herzog Karl Eugen begründeten, aber bereits 1794 wieder aufgelösten Hohen Karlsschule zeitweilig eine ernstzunehmende Konkurrenz bekamen. Es war auch keineswegs ausgemacht, dass ein junger Mann, der das Stift hinter sich gebracht hatte, anschließend tatsächlich in den Dienst der Kirche trat, denn daneben standen ihm, sofern er die Kosten seiner Ausbildung erstattete, noch ganz andere Karrieren offen, beispielsweise in einem Lehrberuf oder als Verleger, Redakteur oder freier Autor. Von Mörikes engsten Freunden blieb einzig Wilhelm Hartlaub dem geistlichen Amt auf Dauer treu, während Wilhelm Waiblinger, Johannes Mährlen und Friedrich Theodor Vischer der Theologie alsbald den Rücken kehrten und Ludwig Bauer seine Pfarrstelle nach einigen Jahren wieder verließ. Die Universität und das Stift sorgten jedenfalls für eine auffallend einheitliche geistige Prägung der gebildeten bürgerlichen Kreise in Württemberg, die den gesellschaftlichen Verkehr und die Kommunikation sehr erleichterte. Als das soziale Milieu, in dem Mörike sich zeitlebens bewegte, stellten diese Kreise auch das Publikum, das er bei der Abfassung seiner Werke mehr oder weniger bewusst vor Augen gehabt haben dürfte. Er schrieb demnach (noch) nicht für jene schichtenübergreifende, weitgehend anonyme Leserschaft, die sich in Deutschland im Laufe des 19. Jahrhunderts herausbildete, sondern für Adressaten, die humanistisch gebildet waren, sich mit größter Selbstverständlichkeit in der Welt der Antike und der klassischen Dichtung bewegten und manche subtilen Anspielungen sofort verstanden, die wir heute oft erst mit Hilfe von Kommentaren oder Nachschlagewerken mühsam rekonstruieren müssen. Mörikes ‚impliziter Leser‘ – jener virtuelle Rezipient, der seinen Werken gleichsam eingeschrieben ist und der sich für ihn in kultivierten und enthusiastischen Freunden wie Hartlaub geradezu verkörpert haben mag – beherrscht daher auch die griechische und die lateinische Sprache: Wenn der Dichter ein Zitat aus der Bibel oder aus der klassischen Literatur als Motto für ein Gedicht wählte, wie er es etwa bei Göttliche Reminiscenz oder An eine Äolsharfe tat, gab er es im Urtext wieder. Die weitgehende Homogenität des anvisierten Publikums bildete zudem die Voraussetzung für jene gesellige Intimität eines vertraulichen Geplauders, die zahlreiche Texte vor allem aus Mörikes späteren Jahren zu schaffen suchen. Übrigens waren literarische Ambitionen unter den Gebildeten, die das Versemachen ja schon in der Schule geübt hatten, eher die Regel als die Ausnahme. Viele von Mörikes Freunden und Bekannten betätigten sich hauptberuflich oder doch zumindest nebenher als Schriftsteller, einige veröffentlichten eigene Gedichtbände.
Boten die Seminare und das Stift den Studenten einerseits eine exzellente Bildung und solide berufliche Chancen, so konfrontierten sie sie andererseits mit einer rigiden disziplinarischen Ordnung. Die Niederen theologischen Seminare nannte man nicht nur deshalb „Klosterschulen“, weil sie in der Reformationszeit in den Gebäuden der aufgehobenen katholischen Männerklöster eingerichtet worden waren; auch die Lebensweise in diesen Internaten hatte etwas Mönchisches an sich. Mörike und seine Mitschüler mussten sich an eine strikte Reglementierung ihres Tagesablaufs und an zahlreiche Vorschriften gewöhnen, die sich sogar auf die Kleidung erstreckten. Wollte man außerhalb der Ferien, der „Vacanzen“, Urlaub bewilligt bekommen, so war ein Schreiben der Eltern vorzulegen, das den Antrag begründete. Zudem wurde jedem Einzelnen stets ein Platz in der Rangliste der Promotion zugewiesen, der seinem derzeitigen Leistungsstand entsprach – Mörikes Name fand sich regelmäßig im untersten Viertel dieser „Location“. Das ganze höhere Bildungssystem beruhte also auf einer Verbindung von Fürsorge oder Förderung und Disziplinierung, und manche sensiblen Naturen müssen diese Zustände als quälend empfunden haben; noch Hermann Hesse, der 1891/92 das Seminar in Maulbronn besuchte, schildert in seiner Erzählung Unterm Rad einen solchen Fall. Die Regel war das zwar sicherlich nicht, und von Mörike sind keine Klagen über die Bedingungen überliefert, unter denen er seine akademische Laufbahn absolvierte. Eines aber verwehrte die Kombination aus Internatsdasein und humanistischem Bildungsstreben den Zöglingen auf jeden Fall, nämlich lebenspraktische Erfahrung. Wer Seminar und Stift durchlief, verbrachte ungefähr die Zeit vom 14. bis zum 22. Lebensjahr unter strenger Aufsicht in einem eigenen Kosmos. Mörike spricht im Investiturlebenslauf von der „abgeschlossenen u. einförmigen Lage“, in der sich die Schüler in Urach befunden hätten (7, S. 333), und im Grunde darf man diese Wendung auch auf die Tübinger Jahre beziehen, wenngleich die Studenten hier schon die Erlaubnis erlangen konnten, eine Stadtwohnung außerhalb des Stifts zu beziehen, wovon Mörike zeitweilig Gebrauch machte. Unter solchen Umständen entwickelte sich bei den ‚Stiftlern‘ ein eigentümlicher kollektiver Habitus, in dem sich tiefe Gelehrsamkeit und große Aufgeschlossenheit für Literatur und Wissenschaft mit einer gewissen Weltfremdheit und einer auffallenden Unbeholfenheit in praktischen Dingen verbanden. Weitgehend rätselhaft blieb den Schülern und Studenten insbesondere das weibliche Geschlecht, das aus der Männerwelt der Seminare und des Stifts verbannt war. Oder genauer gesagt: sie dürften es in erster Linie aus Büchern, aus Dichtungen gekannt haben. Berücksichtigt man dies, werden einige Erlebnisse Mörikes während der Tübinger Zeit, auf die wir später zu sprechen kommen müssen, mitsamt ihren aufwühlenden Folgen verständlicher.