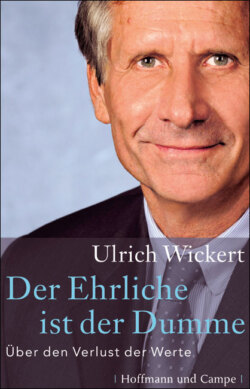Читать книгу Der Ehrliche ist der Dumme - Ulrich Wickert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vernunft ist Utopie
ОглавлениеWeil es inzwischen auch dem einfältigsten Ehrlichen dämmert, daß er der Dumme ist, beginnt er über die Ursache dafür nachzudenken. Und er stellt sich die Frage: »Was habe ich davon, wenn ich ehrlich bin?«
Übertragen in die Begriffswelt der Ethik heißt dies: »Welchen Sinn macht es, wenn ich Gutes will und entsprechend handle?« Was zu der eigentlich völlig überflüssigen Frage führt: »Was für ein Sinn steckt in dem Wort ›gut‹?« Denn was »gut« ist, sollte jeder wissen. Wenn es schon so weit ist, daß solch banale Begriffe in Frage gestellt werden, dann sind die Wurzeln der Gesellschaft angegriffen.
Solange der politische Gegensatz von rechts und links offensichtlich war, hie Kapitalismus, dort Sozialismus, wußte fast jeder, was gut und was böse war, und damit schien alles sehr einfach. Zwei Ideologien, zwei Wertesysteme, standen sich gegenüber. Der ideologische Gegner war immer der Böse, im Umkehrschluß vertrat man selbst das Gute. Spätestens mit der deutschen Einheit fand dieser Gegensatz ein Ende, weil die politischen Systeme der sozialistisch-kommunistisch regierten Hälfte der Welt zu Grabe getragen wurden. Und ohne die Herrschaftssysteme hatte auch die sozialistische Ideologie im staatlichen Bereich keine Existenzberechtigung mehr.
Wenn nun das Denkschema wegfällt, wonach soll man sich dann richten? Was macht Sinn, was ist Unsinn?
Was die daraus resultierende Sinnkrise bewirkt hat, läßt sich leicht in der Außenpolitik darstellen: Ein Konflikt wie der in Jugoslawien konnte unter den »alten« Umständen gar nicht ausbrechen. Wäre er trotzdem entstanden, dann wäre er anders gelöst worden. Der Westen hätte sich herausgehalten, denn die Respektierung der Einflußsphären gehörte zu den ungeschriebenen Abmachungen der Weltpolitik. Der Ostblock hätte das Problem mit eigener Gewalt gelöst – wie in Budapest 1956 oder in Prag 1968, oder auch wie später in Polen, wo der Westen nicht gewagt hätte einzugreifen. Nun stehen sich seit Ende der achtziger Jahre Ost und West nicht mehr als Gut und Böse, nicht mehr als Todfeinde, gegenüber. Rußland wird zwar gerade noch als Weltmacht akzeptiert, und Moskau beansprucht diese Rolle ganz bewußt, aber der Gegensatz beruht nicht mehr auf Ideologien. Ideologien sind nichts anderes als ganzheitliche Wertesysteme. Und weil diese Wertesysteme weggefallen sind, fehlen in vielen Bereichen die Maßstäbe, die den Willen und das Handeln bestimmen.
Aber es sind nicht nur die Maßstäbe weggefallen, sondern auch ein anderes, wesentlich mit der Durchsetzung moralischer Regeln verbundenes Element: die Pflicht. In der kapitalistischen wie auch in der kommunistischen Gesellschaft wurde jeder durch die Ideologie in die Pflicht genommen. Es war Pflicht, nicht gegen die Interessen des eigenen Systems zu verstoßen. So war unethisch, was dem Gegner diente.
Ein Beispiel: Die westliche Gemeinschaft schützte sich durch eine Ausfuhrverbotsliste (Cocom) gegen eine zu schnelle technologische Entwicklung der Sowjetunion. Regelmäßig trafen sich Diplomaten geheim in Paris und gingen die Liste durch, auf der vermerkt war, welche zivilen Güter (Computer etc.) nicht an den Ostblock verkauft werden durften. Nach dem Wegfall des ideologischen Gegensatzes gibt es diese Liste nicht mehr. Jetzt ist gut, was einst böse war. Jetzt macht der Unternehmer nämlich seinen Gewinn und sichert Arbeitsplätze, wenn er nach Moskau, Kiew oder Baku verkauft, was einst verboten war.
Daß die ehemaligen Ostblockländer eine Sinnkrise durchmachen, leuchtet jedem ein, denn ihre Gesellschaften wurden mindestens vierzig Jahre lang von der kommunistischen Ideologie geprägt. Zwar wurde diese Ideologie anders verwirklicht als im Ideal vorgegeben, doch als Ziel hatte man immer noch ein gerechteres Leben für den Menschen vor Augen, und viele – auch Intellektuelle – glaubten daran. Wenngleich die Menschen in diesen Staaten wenig wirtschaftlichen Erfolg und politische Freiheit hatten, Gegner der Regierung gefoltert, ja, in Gulags eingesperrt oder unter Stalin millionenfach umgebracht wurden, so wissen die Menschen nach dem Bankrott dieses Systems nicht, wie sie sich in einer nun kapitalistisch geprägten Welt zurechtfinden sollen. Das fängt mit ganz einfachen Dingen des täglichen Lebens an: Man muß lernen, sich dem Wettbewerb zu stellen, etwa um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu bekommen.
Die Ideologie, mit der der Ostblock sein System begründete, basierte auf dem Versprechen einer besseren Welt. Wer hätte ihn nicht, diesen Wunsch? Deshalb ist er auch nicht neu: Die Philosophen im alten Griechenland, später Jesus und seine Jünger und immer wieder neue Denker in allen Zivilisationen haben sich damit befaßt. Die sozialistische Ideologie, die von einer wirtschaftlichen Interpretation der Gesellschaft ausging, basierte auf dem Gedanken, wenn der Mensch nur der Vernunft folge, könne die gerechte Gesellschaft verwirklicht werden. Sie ist – ebenso wie das Paradies – eine Utopie.
Der Vernunft zu folgen klingt in gleicher Weise klug und verführerisch. Schließlich versuchten auch im Westen Bürger, Intellektuelle und Politiker eine Utopie zu verwirklichen. Dabei spielt die Studentenrevolte von 1968 eine große Rolle, die in Wirklichkeit eine Kulturrevolution war. Eine ganze Generation war von dem Denken beseelt, eine bessere Gesellschaft sei möglich, wenn die Vernunft siege. Aus der Vernunft leiten auch die modernen Philosophen die Definition des Guten her. Im Umgang mit Autoritäten, im politischen, aber auch im gesellschaftlichen Verhalten, in der Erziehung wurde in dem folgenden Jahrzehnt im Sinn eines neuen Wertesystems viel verändert.
Zwei grundlegende Begebenheiten, eine im Westen, die andere im Osten, haben jedoch dazu geführt, diese Bewegung aufzuhalten. Denn in beiden Fällen ist die Vorstellung gescheitert, der Mensch könne das Gute umsetzen, wenn er Vernunft walten ließe.
Zum einen führte der Wegfall des real existierenden Sozialismus zu der Frage: Ist mit dem kommunistischen System auch die Idee des Sozialismus gescheitert? Zum zweiten haben in Deutschland und Frankreich lange Jahre sozialdemokratische Regierungen geherrscht. Viele werden sich noch an die Euphorie erinnern, die bei einem großen Teil der Bevölkerung einsetzte, als Willy Brandt an die Macht kam und nach über zwanzig Jahren eine konservative Regierung ablöste – und noch mehr, als er das Mißtrauensvotum überstand. Eine ähnliche Stimmung herrschte im Mai 1981 in Paris, als François Mitterrand das Amt des Staatspräsidenten antrat – und auch mit ihm nach zwanzig Jahren konservativer Herrschaft in Frankreich ein Sozialist die Macht übernahm. Beide verkörperten den vermeintlichen Aufbruch in eine neue Zeit, das Versprechen einer besseren, gerechteren Zukunft. Sozialdemokraten wie Sozialisten beseitigten zwar viele Mißstände, schufen mehr Freiheiten und größere Gerechtigkeit; doch die Politiker der Parteien, die diese fortschrittlichen Regierungen trugen, gaben sich, statt die Utopie umzusetzen, dem reinen Verwalten der Probleme hin, was zwar mit den Zwängen der Politik entschuldigt wird, aber eher als konservativ gilt.
Die deutsche Sozialdemokratische Partei ist schließlich an sich selbst gescheitert, weil ihrer Mehrheit, die vorgab, eher ethisch als politisch zu denken, Werte – wie Frieden – wichtiger waren als die vom sozialdemokratischen Kanzler Helmut Schmidt vertretene Machtpolitik. Die Parteidelegierten wandten sich gegen das Wettrüsten zwischen Ost und West, eine Gefahr für den Frieden, während »der Macher« Helmut Schmidt sich an alte Regeln der Macht hielt; auch er handelte, um den Frieden zu wahren. Helmut Schmidt hat – ein Jahrzehnt später ist es klar – recht behalten, was diejenigen, die damals den Wert »Frieden« für sich in Anspruch genommen hatten, heute verunsichert.
Während des Golfkriegs engagierten sich noch einmal viele Deutsche für ihre ideellen Werte. Auch hier war ein Gegner klar erkennbar, nämlich der »kriegslüsterne amerikanische Imperialismus«. Kirchen wurden mit weißen Bettüchern behängt, Mahnwachen fanden statt, sogar der rheinische Karneval wurde abgesagt.
Als kurz darauf jedoch der geographisch sehr viel nähere Bürgerkrieg in Jugoslawien beginnt mit seinen unendlichen Greueln, Morden, Vergewaltigungen von Frauen und Kindern, geht der rheinische Karneval weiter. Ein klarer Gegner ist nicht auszumachen; damit fehlt plötzlich auch die Erkenntnis, wer (und was) gut und böse ist. Plötzlich fordert mancher Friedensbewegte, Europa müsse – notfalls mit der NATO – militärisch eingreifen, um diesen Krieg zu beenden. In diesen Widersprüchlichkeiten entpuppt sich der Zwiespalt, in dem unsere Gesellschaft und damit ein in Werten Halt suchender Mensch sich befindet, dessen moralisches Koordinatensystem durcheinandergewirbelt wurde.
In Paris ist die sozialistische Regierung nicht abgewählt worden, weil sie versuchte, eine Utopie zu verwirklichen, nicht weil sie Großunternehmen und Banken verstaatlichte, auch nicht, weil sie schließlich eine realistische Wirtschaftspolitik betrieb, sondern weil sozialistische Politiker sich so in Machtkämpfe und Korruption verstrickten, daß sich die Bürger angewidert abwandten. Damit ist der scheinbar greifbare Traum zerstoben, Ideale könnten mit praktischer Politik umgesetzt werden. Die Glaubwürdigkeit ist verlorengegangen.
Diejenigen, die in Protestparteien – wie bei den deutschen Grünen – einen anderen Weg gehen, erleben auf der einen Seite, daß die Beteiligung an der Macht eine »reale« Einschätzung von Politik erfordert, daß jedoch in der Opposition bleibt, wer auf »fundamentalen« Werten beharrt. Darin liegt der Grund, weshalb diejenigen, die eher fortschrittlich denken, sich die Frage stellen: Gibt es noch eine Linke? Sie suchen ein Wertesystem, das durch die Wirklichkeit nicht so korrumpiert ist wie der Sozialismus, das aber Hoffnung auf eine bessere Zukunft verspricht. Mit Ethik verbanden sie bisher eher einen bürgerlichen Moralbegriff, dessen Werte sich allein auf das Individuelle und Zwischenmenschliche beschränken und nichts wirklich Verbindliches vorgeben, es sei denn, man zöge sich auf christliche oder andere religiöse Traditionen zurück – was Aufgeklärte eher abschreckt. Doch da der Begriff »Ideologie« durch die nahe Vergangenheit negativ besetzt ist, benutzen auch sie plötzlich das in den letzten Jahren eher konservativ gedeutete Wort »Werte«, sprechen von Ethik und Werten, von Moral und Sitte.
Für die Gegner des Sozialismus sah es zunächst so aus, als habe ihre Ideologie, der Kapitalismus, gesiegt, der sich in Deutschland als soziale Marktwirtschaft versucht. Der Glaube an den Sieg der kapitalistischen Ideologie steckt noch in den Worten von Bundeskanzler Helmut Kohl, in den östlichen Bundesländern würden blühende Landschaften entstehen – also dort, wo der Sozialismus gescheitert ist, werde die Marktwirtschaft triumphieren.
In den Vereinigten Staaten begann Ende der achtziger Jahre die größte Rezession der Nachkriegsgeschichte – etwa zu dem Zeitpunkt, an dem der kommunistische Block zusammenbrach. Diese Krise löste den Zweifel am eigenen Wertesystem aus. Die Garantie eines ständigen Fortschritts, der immer mehr Geld und damit eine materiell bessere Zukunft versprach, lief ab. So verlor auch der Kapitalismus in seiner bisherigen Form seine Glaubwürdigkeit. Denn plötzlich war offensichtlich, daß ein ethisches Fundament fehlte.
Krisen hat die Wirtschaft des Westens immer wieder durchgemacht. Die letzte große Veränderung wurde durch die Automatisation mit Robotern und Elektronik ausgelöst, doch meist betrafen Entlassungen nur untere Einkommensschichten. Dieses Mal verlieren ihre Anstellung auch Akademiker und Topmanager, die sich bisher völlig sicher fühlten. Finanziell sicher ist damit gemeint. Das Wort »abspecken« wird salonfähig, so, als handle es sich bei denen, die entlassen werden, um überflüssigen Speck am Körper. Die Maden können gehen!
Wirtschaftsforscher sagen voraus, in Zukunft würden Akademiker in hohem Maße unbeschäftigt bleiben; eine zwanzigprozentige ständige Arbeitslosigkeit wird für die westlichen Industriestaaten prognostiziert. Demzufolge werden etwa dreißig Prozent der Bevölkerung das gesamte Sozialprodukt erwirtschaften. Als die Arbeitslosigkeit – manchmal versteckt als Frührente, Umschulung oder Kurzarbeit etc. – nur diejenigen traf, die ihr ganzes Leben mit jedem Groschen zu rechnen hatten, berührte es diejenigen nicht, die Geld hatten. Jemand, der sich stets am Rande des Existenzminimums bewegt, ist gewohnt, mit nur wenig Geld auszukommen. Aber ohne Geld oder nur mit einem Minimum zu leben, das kannte bisher keiner, der an der Park Avenue für eine halbe Million Dollar eine Wohnung auf Kredit kaufte oder in Long Island ein Wochenendhaus besaß. Jetzt hat es viele erwischt, nicht nur an der Park Avenue oder an der Avenue Foch, sondern auch in Stuttgart, München oder Frankfurt. Das ist der Aspekt »Marktwirtschaft« im Kapitalismus.
Aber auch das damit verbundene Adjektiv »sozial« wird von konservativen wie fortschrittlichen Parteien zum ersten Mal in Frage gestellt: Der von rechts wie links aufgebaute Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar. Also erfanden die Politiker das unverfänglich klingende Wort vom »Sozialabbau«. Wenn es die Unterschicht trifft, dann scheint es natürlich. Wenn aber der Finanzier, Bankier, Manager plötzlich auf der Straße sitzt, sein Appartement wegen der Wirtschaftskrise nur noch die Hälfte wert ist, dann bricht nicht nur er, sondern mit ihm der Glaube an die (materiellen) Werte zusammen. Denn dann trifft es eine Säule des Kapitalismus. Plötzlich stimmt etwas nicht mehr in dem System der Marktwirtschaft. Und alle – von »Wall Street Journal« über »Le Monde« bis zu »Die Zeit« – fallen mit ihm in den Chor ein: »Was jetzt?«
Überall, in den Vereinigten Staaten wie in Europa, vor allem in Frankreich, in Deutschland und neuerdings lautstark in Italien, suchen Intellektuelle und Publizisten die Antwort darauf. Von Ideologien – als umfassenden Wertesystemen – hat die herrschende Meinung Abschied genommen. Die Frage nach dem Sinn beantworteten die Kirchen ehemals ganz einfach, man mußte nur an Gottes Gebote glauben. Glauben wollen die Menschen heute kaum noch. Sie wollen begründet wissen, was die verbindlichen Werte sind, die Wollen und Handeln in einer Gesellschaft bestimmen.
Philosophen haben schon vor einigen Jahren die Frage nach der Ethik wiederentdeckt, die eine Antwort darauf geben soll, was das Gute sei. Und auf der Suche nach einer gemeinschaftlichen Wertorientierung ist gleich wieder Streit entbrannt.
***
Da es modern ist, mit dem Begriff »Werte« zu jonglieren, wird damit viel Schindluder getrieben. Denn jetzt, nach dem Zerfall der ideologischen Systeme, versuchen Vertreter jeder Geistesrichtung, ihre Ansicht als die einzig wahre zu erhöhen; wobei wir behutsam von der Feststellung ausgehen sollten, daß es eine »einzige« Wahrheit nie geben wird. Aber, so fragt sich manch ein Politiker, können wir uns nicht »wertkonservativ« nennen und damit die Werte für uns Konservative in Anspruch nehmen? Wobei insgeheim mit »Wert« allein »Macht« gemeint ist.
Die Macht aber ist überhaupt kein Wert. Und Politiker, die nur die Macht um ihrer selbst willen konservieren wollen, sollten von den Bürgern schleunigst abgewählt werden. Soziologen streiten sich darüber, ob die neue Gesellschaft an Werten orientiert oder multikulturell ausgerichtet sein sollte, wobei sie übersehen, daß darin kein Widerspruch steckt. Nun war es zu den Zeiten, in denen die Religion die Werte vermittelte, sehr viel einfacher, denn ihre Herkunft von Gott war allein schon Begründung und Gebot. Wer aber stiftet heute die Werte? Die Politiker etwa? Sicher nicht!
»Die öffentliche Klage über die Schwindsucht der Werte und der vielstimmige Ruf nach der Stiftung neuer ist von seltsamer Naivität«, klagt Helmut Dubiel.[7] Denn wenn die öffentlichen Mittel knapp würden, dann könne der Staat Kredit aufnehmen. Wenn aber die öffentliche Moral knapp wird, ist das schwierig. Werte lassen sich weder stehlen noch übertragen noch kreditieren. Und Lebenssinn und Gemeinschaftsverpflichtung lassen sich nicht einfach verordnen. »Außerdem«, so Dubiel, »ist die selbstverständliche Annahme verblüffend, früher hätte es an Sinn und verpflichtenden Traditionen keinen Mangel gegeben. War die vor fünfzig Jahren betriebene industrielle Massenvernichtung von Menschen nicht auch die Folge einer Erosion von Werten ganz anderen Ausmaßes?« Allerdings kann man eine Diktatur – und noch dazu eine so brutale wie die der Nazis – nicht mit den westlichen Demokratien vergleichen, die heute unter der Auszehrung konsensstiftender Werte leiden.
Zwar hält in einer modernen Demokratie der Staat mit all seinen Instrumenten die Gesellschaft zusammen, aber er regelt nur die Infrastruktur, sicherlich nicht den kulturellen Ausdruck. Der Staat ist zuständig für den geregelten Ablauf von Verkehr, Justiz, innerer und äußerer Sicherheit etc. Der Staat – und seine Agenten, die Politiker – ist jedoch primär nicht zuständig für den Bereich der »Werte«, die sich im vorstaatlichen Raum bilden. Der Staat hat sie höchstens zu schützen.
Jeder Jurist lernt, daß Gesetze nur nachvollzogene moralische Regeln aus dem vorstaatlichen Raum sind. Und da die Moral sich ständig mit der Gesellschaft ändert, werden Gesetze im nachhinein angepaßt – oder aber abgeschafft.
Noch in den sechziger Jahren war Homosexualität gesellschaftlich und sogar strafrechtlich geächtet, doch mit wachsender Toleranz und zunehmender Aufklärung wuchs der Druck der Homosexuellen und derjenigen, die sich für die Rechte von Minderheiten einsetzten, das gesellschaftliche Tabu zu durchbrechen und die Gesetze zu verändern. Die Homosexualität ist nur ein Beispiel von vielen. Die Abschaffung des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch, der die Homosexualität betraf, aber auch die Veränderung der Strafbarkeit von Abtreibungen in Paragraph 218 Strafgesetzbuch gehen zurück auf einen Wertewandel im vorstaatlichen Bereich. Nach der Veränderung der Vorstellungen und Lebenspraxis wuchs der Druck auf die Politik, nun die gesellschaftliche Veränderung staatlich nachzuvollziehen.
Die Gesetze allein reichen nicht aus, um das Zusammenleben in einer Gesellschaft zu regeln. Dazu bedarf es, wie gesagt, im vorstaatlichen Raum der »Werte«; denn mit seinen Gesetzen regelt der Staat den Umgang der Menschen miteinander weitgehend nur in den Bereichen, wo es um Nutzen oder Schaden geht, also rein materialistisch. Die juristischen Normen sind mit Sanktionen versehene Regeln für das Zusammenleben. Sie messen sich nur an der Zweckmäßigkeit.
Nun könnte man annehmen, daß der Wegfall des Wettkampfes der Ideologien eine Chance zu mehr Freiheit im politischen Leben sei, wo nun jedes Einzelteil, das sich in dem Getümmel des »Multikulturellen« entfaltet hat, friedlich neben allen anderen existieren kann.
Hier stehen sich zwei Theorien gegenüber: Die »Kultur der Kohärenz« will den Zerfall der westlichen Demokratien durch den Wertekonsens aufhalten. Die »Kultur des Konflikts« will keine durch den Wertekonsens ausgelöste Pflicht zur Gemeinsamkeit, vielmehr sollen kulturell unterschiedliche, nebeneinander existierende Gruppen durch Auseinandersetzung zu gemeinsamen Formen kommen.[8] In beiden Theorien liegt ein richtiger Kern. Werte sollen das konfliktfreie Zusammenleben in der Gesellschaft zwar ermöglichen, aber Konflikte sollen dadurch keinesfalls ausgeschaltet werden. Im Gegenteil: Das Austragen der Konflikte auf zivile Art muß ein Teil des Wertesystems sein, sonst erleben wir, daß Probleme, wie in Rostock, Mölln oder Solingen, mit Gewalt ausgefochten werden, ohne aber zu einer Lösung zu führen.
Die demokratische Gesellschaft braucht eine kollektive Identität, die sie in Werten findet, um Konflikte austragen zu können und um das Nebeneinander von Bürgern unterschiedlicher Religion, ethischer Herkunft oder nationaler Traditionen zu ertragen. Alle müssen dann das Wertesystem mittragen.
Werte sind die Grundlage einer Gemeinschaft, die sich durch moralische Regeln zu einer Gesellschaft formiert. Diese Gesellschaft gibt sich einen Staat, dessen Institutionen sie bestimmt und deren Schaltstellen sie durch Wahlen mit Politikern besetzt. Und bei diesen Wahlen bestimmen die Bürger, wie die Politiker beschaffen sein sollen, die sie an der Macht sehen wollen.
***
»Solange sich mehrere Menschen vereint als eine einzige Körperschaft betrachten, haben sie nur einen einzigen Willen, der sich auf die gemeinsame Erhaltung und auf das allgemeine Wohlergehen bezieht. In diesem Zustand sind alle Triebkräfte des Staates gesund und einfach, seine Grundsätze klar und einleuchtend, es gibt keine verwickelten, widersprüchlichen Interessen, das Gemeinwohl ist immer offenbar, und man braucht nur gesunden Menschenverstand, um es wahrzunehmen. Friede, Einheit und Gleichheit sind Feinde politischer Spitzfindigkeiten«, schreibt Jean-Jacques Rousseau in seinem »Gesellschaftsvertrag«.[9]
Damit schildert der französische Staatsphilosoph nichts Geringeres als den paradiesischen Zustand einer Gesellschaft, von dem westliche Industrienationen nur träumen können. Denn dort hat sich das gesellschaftliche Band gelockert; der Staat ist schwach geworden, da er Sonderinteressen nachgibt, statt der Gemeinschaft zu folgen. So ist das Interesse der Bürger erlahmt, es gibt keine auf Gemeinwohl ausgerichtete Einstimmigkeit mehr, und der Gemeinwille ist nicht mehr der Wille aller. Daraus sind Widersprüche und Konflikte entstanden, die immer häufiger mit Gewalt in all ihren Erscheinungsformen gelöst werden. Und die moralische Unsicherheit finden wir in fast allen Bereichen. Gewiß fehlen Werte als Maßstab für das Wollen und Handeln in der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien, besonders aber in der Erziehung.
Wenn die Gewalt so auffällig wird, wie sie von Jugendlichen in Deutschland ausgeht, dann läßt der Staat ihre Ursachen untersuchen. Im Mai 1993 legte das Erfurter Justizministerium eine Studie der juristischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität vor, aus der hervorgeht, daß nicht rechts- oder linksradikale politische Inhalte das Motiv für die Gewalt von Jugendlichen sind, sondern »Langeweile, Frust, Haß und Spaß«, wie Professor Günter Kräupl bei der Vorstellung des Berichts zusammenfaßte. Gewalt üben die Jugendlichen aus, weil in ihrem Leben die Konflikte zunehmen und gleichzeitig soziale Beziehungen brechen. Wird beides über einen längeren Zeitraum nicht bewältigt, dann empfinden sie es als soziale Zurücksetzung und leiden unter dem Verfall ihrer eigenen Identität, heißt es in dieser Studie. Das bedeutet: Ihnen fehlen Wertmaßstäbe, die sie befähigen würden, richtig zu handeln und in der Gesellschaft ihren Platz zu finden.
Nun ist es einfach, das Verhalten dieser jugendlichen Gewalttäter zu verurteilen und zu sagen: Wer Gewalt ausübt, verstößt gegen die Werte, die Grundregeln einer Gesellschaft. So dachte auch der Philosoph Karl Popper, der davon ausging, daß eine »offene Gesellschaft« ohne Gewalt auskomme. Doch selbst dieser große Denker wurde von der »Sinnkrise« eingeholt und mußte umdenken. Jetzt sagt er in einem Appell an Europa, eine moralische Gesellschaft dürfe auf Gewalt nicht verzichten![10] Natürlich meint Popper eine andere Gewalt. Er möchte, daß Gewalt eingesetzt wird, um noch größeres Unrecht zu beenden. Die Welt ist so eng, die Kommunikation so schnell, die Möglichkeiten sind so groß geworden, daß die Gewalt aus anderen Kulturen und Zivilisationen, aus anderen Ländern in die der westlichen Demokratien getragen wird.
In Frankreich lassen iranische Fanatiker Bomben auf Straßen, in Geschäften und in der Untergrundbahn explodieren, wobei Dutzende von Menschen umkommen oder verstümmelt werden; in Deutschland erschießen gedungene Mörder Kurden; in den USA versuchen islamische Fundamentalisten das World Trade Center in die Luft zu blasen. Knapp ein Dutzend Personen wurden bisher ermordet oder verletzt, weil sie als Übersetzer oder Verleger mit Salman Rushdies »Satanischen Versen« zu tun hatten. Der Gewalt des Terrors begegnen die betroffenen Staaten mit Gesetzen, mit Sicherheitskräften und der Justiz, also mit staatlicher Gewalt. Doch die meint Karl Popper nicht: Er meint militärische Gewalt im Fall des Bürgerkriegs in Bosnien.
Und hier zeigt sich plötzlich, wie schwer es den betroffenen westlichen Gesellschaften fällt, eine auf Werten basierende Linie des Handelns zu finden. Aus Hitler habe man lernen müssen, meint Popper; und um ein ähnliches Unheil zu verhindern, gelte es, Gewalt auszuüben. Gewalt in Bosnien fordert in Deutschland inzwischen manch ein Moralist, der die Gewalt im Golfkrieg noch verurteilte, der aber gleichzeitig den Einsatz der Bundeswehr verneint.
Das aus dieser Unsicherheit herrührende »moralistische«, nicht moralische Verhalten kritisiert Alfred Grosser, der den Deutschen gern den Spiegel vorhält.[11] Da fordern, so sagt er, Deutsche lauthals den Frieden, preschen bei der Anerkennung von Kroatien und Slowenien vor, wollen aber – mit der Begründung der eigenen »schrecklichen« Geschichte – keine Mitverantwortung tragen, während die Franzosen über sechstausend Blauhelme in Bosnien stationiert und einige von ihnen sogar ihr Leben gelassen haben. So weicht die Außenpolitik in Deutschland vor einem (nach Popper) »verantwortungsvollen« Handeln zurück. Aber gerade die deutsche »schreckliche« Geschichte, so Popper, verlange entschlossenes Eingreifen, »um dem jahrelangen Massenmord von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern im früheren Jugoslawien endlich ein Ende zu setzen. Die jahrelange Duldung dieser Mord- und Schandtaten hat zu einer wahnwitzigen Zunahme der Verbrechen geführt. Wir müssen eingreifen, und zwar sofort.«
Nicht die Einsicht der betroffenen Außenpolitiker führte schließlich zu einem militärischen Druck gegen die Serben in Bosnien, sondern ein moralischer Aufschrei, der nicht durch eine Erkenntnis ausgelöst wurde, sondern durch Fernsehbilder mit brutalen Szenen: Es war das Entsetzen über die Toten und Verletzten auf dem Markt von Sarajevo, die von einer Granate zerfetzt worden waren. Wer die Granate abschoß, ob Serben oder Bosnier, das ist nie geklärt worden. Aber weil die Bilder für die Zuschauer nicht zu ertragen waren, deshalb handelten die Politiker – aus Angst vor ihren Wählern. Sie handelten nicht aus der Überzeugung, die ihnen ein moralischer Maßstab vorgegeben hätte (siehe dazu auch S. 176ff.).
Das könnte anders sein, doch da »allgemeingültige geistige Maßstäbe für das Handeln fehlen, ist die Anhäufung und Ausübung von Macht willkürlich geworden, nur von Egoismus und Eigennutz motiviert und von einer eigenen inneren Logik gesteuert. Somit wird die vermeintlich fruchtbare Befreiung des Menschen zu einer gefährlichen Unterwerfung unter historische Kräfte«,[12] urteilt Zbigniew Brzezinski, der unter Präsident Jimmy Carter Sicherheitsberater im Weißen Haus war.