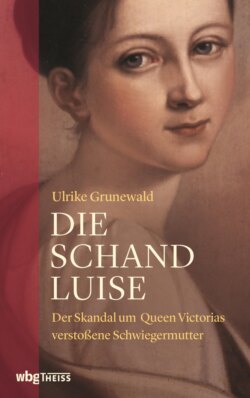Читать книгу Die Schand-Luise - Ulrike Grunewald - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Geschaffen, um geliebt zu werden
Оглавление1824, noch keine vierundzwanzig Jahre alt, hat Luise alles verloren, was das Leben einer Frau des Hochadels im 19. Jahrhundert ausmacht: ihre Kinder, ihre Familie, ihren Status als Fürstin und ihre Heimat. Ehebruch, Mätressenwirtschaft und Scheidungen sind kein unbekanntes Phänomen in adligen Familien, meist sind es die Männer, die ihre erotischen Bedürfnisse außerhalb der ehelichen Gemeinschaft befriedigen. Geheiratet wird aus dynastischen Gründen, geliebt wird anderswo. Aber Luise kann sich nicht damit abfinden, in einer lieblosen Ehe gefangen zu sein. Ihre Erziehung am Fürstenhof von Gotha hat ihr eine wichtige Eigenschaft, die von Frauen des Adels erwartet wird, nicht mitgegeben: ihre Gefühle kontrollieren zu können.
Ist es möglich, Luise nicht zu lieben? Und kann man sie lieben und vergessen? Wie immer, wenn Julie von Zerzog an ihre Freundin in St. Wendel denkt, ist sie in großer Sorge. Welche Entbehrungen muss die Herzogin von Sachsen-Coburg in der Verbannung hinnehmen? Welchen Preis zahlt sie für ihre Unbesonnenheit? Wie sehr hat Julie Luise immer bewundert, diese lebhafte und unbedarfte Prinzessin aus Gotha, die so viel Sinn für Humor hat und die sich gegen jedermann so freundlich und heiter zeigt – vom Glück scheinbar begünstigt durch ihren fürstlichen Stand. Von ihrer ersten Begegnung im Kurort Bad Liebenstein an fühlte sich die Bankierstochter Julie zu Luise hingezogen, sie waren fast noch Kinder damals. Die beiden jungen Mädchen beschlossen, sich nicht mehr aus den Augen zu verlieren. Zunächst war es nur eine höfliche und sporadische Brieffreundschaft, die über Konversation kaum hinausging, doch mit den Jahren waren sie sich nähergekommen. Natürlich hat Julie, die von niederem Adel ist und sich dem höfischen Zwang zu ihrem Glück nicht unterwerfen muss, den Lebensweg ihrer Freundin aufmerksam verfolgt und sich ihre Meinung gebildet, ohne sich darüber zu äußern. Das hätte ihr nicht zugestanden. Insgeheim hatte sich Julie aber schon darüber gewundert, dass Luise so früh verheiratet worden war – sechzehn schien doch noch sehr jung, selbst für ein Mädchen ihres Standes. So hatte es Julie zwar entsetzt, als sie später von den Eheproblemen des Coburger Herzogspaars gehört hatte, doch sehr erstaunt hatte es sie nicht, dass dieses ungleiche Paar nicht miteinander auskam.
Seit die Herzogin im Exil in St. Wendel lebt, ist Julie eine der wenigen Personen, denen sie ihr Herz öffnet. Oft stellt Luise sich die Frage, wieviel Anteil sie am Scheitern der Ehe hat und ob Ernst ihr je vergeben würde. „Ich bin nicht ohne Schuld, ich habe menschlich jugendlich gefehlt“, erklärt sie Julie. Hat sie die Regeln des Hofes so sehr verletzt, hat sie ihre Familie so sehr enttäuscht, dass es nie wieder ein Zurück gibt? Wie schnell ist aller Glanz der fürstlichen Jahre gewichen – Luise ist nun dazu verdammt, ein einsames und bescheidenes, ja fast bürgerliches Leben zu führen. Warum nur musste sie sich mit aller Macht gegen ihren Ehemann und dessen Familie auflehnen? Hatte sie wirklich geglaubt, man wolle sie einsperren? Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihr zu erklären, was mit ihr geschehen sollte, nachdem Herzog Ernst sie des Verrats beschuldigt hatte. Nur eins gaben ihr alle zu verstehen: Sie sollte vom Coburger Hof entfernt werden, so schnell wie möglich. Als Luise dies verstanden hatte und um ihre Freiheit fürchtete, sah sie sich gezwungen, ohne weiteren Widerstand in die Trennung von Ernst einzuwilligen. Nur vorübergehend, wie sie glaubte, bis sich der Zorn des Gatten gelegt haben würde und Gras über die Sache gewachsen wäre. Einen Aufstand der Bevölkerung hatte sie nie beabsichtigt und auch nicht willentlich unterstützt. Was konnte sie dafür, dass die aufgebrachten Bürger von Coburg ihr zugejubelt hatten und nicht dem Landesfürsten?
Julie schenkt den Schilderungen Luises nur zu gern Glauben, denn die Herzogin war ja noch so jung, keine vierundzwanzig Jahre alt, als die Krise am Coburger Hof ihren schrecklichen Höhepunkt erreicht hatte. Wie hätte sie in ihrer Unerfahrenheit die Schlingen entdecken können, die von intriganten Hofschranzen ausgelegt waren, um sie von ihrem Gemahl zu trennen? Es sind dieselben Menschen, die die Herzogin zuerst mit den unerhörten Gerüchten über die Untreue Ernsts verunsichert hatten und die sie nun als „Schand-Luise“ schmähen – und es ist erstaunlich, wie leicht es auch ihren nächsten Vertrauten und Verwandten gefallen ist, sich von ihr abzuwenden – dem Ehemann ebenso wie der Stiefmutter, dem einst so treuen Vormund Baron Lindenau wie der Erzieherin Charlotte von Bock; sie alle haben Luise verdammt. Julie gehört zu den Wenigen, die sich nicht von ihr losgesagt haben, die ihr schreiben und sie gelegentlich in ihrem Exil besuchen, in dem sie nun schon so viele Jahre lebt.
An einem schönen Herbsttag im Jahr 1829 trifft Julie in Niederweiler nahe St. Wendel ein.1 Den Sommer über hat Luise das alte Amtshaus im altertümlichen Stadtkern verlassen, um auf dem Land ein kleines Gartenhaus zu bewohnen. Dort steht sie jetzt am Fenster und winkt Julie zu, deren Besuch eine lang ersehnte Abwechslung bietet. Die Aufregung ist ihr anzumerken – wie freundlich und blühend sie aussieht, ganz so, als habe sie mit sich und der Welt Frieden geschlossen. Julie spürt, wie sehr die Freundin sich verändert hat. Waren früher eine sprühende Fantasie und ein unbedingter Freiheitswille Luises vorherrschende Charakterzüge, zeigen sich jetzt Herzlichkeit und eine ungewohnte innere Ausgeglichenheit. In der zurückgezogenen Stille des beschaulichen Gartenhauses füllt die einst so auf äußerliche Zerstreuung bedachte Herzogin ihre Zeit mit einer umfangreichen Korrespondenz und mit konzentrierter Lektüre. Wie sie dasitzt, in der linken Hand ein aufgeschlagenes Buch, das sie dicht vor ihre Augen führt, die rechte Hand entspannt auf dem Tisch abgelegt, auf dem sich ein ganzer Stapel weiteren Lesematerials aufgetürmt hat, erinnert sie sehr an ihre ungemein gebildete Urgroßmutter Luise Dorothea. Wer je das Schloss Friedenstein besucht hat, kennt das berühmte Gemälde der Gemahlin Friedrichs III. von Sachsen-Gotha-Altenburg, das die lesende Herzogin im lichtblauen Barockgewand darstellt. Ihr Teint so weiß wie Schnee, die prächtigen Locken der hellen Perücke mit einem zierlichen Diadem gebändigt und aus der hohen Stirn gehalten, die Augen fest auf die Lektüre geheftet.
Für die Zeit des 18. Jahrhunderts ist das Porträt einer lesenden Dame ein eher ungewöhnlicher Anblick, und dennoch ist dieses Sinnbild weiblicher Vernunft nirgendwo besser verstanden worden als im kulturbeflissenen Gotha. Schon Herzog Ernst der Fromme hatte hundert Jahre vor Luise Dorothea erkannt, wie viel Macht die Gelehrsamkeit ausüben kann. Nicht mit Waffen wollte er sich behaupten – sein Fürstentum war zum Aufbau einer ernst zu nehmenden Armee ohnehin zu klein –, sondern mit Worten. Sein Motto „Friede Ernehret Unfriede Verzehret“ prangt über dem Hauptportal von Schloss Friedenstein, das die Aufklärer als Hort der Vernunft entdecken – sogar der berühmte französische Philosoph Voltaire kommt 1753 zu Besuch und rühmt überschwänglich Luise Dorotheas Gastfreundschaft. Er nennt sie die „deutsche Minerva“, nach der römischen Göttin der Weisheit, und wähnt sich im Tempel der Grazien und des Geistes, der Wohltätigkeit und des Friedens. Luise Dorothea, die beste Fürstin von allen, müsse als Vorbild gelten für die deutschen Damen des Hochadels, so wünschen es sich ihre Zeitgenossen – und feilen am Mythos der liberalen und gebildeten Vorkämpferin aus Gotha, weil sie sich von den Ideen der Aufklärung einen starken Einfluss auf die Erziehung der künftigen Fürstengeneration versprechen.2 In Luise Dorotheas Sohn Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg scheint die Saat bereits aufzugehen, er fördert Bibliotheken und Theater, aber auch die Wirtschaft und die Naturwissenschaften. Astronomie und Physik sind seine besonderen Leidenschaften, er träumt von einer eigenen Sternwarte für Gotha und gewinnt für diesen kühnen Plan den berühmten Astronomen Franz Xaver von Zach, der nicht eher ruht, bis man vom Observatorium auf dem Seeberg zu den Sternen blicken kann. Der umtriebige Freiherr hat nicht nur Augen für das Sonnensystem, sondern später auch für die verwitwete Herzogin Charlotte Amalie, die Großmutter Luises, deren Haushofmeister er wird und die er auf Reisen nach Marseille und Genua begleitet. Als die Angebetete stirbt, muss Zach zu seinem Entsetzen feststellen, dass sie ihr ganzes Vermögen ihrer Enkelin vermacht hat, eben der „Schand-Luise“, wie auch der Astronom die nach St. Wendel Verbannte zu nennen pflegt.3
Die „Schand-Luise“ hat im Exil eine Vorliebe für Poesie entwickelt, wie Julie von Zerzog zu ihrem Erstaunen feststellt – ihre Lieblingsschriftsteller sind Goethe und Byron. In zwanglosen Unterhaltungen mit der Freundin zeigt sich, wie sehr sich Luises Geist in der Einöde der Verbannung befreit hat, zu welchen Höhen der Erkenntnis sie inzwischen gelangt ist. Gern lässt sich die Herzogin auf dem Gebiet der Literatur auf kleine Dispute ein, glänzt mit rhetorisch geschliffenen Anekdoten. In den Augen ihrer Freundin gleicht sie dem idealen Bild der aufgeklärten Fürstin, die viel Gutes und Schönes am Hof in Coburg hätte erreichen können – Julie glaubt, in Luise das Ideal einer gereiften und gebildeten Weiblichkeit zu erkennen, das sie selbst für erstrebenswert hält: „Sie war geschaffen, um geliebt zu werden, und durch die Treue eines edlen Herzens die höchste Vollendung zu erhalten, und hat es durch ihr Leben bewiesen, was tausende von unserem Geschlechte sagen – Das Weib ist nie edler, nie schöner, als wenn es ganz Weib ist!“, notiert Julie in ihren Aufzeichnungen.4 Später einmal will sie Zeugnis ablegen über ihren Besuch bei Luise, über das Unrecht, das der Freundin im Exil widerfährt und über deren Verwandlung in eine fast bürgerliche Existenz, die sich mit dem zufrieden gibt, was ihr geblieben ist und dennoch für jedermann ein gütiges Wort findet.
Julie erlebt Luise stets freundlich und zugewandt, ganz ohne schauspielerische Verstellung, die man ihr früher oft unterstellt hatte. Besucher finden sich in St. Wendel höchst selten ein, dafür pflegt Luise einen liebevollen Umgang mit ihrer Dienerschaft. Wie sie es sich bei der ersten Begegnung mit ihrer Hofdame Amalie von Uttenhoven ausgemalt hat, ist diese in den ersten beiden Jahren des Exils zu einer verlässlichen Freundin geworden. Nun ist es nicht mehr wichtig, dass Amalie regelmäßig nach Coburg Bericht erstattet, wozu Herzog Ernst sie verpflichtet hat.5 Luise kann sich sicher sein, dass nur Gutes den vertrauten St. Wendeler Kreis verlässt. Schnell hat sie sich eingelebt und mit ihrem einsamen Dasein abgefunden. Die Tage unterscheiden sich kaum voneinander, einer vergeht so still und einfach wie der andere. Jede unnötige Ausgabe muss gestrichen werden, um mit dem wenigen Geld auskommen zu können, das Herzog Ernst für die Haushaltsführung zugestanden hat.
Etikette spielt keine Rolle mehr in Luises neuem Leben, wie Julie von Zerzog überrascht feststellt. Treue und geselliger Umgang sind die Pfeiler, auf die das Leben in St. Wendel gestellt ist. Selten spricht die Verbannte über ihre Vergangenheit, obwohl sie noch immer darunter leidet, keinen Kontakt mehr zu ihren beiden Söhnen Ernst und Albert zu haben. Gelegentlich erfährt sie von ihrer Schwägerin Sophie von Mensdorff Näheres über die Entwicklung der Jungen und ihren Gesundheitszustand – gottlob nur Gutes. Die mütterliche Sorge findet Trost in der Hoffnung, doch noch irgendwann die ersehnten Bilder der beiden Jungen in Händen halten zu können. Oft hat Luise in dieser Sache nach Coburg und nach Gotha geschrieben, ohne ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt zu sehen. Wohlwollende Menschen schicken von Zeit zu Zeit Nachrichten aus Coburg und versichern, ihre Söhne hätten sie nicht vergessen. Wenn es wahr ist, so denkt Julie, dass das weibliche Herz durch Schmerz und Liebe erzogen wird, so hat sich der Charakter Luises vor allem durch Verlust und Entbehrung ausgebildet. Wie sehr Luise ihren Vater August vermisst, der bis zu seinem Tod im Jahr 1822 ihr zuverlässigster Ratgeber war, hat sie der Freundin oft geschrieben. Doch es ist ihre Mutter Louise Charlotte, deren Bildnis Luise mit nach St. Wendel gebracht hat und das sie im Beisein Julies voller Sehnsucht betrachtet. Es erinnert sie daran, dass schon der Beginn ihres Lebens von einem schweren Schicksalsschlag überschattet wurde.
Luises Vater, Erbprinz August von Sachsen-Gotha, hatte auf die Geburt eines männlichen Erben gehofft, doch am 21. Dezember 1800 wird ihm ein Mädchen in den Arm gelegt: Dorothea Luise Pauline Charlotte Friederike Auguste, genannt Luise. Die Enttäuschung der Gothaer Herzogsfamilie schlägt schnell um in überwältigende Trauer, denn nur zwei Wochen nach der Niederkunft verstirbt die Mutter Luises an den Folgen der Entbindung. Alle Bemühungen der herbeizitierten Ärzte, das Leben Louise Charlottes, einer geborenen Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin, doch noch zu retten, sind vergebens.
Kinderporträt von Luise. Ihr Vater August von Sachsen-Gotha widmete sich lieber den schönen Künsten als dem Regieren, er komponierte und schrieb Gedichte. Luises Mutter, eine geborene Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin, starb kurz nach der Geburt ihrer Tochter.
Obwohl sie ohne Mutter aufwächst, scheint es Luise am elterlichen Hof in Gotha an Liebe und Fürsorge nicht zu mangeln. Ihre Großmutter, die regierende Herzogin Charlotte kümmert sich um den Säugling, doch schon bald übernehmen Gouvernanten die Versorgung der Prinzessin. Sie soll nicht die letzte Erbin des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg bleiben, deshalb beginnt, kaum dass Luises Mutter begraben ist, die Suche nach einer passenden Heiratskandidatin für den verwitweten August. Schon im Sommer 1801, es ist gerade etwas mehr als ein halbes Jahr seit dem Tod Louise Charlottes vergangen, scheint sich die zweite Ehe anzubahnen. Achtundzwanzig Jahre alt ist August, als er mit seinem Bruder Friedrich auf Reisen geht und am Hof des Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen-Kassel dessen noch unverheiratete jüngste Tochter trifft. „Erbprinz August, ein sehr wunderlicher und wahrhaft antimilitärischer Mensch, schien sich meiner Tochter Karoline anzuschließen, und es besteht Anlaß zu der Hoffnung, daß sie diese gute Partie abschließen wird“, notiert der Kurfürst in seinem Tagebuch.6 Wilhelm sind die Eigentümlichkeiten Augusts nicht unbekannt, ist er mit den Verhältnissen am Hof in Gotha doch bestens vertraut. Der Erbprinz ist ein exzentrischer Charakter, ein Sonderling, der gern Gedichte verfasst und komponiert. Während der Kurfürst von Hessen-Kassel das Militärhandwerk schätzt und alles daransetzt, seinen Reichtum zu mehren, gibt man sich im liberalen Gotha friedfertig und kulturbeflissen. Unterschiedlicher können die Weltanschauungen in zwei deutschen Fürstenhäusern kaum sein. Und Wilhelm ist sich dessen durchaus bewusst. Das mangelnde Einvernehmen des Erbprinzen von Gotha mit seinem Vater, die Herrschsucht seiner Mutter7, das gelegentlich exaltierte Auftreten Augusts, der sich gern mit Schmuck behängt und in damenhafte Kleider hüllt – eigentlich gäbe es genügend Anlass, eine Vermählung zu überdenken. Doch Wilhelm kennt auch die Schwächen seiner Tochter Karoline Amalie, die ihm schon großen Kummer bereitet hat. Sie ist bereits in einem Alter, in dem mögliche Heiratskandidaten immer rarer werden. Es ist noch nicht lange her, da hat Karoline durch ihr unpassendes Betragen den Prinzen von Homburg vertrieben, der durchaus ernste Absichten hegte. „Die Art, wie sie ihn empfing, befremdete mich zutiefst“, stellt Wilhelm fest. „Es war, als ob sie ihn abschrecken wollte, obschon diese Verbindung sich durchaus geschickt hätte.“8
Karoline hat ihre Gründe für ihr abweisendes Verhalten, sie ist längst in einen anderen Verehrer verliebt, doch dieser ist nicht ebenbürtig und kommt deshalb als Ehemann nicht infrage. Als Wilhelm von der Affäre seiner Tochter mit dem jungen Grafen Taube, einem Kammerjunker in Kassel, erfährt, macht er kurzen Prozess. Karoline wird gerügt, Taube zunächst nach Rinteln versetzt und wenig später auf eigenes Ersuchen entlassen. Wilhelm leidet Qualen, denkt er an die verpasste Chance mit dem Prinzen von Homburg.9 Der Kurfürst ist kein Mann, der sich gern auf der Nase herumtanzen lässt, er ist machtbewusst und durch und durch ein Vertreter des Ancien Régime. Ein Herrscher von Gottes Gnaden, absolutistisch in der Politik, freizügig in seiner Mätressenwirtschaft und effizient in Geldangelegenheiten. Er erlangt ein Vermögen, indem er hessische Soldaten an fremde Heere verleiht und die Profite mithilfe des Frankfurter Bankiers Mayer Amschel Rothschild vermehrt. Wilhelm gilt als reichster Fürst seiner Zeit und ist bei den Zeitgenossen umstritten. Ein kleindeutscher Duodez-Fürst, der das Blut seines Volkes verkauft, sagen die einen, während die anderen ihn wie einen Vater verehren.10 Die Schatzkammern Wilhelms sind gut gefüllt, doch dadurch wird seine jüngste Tochter für die wenigen noch in Frage kommenden Heiratsanwärter nicht attraktiver. Nicht nur die Affäre mit dem Kammerjunker Taube schadet Karoline, sondern auch ihre auffällige Korpulenz, die sie mit übertriebenem Diamantschmuck noch hervorhebt. Als August von Sachsen-Gotha zwecks Brautwerbung mit seinem Bruder am Hof von Hessen-Kassel erscheint, ist die wohl letzte Gelegenheit zu einer attraktiven Verbindung gekommen. Wilhelm zögert nicht länger: „Am 17. Januar [1802] traf die Bitte des Herzogs von Sachsen-Gotha um die Hand meiner Tochter für den Erbprinzen ein, und die Antwort fiel natürlich sehr günstig aus, denn ich konnte mir kaum schmeicheln, sie im Alter von einunddreißig Jahren besser untergebracht zu sehen. Am 20. kamen die beiden Prinzen von Gotha an, einige Tage darauf fand das öffentliche Verlöbnis statt.“11 Am 24. April 1802 wird das Paar vermählt. Die kleine Prinzessin Luise von Sachsen-Gotha hat fortan eine Stiefmutter.
Karoline Amalie scheint sich ergeben in ihr Schicksal zu fügen. Beflissen schreibt sie aus Gotha, ihrem neuen Zuhause, höfliche Briefe an ihren Vater, in denen sie immer wieder auf die Stieftochter zu sprechen kommt. Mit ihren fast zwei Jahren sei Luise ein artiges Kind und bei sehr guter Gesundheit. Allerdings werde sie von den Hofbediensteten geradezu eingesperrt, sie dürfe ihr Zimmer nicht einmal verlassen, um etwas frische Luft zu atmen. Das liebe Mädchen ist eine Gefangene, berichtet Karoline an den Kurfürsten von Hessen-Kassel. Wie gern würde sie den Großpapa mit der angeheirateten Enkelin bekannt machen, damit auch er sehen könne, wie charmant und wohlerzogen sie ist.12 Karoline scheint sich sehr um Luises Gesundheit zu sorgen, geradezu mütterlich wirken ihre Schilderungen. Worüber sie nicht berichten kann, ist eine eigene Schwangerschaft. Niemand wünsche sich sehnlicher einen kleinen Bruder für die Prinzessin als sie selbst, klagt Karoline.13 Es klingt wie eine Entschuldigung, die schon im nächsten Satz von der lebhaften Schilderung eines Marionettentheaters übertönt wird, als seien es die theatralischen Darbietungen bei Hofe, die sie von der Erfüllung ihrer Pflichten als Gattin des künftigen Herzogs abhielten. Karoline tröstet sich mit langen Spaziergängen im englischen Park von Schloss Friedenstein, das seit seiner Fertigstellung im Jahr 1654 auf einem Hügel über Gotha thront.
Der Schlossgarten ist nach den strengen Regeln des Barock angelegt, die Fassade des Prachtbaus schmucklos und dennoch imposant – die Untertanen sollen die ordnende Hand des Fürsten vor Augen haben, wenn sie vom Marktplatz aus zu seiner Residenz emporschauen. Doch im Inneren entfaltet sich die üppige Pracht barocken Dekors, wie eine Bühne für das höfische Theater, dessen Hauptdarsteller der exaltierte Erbprinz August ist.
Vielleicht, so denkt Julie von Zerzog, hätte Luise manch späteres Leid erspart bleiben können, wäre ihre Erziehung strengeren Regeln gefolgt. Zu unentschlossen ist die Stiefmutter, zu nachsichtig der Vater, zu lebhaft die Fantasie der kleinen Prinzessin, die sich keine Schranken auferlegen muss. August liebt seine Tochter, die er zärtlich Viva nennt, über alles. Er verfasst Gedichte, mit denen er sie in den Schlaf wiegt: „Süsses Prinzesschen schlaf ein, lächelnd beym zitternden Schein des scheidenden Abendlichts. Fürchtend und hoffend noch nichts, gewiegt vom geistigen Kuß, träumend vom Himmelsgenuß, schlafe, du liebliches ein, lange noch schuldlos und rein.“14
Gotha von der Nordseite mit Schloss Friedenstein. Von außen wirkte die Residenz des Herzogs von Sachsen-Gotha eher schmucklos.
Als sie älter ist, findet Luise Geschmack an der Zauberwelt des Vaters, der dichtend und fluchend vor den Regierungsgeschäften flieht und den Staat seinen Ministern überlässt. Oft verkürzt sie ihm mit ihrem angeborenen Witz die Erholungsstunden, er erhebt sie zu einer kleinen Gottheit und teilt mit ihr seine Verachtung für jene, die angesichts seines beißenden Spottes eingeschüchtert sind. Täglich hört die kleine Luise ihren Vater gegen die Zustände und Sitten wettern, erlebt, wie er die von ihm so verachteten Kleingeister, die ihn umgeben, beleidigt und mit allen ins Gericht geht, die seinem überschäumenden Geist nicht folgen können. Seine Welt ist die der Schriftsteller und Philosophen, er wechselt Briefe mit Jean Paul, der Dichter nennt ihn den witzigsten aller Fürsten. August verehrt Napoleon, der Europa mit Krieg überzieht, das Herzogtum Gotha aber ungeschoren lässt und seinen Bewunderer als größtes Original seiner Zeit beschreibt.
Zwei Generationen nach der „Deutschen Minerva“ Luise Charlotte scheint der aufklärerische Geist am Hof von Gotha den Verstand verloren zu haben. Augusts Allüren verschlimmern sich mit den Jahren und versetzen so manchen unbefangenen Besucher in Erstaunen. 1811 stellt die berühmte Malerin Louise Seidler im Schloss Friedenstein ihre Staffelei auf, sie hat den Auftrag, das Fürstenpaar nebst Luischen zu malen.15 Als ihr der Herzog August entgegenkommt, jetzt in seinem vierzigsten Lebensjahr, fällt ihr zunächst seine damenhafte Erscheinung auf. Die Hände und Füße sind wohlgeformt und sorgfältig gepflegt. Auch der Kopf wäre schön, stellt die Seidler wenig untertänig fest, würde ihn nicht ein schielendes Auge verunstalten. Als wolle er von diesem Mangel ablenken, wirft sich August, inzwischen der regierende Herzog, in die bizarrsten Kostüme. Um den Hals einen türkischen Schal gewunden, auf dem Kopf ein fantastischer Turban mit edlen Spitzen garniert, an allen Fingern – die Daumen eingerechnet – kostbare Ringe, dazu Armreifen und Spangen, eben alles, womit sich sonst die Damen der Gesellschaft schmücken. Louise Seidler lernt die Marotten des Herzogs bald nur zu gut kennen, ohne sich daran gewöhnen zu können. Sie leidet mit dem herzoglichen Bibliothekar, dessen vornehmste Aufgabe und deshalb größter Kummer es ist, sehr oft mit Pariser Friseuren wegen der blonden Perücke seiner Durchlaucht korrespondieren zu müssen. Die Unzulänglichkeiten der fürstlichen Existenz fesseln den Landesherrn zuweilen ans Bett, das er im Zustand eingebildeter Krankheit wochenlang nicht verlässt. Dort hält er dann Audienzen ab und empfängt in dieser intimen Umgebung sogar Damen, die ihm ihre Genesungswünsche überbringen wollen. So widerfährt es eines Tages auch der Malerin Seidler, die sich schon bald über nichts mehr wundert. Wenn da nur nicht dieser aufdringliche Geruch wäre, fast könnte man es Gestank nennen, der von einer besonderen Marotte des Herzogs herrührt: „Parfüms aus Paris verbrauchte er in Mengen; ein besonderes Vergnügen fand er daran, Eintretenden ganze Gläser davon entgegenzuschütten.“16 Die übertriebene Eitelkeit Augusts ist das beste Geschäft der Kunstmaler, ganze Heerscharen lässt der Fürst im Schloss aufmarschieren, um ihn auf Leinwand zu bannen. Er bestimmt, in welchem Gewand er dargestellt wird, was sich bei der Üppigkeit der verwendeten Stoffe als ernsthafte Herausforderung darstellt. Louise Seidlers Kunstfertigkeit wird durch einen violetten Gehrock aus Samt und eine Weste aus Goldstoff auf die Probe gestellt. Als sie um ein kleines Muster bittet, um der wahren Textur mit Pinsel und Farbe möglichst nahe zu kommen, lässt August eine ganze Stoffbahn bringen. „Was macht euer Kunstpapst?“, ruft er der Malerin eines Tages entgegen und meint damit den Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Dieser wiederum bemerkt bei einer Begegnung mit dem Herzog von Gotha, wie problematisch dessen Selbstdarstellung sei – eine weibliche Form, die gleichsam angenehm und widerwärtig erscheine.
Es mangelt am nötigen Ernst in Gotha, dafür feiern Esprit und Witz ein ausgelassenes Fest. Was August im Übermaß besitzt, fehlt seiner zweiten Gattin Karoline Amalie gänzlich: „Eine gute wohlwollende, aber nicht eben hervorragende Dame, liebte sie ihren etwa anderthalb Jahr jüngeren Gemahl schwärmerisch, dessen Geist sie anstaunte“17, urteilt die Seidler über Luises Stiefmutter. Die Erziehung der kleinen Prinzessin erledigen inzwischen die strengen Hofdamen Karolines, in der Hoffnung, vielleicht doch noch auszugleichen, was in den frühen Jahren versäumt wurde.
Luise ist zu einem lebhaften Wesen herangewachsen, klein, blühend und munter, wie die Malerin Louise Seidler beobachtet. „Leider stand sie unter dem schädlichen Einflusse einer französischen Gouvernante, welche auf das Wohl des ihr anvertrauten Kindes so wenig bedacht war, daß sie dessen Augenmerk sogar eines Tages in meiner Gegenwart auf die Schönheit und das Benehmen der Offiziere während der Wachtparade unter den Fenstern des Schlosses lenkte und der Prinzessin allerlei Bemerkungen darüber zuflüsterte. Auch die sarkastische Art des Herzogs hatte sicherlich keine gute Wirkung auf das junge, leicht empfängliche Gemüt; einmal hörte ich selber bei einem Souper im engeren Kreise des Hofes, was für unpassende Neckereien der Vater sich gegen seine Tochter erlaubte.“18
August, der eine goldverzierte Tasse mit übergroßen Phallussymbolen zu seinen liebsten Schätzen zählt, rät seiner Tochter: „Jede Blume hat ihren Stiel, und oft um das Gefäß zu halten – besser zu fassen – fasst man das gute Blümchen bei seinem Stängel.“19 Das anzügliche und überspannte Verhalten des Herzogs prägt die junge Luise sicher ebenso wie die überbordende Ausgestaltung der Wohnräume im Schloss. Wenn sie durch den dunkelblauen Salon ihres Vaters schreitet, kann sie seidene Tapeten bewundern, die mit Blumen und Früchten, mit Schmetterlingen und Vögeln bemalt sind. Die Decke ziert die Darstellung einer schwebenden Eule mit glühenden Augen. Sicher bemerkt sie auch das lebensgroße Gemälde, das August in mittelalterlicher Tracht darstellt, ein Gänseblümchen als Unterpfand der Liebe pflückend. Im Wohnzimmer hängt links vom Eingang ein schönes Ölgemälde, Napoleon im Krönungsornat darstellend. Weiter geht es zu zwei Sofas, die mit Staub und Schmutz bedeckt sind, da sich Augusts Tiere darauf tummeln dürfen. Im Mittelpunkt des Zimmers steht ein großer runder Tisch, auf dem eine Menge Merkwürdigkeiten bunt durcheinanderliegen: orientalische Dolche, ägyptische Altertümer aller Art, obenauf eine wohl erhaltene und schön geformte Hand einer Mumie. In zwei Glaskästen springen lustig Mäuse hin und her. Luise mag das alles ganz selbstverständlich erscheinen, während unvoreingenommene Besucher angesichts des Sammelsuriums Disharmonie und Verwirrung empfinden, die sie einer seltsamen Willkür und den launenhaften Einfällen ihres Herzogs zuschreiben.20
Trotz Augusts Schrullen und dank seiner fähigen Minister blüht die Residenzstadt Gotha auf, die Hofhaltung ist prachtvoll und die Bürger lieben ihren Fürsten, wie er ist. Neue Straßen werden gebaut, Schulen und Gymnasien unterstützt, eine berittene Gendarmerie sorgt für die Sicherheit der Bürger, die sich nach Herzenslust auf den eigens angelegten Spazierwegen und im Park des Schlosses frei bewegen dürfen.
Luise übernimmt auch so manche gute Eigenschaft des Vaters. Ihr Schreibstil ist flüssig und geschliffen, ihre Fantasie blühend und ihr Freiheitswille ungebrochen. Wie August beweist auch die Tochter in der Freundschaft große Ausdauer, so stellt Julie von Zerzog fest, ohne dabei die weniger guten Seiten dieser liberalen Erziehung zu übersehen: „Luise erlangte durch die Liebe ihres Vaters auch die Gewohnheit, in vielen Dingen ihren Willen durchzusetzen und eine gewisse Unabhängigkeit, welche nicht für jede Erfahrung des weiblichen Lebens paßt. Ihr lebhaftes reitzbares Wesen und ihre Beschäftigung mit phantastisch-poetischen Lettern hinterließ bey ihr etwas deklamatorisches, welches veranlaßte, daß man ihr in einzelnen Fällen Verstellungsgabe Schuld gab. […] Luise war wie alle Phantasiemenschen am wenigsten fähig, Verstellung auszuüben. Mit jugendlicher Leichtigkeit gab sie offen die auf sie gemachten Eindrücke wieder, und wenn sie täuschte, so täuschte sie nur sich selbst.“21
Luise habe einen Hang zu Heimlichkeiten und lasse sich von romantischen Vorstellungen leiten, sie sei eitel und gefallsüchtig, heißt es am Hof.22 Doch August verehrt seine Viva wie eine kleine Gottheit, die wie er das höfische Zeremoniell nicht allzu ernst nimmt. Sie betrachtet es wie ein großes Theater, mit dem Hofmarschall als Regisseur, der den Schauspielern auf der herzoglichen Bühne alle Freude und alle Glückseligkeit austreibt.23 Luise flüchtet sich in eine Traumwelt, beflügelt von der Lektüre romantischer Literatur. Sie verschlingt die Märchen und Sagen ihrer thüringischen Heimat, in denen tapfere Ritter edle Damen retten und ihre Herzen erobern. Ewige Liebe und Treue wird für Luise zum Ideal. Die Geheimnisse ihrer Mädchenjahre teilt sie mit einer einzigen Freundin, Auguste von Studnitz, der Tochter des protestantischen Klerikers August von Studnitz. Anders als die temperamentvolle Luise, ist Auguste scheu und zurückhaltend und sehr verschwiegen, was sie zu einer hervorragenden Komplizin macht. Die Mädchen lieben einander wie Schwestern, sehr zum Leidwesen des strengen Oberkonsistorialrats Studnitz, der seine Tochter vor dem höfischen Schauspiel bewahren möchte und ihr des Öfteren den Umgang mit Luise verbietet.
Am 26. August 1815 wird die Prinzessin von Gotha in der Kapelle von Schloss Friedenstein konfirmiert. Von diesem Zeitpunkt an ist sie im heiratsfähigen Alter und eine durchaus attraktive Partie, da ihr künftiger Gatte einmal Anspruch auf das Territorium des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg erheben kann, wenn der letzte Herzog stirbt. Außerdem ist sie Erbin eines ansehnlichen Vermögens und nicht unattraktiv. „Lieblich an Körper und Seele, witzig und doch voll freundlicher Gutmüthigkeit, […] und zugleich einzige Erbin eines ungeheuern Allodialvermögens, wie konnte Herzogin Luise lange unvermählt bleiben?“, stellt Julie von Zerzog fest.24 Ein möglicher Heiratskandidat lässt nicht lange auf sich warten. Als die russische Zarin Elisabeth noch im Jahr der Konfirmation Luises Gotha besucht und August zu ihren Ehren einen höfischen Empfang zelebriert, erscheint zu diesem Anlass ein wettinischer Verwandter auf Schloss Friedenstein: Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Doppelt so alt wie die fünfzehnjährige Luise, ein hochgewachsener stolzer Offizier in einer mit Orden reich geschmückten Galauniform – der Fürst macht auf die romantische Prinzessin einen tiefen Eindruck. Schon bald wird von Verlobung gesprochen.
Charlotte von Bock, Hofdame Karoline Amalies und eine der Erzieherinnen Luises, denkt schon 1816 mit schlimmen Vorahnungen an eine Heirat der Prinzessin: „Sie ist biß jetzt noch beynahe ohne alles Fürstliche, ganz einfach. Ihre Geburt und ihr Stand erschienen ihr lange als hindernde Schranken, die ihrer Natur widerstrebten. Sie hat viel Sinn für das Glück des Herzens, allein auch eine gewisse éxaltion [Schwärmerei] die ihr schädlich werden könnte.“25 Der Würde eines Mannes wie Ernst könne nur mit Zartheit begegnet werden, glaubt Charlotte, allzu viel Schwärmerei könne sich als Klippe erweisen. „Das weibliche Leben umfaßt zwey Perioden. Die erste ist die der Kindheit und diese zweyte Periode ist die der Mädchenhaftigkeit, und beginnt mit der holden Weiblichkeit, in der die Regungen der Sehnsucht auf den Körper mit sanfter Schüchternheit über geht. Für beyde Perioden ist eine eigene Erziehung – warum war mir nicht vergönnt in der ersten mitzuwürken!“26, schreibt die Bock an ihre Vertraute Amalie von Uttenhoven, die später in St. Wendel über die „Schand-Luise“ wachen wird und schon früh bestens informiert ist über alles, was in der Entwicklung der Prinzessin schief geht. Luise ist in Charlottes Augen zu emotional und überschwänglich, mit einer gelegentlichen Neigung zur Frivolität: „Ein jugendliches Leben mit unendlichen Regungen, Wünschen und innern Aufforderungen, das in den bunten Tanz der Welt greifen möchte. Hier beginnt die Bildung, die für das Weib nur eine Regel hat – von ihrem innern Reichtum wenig in die Welt zu geben, und dadurch diese sich schön, und sich selbst in Frieden zu erhalten. Denn je mehr ein Weib Gefühle in die Welt sprudelt desto ärmer wird ihr inneres Leben – nicht immer kehren die Gefühle glücklich zurück, und dann ist die Ruhe gestört und mit ihr das ganze Sein.“27
Die Bock ist überzeugt, Luise fehle es an der nötigen Reife, um einem Mann ihres Standes angemessen begegnen zu können. Romantisch und naiv sei die Prinzessin, verdorben durch die Flausen ihres übertrieben gefühlvollen Vaters und seine anzüglichen Redensarten. „Dieses Wesen Luise – diese holde liebliche Blume – ein seltenes Gemisch geistigen Ernstes und kindischer Unbesonnenheit – man möge sagen eine zu früh gereifte Pflanze – so viel Einsicht – so viel liebenswürdige Frivolität. Wird man dieß alles zu würdigen, zu benutzen wissen zu ihrem Wohl? Wird sie den Mann, der nun ihr Glück begründen, auf ein ganzes Menschenleben begründen soll, auch auf das ganze Menschenleben fesseln? Luise bedarf viel Liebe, ihr Herz muß festgehalten, stets beschäftigt bleiben. Eine vorübergehende Neigung – nur der Gedanke eines Vorzugs einer anderen, auch nur momentan, würde das bestimmteste Unglück in die Ehe bringen. Ach! Und wie selten sind heut zu Tage die Männer, die der Gefährtin die Treue bewahren?“28
Nicht nur die Erzieherin, auch Karoline Amalie hat Bedenken. Luise sei noch zu jung für eine Eheschließung, lässt sie den zukünftigen Bräutigam wissen. Die Stiefmutter will Zeit gewinnen, bittet Ernst, noch zwei weitere Jahre mit einer Vermählung zu warten. „Luise ist wie Sie selbst werden bemerkt haben in manchem Betracht noch ein Kind, unerfahren und flüchtig. Doch hoffe ich, wenn sie lange genug noch unter unserer Obhut und unter den wachenden Augen ihrer Lehrer bleibt, daß sie Ihre Hoffnungen und Erwartungen erfüllen wird“29, schreibt Karoline an Ernst. Eine Verlobung könne ja stattfinden, da sich alle über die Vorzüge der Verbindung einig seien. Auch Luise habe zugestimmt, da sie glaube, mit ihm ihr Glück zu finden. Damit könne der Herzog wohl zufrieden sein, denn schon mit der Ankündigung einer Heirat werde ein positives Zeichen gesetzt, zur Beruhigung der Coburger Familie und der Untertanen. Doch Ernst lässt sich auf seinem Weg zum Traualtar nicht mehr aufhalten und besteht darauf, einen baldigen Termin zur Eheschließung festzusetzen. Im Dezember 1816 gibt Karoline ihre Stieftochter frei und bittet um einen Besuch des Bräutigams noch im selben Monat, anlässlich des sechzehnten Geburtstags seiner zukünftigen Frau: „Wir werden uns herzlich freuen, Ihnen dann Luise als Ihre Braut vorzustellen und mit dem größten Zutrauen, Ihnen lieber theurer Herzog, das künftige Glück unseres einzigen Kindes anvertrauen.“30
Auch wenn die Frauen die Aufgabe der Heiratsvermittlung übernehmen, so ist das Heiratsgeschäft in den deutschen Adelshäusern des 19. Jahrhunderts Männersache. Die souveränen Fürsten betrachten sich ohne Ansehen von Landesgröße, Finanzkraft und militärischer Kapazität als ebenbürtig. Die „Vettern“, wie sie sich untereinander anreden, bestimmen die finanziellen und vertraglichen Bedingungen, unter denen die Töchter an die Höfe der Söhne verheiratet werden. Da hilft einer dem anderen auch mal aus einer misslichen Lage. Im Fall von August und Karoline Amalie wäscht eine Hand die andere: Kurfürst Wilhelm ist die schwer vermittelbare Tochter los und der Sonderling aus Gotha, der später gesteht, er fühle sich weder als Mann noch als Frau, und der unbedingt einen männlichen Erben braucht, bekommt seine zweite Chance. Von Karoline wird nur erwartet, Kinder zu bekommen und sich widerspruchslos in die Verhältnisse am Hof ihres Gatten einzupassen. Letzteres gelingt ihr, aber den Beitrag zum Fortbestand des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg kann sie nicht leisten: Die Wiege auf Schloss Friedenstein bleibt leer und Luise ist damit das letzte Glied in der Ahnenreihe – ihr bleibt nur der Weg in eine ebenbürtige Heirat.
Das Adelsgeschlecht der Wettiner, zu dem sowohl Luises als auch Ernsts Familie gehören, betreibt bereits seit Jahrhunderten eine umsichtige Heiratspolitik. Meist sind es strategische Bündnisse, die im unmittelbaren geopolitischen Umfeld geschlossen werden. Es geht um Gebiets- und Machtgewinn, um Bereicherung und die Sicherung des Fortbestands der Dynastien durch Nachkommen. Liebe spielt meist keine Rolle. Den Frieden zu wahren, dagegen schon, weshalb sich eine Einheirat in die Nachbarschaft sehr empfiehlt. Coburg und Gotha sind durch den Thüringer Wald getrennt, aber beide Familien haben im 19. Jahrhundert schon längst eine gemeinsame Vorliebe entwickelt, die sich nicht in das übliche wettinische Muster fügt: Sie suchen die passenden Partner nicht mehr nur wie es seit dem Mittelalter üblich war im reichsfürstlichen Umfeld, sondern streben an ausländische Höfe. Vor allem das kulturbeflissene Herzogtum Gotha, das sich schon früh europäischen Einflüssen geöffnet hat, versucht, aus der Enge des Alten Reichs herauszutreten. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts entdecken die Herzogtümer Gotha und Coburg die vielen Vorteile, die eine familiäre Bindung an ausländische Fürstenhöfe mit sich bringt. Man orientiert sich früh nach Russland und Großbritannien, entsendet die Prinzen als Offiziere in fremde Heere und die Prinzessinnen als Ehepartnerinnen an fremde Höfe. Im Gegenzug erwerben sich die minder mächtigen Adelshäuser einen unbezahlbaren Vorteil: Sie erfahren wichtige Neuigkeiten, noch bevor diese den Weg in die Presse finden. Unter den Familienmitgliedern werden eifrig Briefe ausgetauscht, die nicht nur den jüngsten Klatsch enthalten, sondern auch Hinweise auf politische und wirtschaftliche Entwicklungen. Es entsteht eine dynastische Nachrichtenbörse, die es ermöglicht, auch den großen, mächtigen Fürstenfamilien zuvorzukommen, wenn es um die Besetzung wichtiger Positionen geht.
Mit der Eheschließung von Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld und Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg beginnt eine strategische Ausrichtung, die die beiden machtpolitisch eher unbedeutenden Herzogtümer in den Mittelpunkt der Weltpolitik rücken und ihnen damit in jenem Moment das Überleben sichern wird, in dem der Zerfall souveräner Fürstenherrlichkeit beginnt. Die Geschichte des Adels um 1800, dem Geburtsjahr Luises, ist vom Wandel bestimmt. Für die seit dem Mittelalter an Privilegien und Sonderrechte gewöhnte höchste Gesellschaftsschicht beginnt ein Kampf ums Obenbleiben, der für sie einer Katastrophe gleicht, weil er die Rangordnung verändern wird.31 Der Angriff auf die Aristokratie hatte bereits im 18. Jahrhundert begonnen und vor allem aus dem nachrevolutionären Frankreich verbreitete sich die Erkenntnis, dass die alte Ordnung nicht gottgegeben war. Im aufgeklärten Bürgertum, das sein Haupt erhebt, wächst die Einsicht, dass nicht die Erbsünde der Grund für Leid und Elend ist, sondern Fehler und Versagen von Regierungen. Eine von der Vernunft geleitete Reform der Gesellschaft erscheint nun möglich, wozu es notwendig ist, traditionelle Werte und Ordnungen infrage zu stellen. Der Stolz des Adligen auf seine hohe Geburt und die vorrangige Loyalität gegenüber seiner Familie erscheinen dem Rest der Gesellschaft zunehmend wertlos, wogegen sich bürgerliche Tugenden wie Güte, Vernunft und Fleiß durchzusetzen beginnen.32
In Coburg und in Gotha stemmt sich die alte Ordnung gegen den neuen Geist mit der Entwicklung einer Heiratspolitik, die immer überlegter von strategischen paneuropäischen Zielen geleitet wird. Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg gerät durch ihre Eheschließung mit dem Coburger Herzog ins Zentrum eines machtpolitischen Wirbelsturms, den sie nicht kommen sieht und auf den sie denkbar schlecht vorbereitet ist. Als verwöhntes Einzelkind mit einer Sonderrolle an der Seite ihres unkonventionellen Vaters mangelt es ihr an der erforderlichen „Affektkontrolle“, einem durch Erziehung herausgebildeten Wesenszug, der Selbstbeherrschung voraussetzt und es möglich macht, die eigenen Gefühle und Wünsche den Erfordernissen dynastischen Denkens unterzuordnen. Wie viele Fürstenfamilien blickt auch das Herzogshaus von Gotha auf eine mehr als tausend Jahre zurückreichende ununterbrochene genealogische Linie zurück. Luise ist in dieser Kette nur ein weiteres Glied, allerdings mit einer Besonderheit, die ihrer Geschichte eine spezielle Dynamik verleiht: Sie ist die letzte Erbin dieses Nebenzweigs der Wettiner und deshalb eine begehrte Partie. Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld erkennt dieses für ihn so vielversprechende Potenzial. Seine Braut ist nicht nur reich, sondern auch jung und scheint einen noch formbaren Charakter zu besitzen. Sie könne nicht anders, als sich seinen Wünschen ohne große Gegenwehr zu fügen, davon ist er überzeugt. Ihre Unerfahrenheit würde sie davon abhalten, ihn in seinem gewohnten Lebensstil zu stören. Die Heirat ist für ihn eine rein dynastische Entscheidung, die mit einem Familienleben im bürgerlichen Sinn nichts zu tun hat. Sie folgt den Regeln des Alten Reichs, denn „es kommt faktisch bei der Eheschließung in diesem Kreise in erster Linie auf ein dem Rang des Mannes entsprechendes, möglichst sein Prestige und seine Beziehungen vergrößerndes ‚Aufmachen‘ und ‚Fortführen‘ seines ‚Hauses‘ an, auf den Rang- und Ansehensgewinn oder mindestens auf die Rang- und Ansehensbehauptung der Eheschließenden als der gegenwärtigen Repräsentanten dieses Hauses“.33
Ernst unterschätzt, welche Gefahr Luises romantischer, schwärmerischer und freiheitsliebender Charakter für ihn birgt. Er hat es eilig, denn sein übler Leumund hat bereits einige Heiratsprojekte scheitern lassen. Diesmal will er Erfolg haben und lehnt deshalb die Bitte Karolines ab, weitere zwei Jahre mit der Eheschließung zu warten, um doch noch an Luises Erziehung feilen zu können. Die grenzenlose Naivität Augusts, Karoline Amalies und Luises spielt dem Coburger in die Hände. Bei diesem übereilten Heiratsgeschäft wäscht wieder einmal eine Hand die andere: Der Gothaer Herzog und seine Frau werden den Druck der Zeugung männlichen Nachwuchses los, da ja nun der „Vetter“ Ernst für die Fortführung der gemeinsamen Familiengeschichte Sorge trägt. Dieser wiederum hofft, mit der Eheschließung endlich alle unrühmlichen Gerüchte um seinen Lebenswandel zu beenden, was seine künftigen Schwiegereltern offenbar nicht durchschauen. Andere Zeitgenossen, wie der Rodacher Pfarrer Johann Christian Hohnbaum, sehen klarer, welches Schicksal auf Luise wartet: „Sie ist ein höchst natürliches, liebenswürdiges Wesen. Sie werden sie aber in Coburg so lange auf die Poliermühle und unter die Glanzpresse bringen, bis sie so flach und platt wie die übrigen wird. Sie ist in meinen Augen ein außerordentlich seltenes Wesen, von dem ich nur bedaure, daß sie in die Klauen eines Lämmergeyers gefallen ist.“34
Mit dem Lämmergeier ist zweifelsohne Ernst von Sachsen-Coburg gemeint. Während seiner Brautwerbung um Luise kann der Gothaer Hofbeamte Karl von Hoff beobachten, wie gezielt und zupackend sich der Coburger Herzog um die erbrechtlichen Angelegenheiten seiner zukünftigen Braut kümmert, so gierig wie ein Greifvogel, der sich auf seine Beute stürzt. Das Opferlamm ist Luise. Da sich absehen lässt, dass das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg keinen männlichen Erben mehr zu erwarten hat, ist Ernst eifrig darum bemüht, seine möglichen Ansprüche auszuloten. Im Sommer 1817 erscheint Ernst immer wieder bei seinem Schwiegervater, argwöhnisch beobachtet von Karl von Hoff, der die wahren Absichten des künftigen Bräutigams schon bald durchschaut hat: „Dem Herzog von Coburg war indessen sehr viel daran gelegen, die Erbfolgesache noch bei Lebzeiten des Herzogs August in Ordnung gebracht und seine Ansprüche gesichert zu sehen. Dazu und insbesondere, um über die aus seiner Vermählung ihm allein erwachsenden Ansprüche auf eine ansehnliche Allodialverlassenschaft [Privatvermögen der fürstlichen Familie] eine vollständige Übersicht zu erhalten, forderte er mich auf, ihm dazu alle erforderlichen statistischen Nachrichten aus dem Archiv zu verschaffen.“35 Karl von Hoff, der dem Geheimen Archiv des Herzogtums Gotha vorsteht, hat sich nicht nur mit der Geschichte des Fürstentums befasst, sondern auch mit dessen Erbrecht und den familiären Verhältnissen, die im Licht des Gesamthauses Wettin gesehen werden müssen, wobei die Interessen aller sächsischen Fürsten der protestantischen Linie zu berücksichtigen sind. Längst hat er zu dieser Frage ein Gutachten erstellt, das Ernst gute Aussichten auf die Nachfolge des Herzogs von Gotha in Aussicht stellt: „Da die darin enthaltene Ansicht seinen Ansprüchen günstiger war als denen des Hauses Meiningen, so mag er ganz zufrieden damit gewesen sein. Er schwieg zwar darüber gegen mich aber die junge Herzogin Louise äußerte mir desto lebhafter ihre Zufriedenheit. Sie hatte den Aufsatz mit voller Aufmerksamkeit gelesen.“36