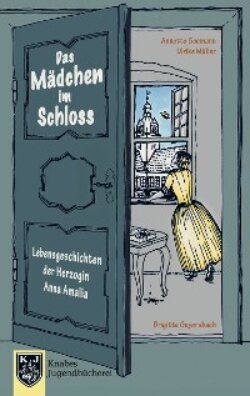Читать книгу Das Mädchen im Schloss - Ulrike Müller - Страница 8
Kapitel 3
ОглавлениеIn welchem Amélie erfährt, dass Menschen und andere Lebewesen seit Urzeiten auch außerhalb von Kirchen getauft worden sind
Viel Zeit war inzwischen vergangen. Amélie war zwei Jahre älter geworden, ein kleines Stück gewachsen und hatte sehr viel dazugelernt. Oft war sie zwischendurch heimlich an die Oker geschlüpft, um Amalunde zu treffen, das brauchte sie bei den vielen Erlebnissen, den bösen und weniger bösen, den aufregenden und traurigen. Amalunde war ihre beste Freundin, mit der sie über alles sprechen konnte. Ihr vertraute sie auch an, was sie bedrückte, wie zum Beispiel der gemeinsame Unterricht mit Caroline. Immer wusste die Schwester alles und sie – so wenig. Und wenn sie doch einmal die richtige Antwort auf der Zunge hatte, fehlte ihr meistens der Mut, gleich loszureden. Dabei mochte sie die beiden Lehrer, die im Herbst, kurz nach ihrem neunten Geburtstag, den Unterricht übernommen hatten: Hofkaplan und Religionslehrer Matthias Theodor Christoph Mittelstaedt und auch den anderen Lehrer, den Informator• für Geschichte und Geographie, Carl Friedrich Kirchmann. Mittelstaedt mochte sie noch lieber. Er konnte sehr schön erzählen. Er sprach mit leiser melodischer Stimme und lächelte den Kindern häufiger aufmunternd zu, gelegentlich mit einem leichten Augenzwinkern. Auch zeigte er ihnen wunderschöne, manchmal sogar farbige Abbildungen zu den biblischen Geschichten. Vor allem ging es ihm darum, die heiligen Handlungen des Christentums anschaulich zu machen.
Heute stand die Taufe auf dem Lehrplan, und sie erfuhren etwas über Johannes, den Täufer, von dem sich auch Jesus hatte untertauchen lassen, und zwar im Fluss Jordan. Nicht lange danach hatten sich auch Jesu Jünger von Johannes taufen lassen, um ihre Sünden wieder loszuwerden, sich wieder wie neue Menschen zu fühlen. Das Wasser sollte bei dieser heiligen Handlung nicht den Körper reinigen, sondern die Seele und vor allem das Gewissen, erklärte der Kaplan. Doch wie war eine solche Taufe praktisch vor sich gegangen, wollte Amélie wissen. „Nun“, antwortete ihr Lehrer, „die Beteiligten schritten, feierlich weiß bekleidet, in die Mitte des Flusses, der so flach war, dass man darin stehen konnte. Beim Taufen wurde dann der Kopf kurz unter die Oberfläche gedrückt und mit Flusswasser übergossen.“ Das ist eigentlich ziemlich praktisch, überlegte sich Amélie. Vielleicht wäre das ja auch mit dem Wasser der Oker möglich … Denn immer wieder überfielen sie diese Ängste, etwas falsch zu machen, Unpassendes zu sagen und dafür ausgelacht zu werden. Vielleicht könnte so eine neuerliche Taufe alle schlechten Gefühle einfach löschen, ja sogar diesen Schandfleck an ihr, den Buckel, gerade machen, verschwinden lassen – und alles wäre endlich, endlich gut? Unwillkürlich verkrampften sich ihre Hände ineinander, als sie daran dachte, wie elend sie sich oft fühlte. Und dann auch dieses grässliche „schlechte Gewissen“: Nicht, weil sie jemand anderem etwas Böses antat – so direkt geschah das nie –, sondern, weil sie oft mit ihrem scharfen Blick die Schwächen und Fehler der anderen Menschen um sich her wahrnahm, ja, aufdeckte. Denn alle Menschen versuchten doch, ihre dunklen Seiten möglichst zu verstecken. Dann hatte sie ein schlechtes Gewissen, vor allem, weil sie sich in ihrer Phantasie ausmalte, wie es wäre, wenn plötzlich auch alle anderen diese Fehler sähen: Die Naschsucht des sonst so tadellosen Abts Jerusalem, die Besserwisserei Carolines, die Klatschhaftigkeit von Madame Benzin und so weiter … Natürlich habe ich auch schlechte Eigenschaften … So bin ich sehr, sehr ungeduldig …, dachte sie gerade, als die Stimme von Kaplan Mittelstaedt wieder an ihr Ohr drang: „Nun, Herzogin, haben Sie noch Fragen zu diesem Thema?“
Amélie errötete leicht. Ihr war klar, dass sie die Gedanken von eben lieber für sich behielt. Aber gewohnt, ihre Phantasien in sich zu verschließen und nach außen schnell auf ein unverfänglicheres Thema auszuweichen, bemerkte sie nach kurzem Überlegen etwas altklug, dass Jesu und die Jünger doch schon erwachsen gewesen seien. Jetzt aber würden doch eigentlich immer die Kinder getauft. Ob beides gleich gut wäre? Der Kaplan sah sie überrascht und leicht amüsiert an und antwortete dann: „Im christlichen Glauben ist es heute so, dass man erst einmal die Kinder tauft. Sie, Herzogin, sind ja auch direkt nach Ihrer Geburt getauft worden. Die Taufe ist das Zeichen dafür, dass die Kinder ein für alle Male in die christliche Gemeinde wie in eine große Familie aufgenommen werden und ihnen deshalb später auch immer wieder ihre Sünden vergeben werden können. Aber auch Erwachsene können sich noch taufen lassen, wenn sie später zum Glauben finden und fortan ein Leben im Namen Christi führen wollen. Das kann zum Beispiel ein Mensch sein, der vorher einer anderen Religion angehört hat, eine Frau, die in Afrika aufgewachsen ist, oder ein Mann aus Indien.“ Und dann erzählte er noch ein paar Geschichten über christliche Lehrer, die lange Jahre in fernen Ländern zubrachten, um den Menschen dort das Christentum nahezubringen – Missionare wurden sie genannt. „Herzogin Caroline, erinnern Sie sich an den Lateinunterricht? Was bedeutet ‚missio‘?“ „Botschaft! Weil es um die christliche Botschaft geht!“, rief Amélie vorlaut. „Gut, Herzogin Amélie“, lobte der Pastor, „nur, dass ich nicht Sie, sondern Ihre Schwester gefragt hatte.“ „Das hätte ich auch gewusst“, sagte Caroline verärgert. Und Amélie befand, das war glatt gelogen. Sie unterdrückte ein kurz aufflammendes Gefühl von Triumph und nahm sich ernsthaft vor, die reinigende Kraft des Okerwassers für eine zweite Taufe auszuprobieren.
Unter den vielen kurzweiligen Geschichten des Kaplans ging die Lektion rasch ihrem Ende entgegen. Zuletzt gab er ihnen Zeit, damit sie aufschreiben konnten, was sie behalten hatten. Dann sammelte er ihre Hefte ein, um sie beim nächsten Mal korrigiert wieder mitzubringen – eine neue, ziemlich wirksame Methode, um die Aufmerksamkeit während des Unterrichts zu erhalten. Beim nächsten Mal sollte es dann um die Taufformel und um Petrus und Paulus gehen.
Die beiden Schwestern, die immer gemeinsam unterrichtet wurden, hatten jetzt ungewöhnlicherweise drei freie Stunden, da der Französisch- und der Geographieunterricht ausfielen. Beide Lehrkräfte waren zu einem Begräbnis gebeten worden. Caroline ging schnell davon, weil sie für den bevorstehenden großen Ball noch Tanzschritte üben wollte. Amélie aber hatte einen ganz anderen Plan … Dafür musste sie allerdings erst einmal die gleichaltrige Tochter der Köchin finden, mit der sie ein bisschen befreundet war – nur ein bisschen, denn offiziell war ihr der Umgang mit einem Mädchen von niederer Herkunft nicht gestattet. Sie entdeckte Anna-Greta im riesigen Vorraum zur Küche, wo sie dabei war, mit einem Reisigbesen den Boden zu fegen. Amélie nahm sie beiseite: „Kann Sie mir noch einmal einen von Ihren Kitteln ausleihen?“, fragte sie leise auf Deutsch, was ihr ein wenig schwer fiel. „Ich habe wieder einen Weg zu machen, allein, aber Sie weiß, das ist ein Geheimnis, davon darf niemand etwas erfahren.“ Anna-Greta kannte das schon und fragte nicht weiter, aber sie war stolz darauf, dass „die kleine Herzogin“, wie Amélie in der Küche genannt wurde, ihr vertraute. Sie bewunderte Amélie sehr und war stolz darauf, ihr einen Dienst erweisen zu können. Auf klappernden Schuhen lief sie davon und kam schon nach ein paar Minuten mit einem groben Leinengewand unter dem Arm zurück, das sicherlich schon bessere Tage gesehen hatte. Dazu hatte sie noch ein unauffälliges braunes Tuch mitgebracht, mit dem Amélie ihren Kopf und vor allem die kunstvoll geflochtenen und aufgesteckten Haare verhüllen konnte. Nur Schuhe konnte Anna-Greta der adligen Freundin nicht anbieten; ihr einziges Paar, hölzerne Pantoffeln, trug sie selbst an den Füßen. Amélie glitt hinter den Vorhang, der die großen Fässer und Gläser verdeckte und kam wenig später als zweite Anna-Greta wieder heraus. Nur ihre feinen Seidenschuhe wollten nicht passen und das Gewand war auch etwas zu weit, vor allem an den Ärmeln; Anna-Greta war größer und kräftiger, nicht zuletzt von der täglichen körperlichen Arbeit. „Kurz vor der Teezeit bin ich zurück; ich lege die Sachen wieder hinter den Vorhang“, flüsterte Amélie aufgeregt. Dann schlüpfte sie eilig durch den Dienstboteneingang auf der Rückseite der Küche nach draußen, lief geduckt an den Gebüschen entlang, die den Schlossgraben umsäumten, setzte ihre Schritte vorsichtig über den rutschigen Holzsteg, der abseits der Steinbrücke zum Schlossportal über den Graben führte und hatte es nun nur noch wenige Meter bis zum Ufer der Oker. Dort musste sie, vorbei an den stachligen Büschen, die immer wieder Anna-Gretas Gewand festhalten wollten, noch einige Meter bergab klettern, um den geheimen Treffpunkt zu erreichen: Grau und zerklüftet lag der Felsblock da und verdeckte die kleine Quelle, die neben dem Fluss aus dem sumpfigen Ufergrund sprudelte.
Schwupps, schon saß sie wieder mitten in der Quelle, sie, Amalunde, die kleine Flussnixe, und wieder hatte Amélie ihr Kommen nicht bemerkt. „Hoheit haben heute wieder Ihr Festtagsgewand an?“, spottete sie quietschvergnügt. „Ach, Amalunde, Du weißt doch, wie schwierig es ist, hier unauffällig herzukommen, aber … ich musste unbedingt kommen, denn ich habe eine wichtige Frage an Dich, und vielleicht … “ Sie sah mit zweifelndem Blick aufs Wasser und zog unwillkürlich fröstelnd die Schultern hoch. „Vielleicht“, murmelte sie, „vielleicht gehe ich auch einmal ins Wasser.“ Und dann wieder lauter: „Aber sag mir: Weißt Du, was eine Taufe ist, und: bist Du getauft?“ Die kleine Nixe glitt behände auf einen bequemen Vorsprung des Felsens, wrang ein paar nasse Strähnen ihres langen goldengrünen Haares aus, warf es mit gekonntem Schwung in den Nacken und antwortete dann: „Natürlich weiß ich, was eine Taufe ist! Ich, meine Familie und alle unsere Vorfahren, wir sind schließlich alle getauft worden.“ „Aber ihr lebt doch sowieso immer im Wasser, da ist Wasser doch gar nichts Besonderes“, wandte Amélie ein. „Pah“, sagte Amalunde, und das klang einigermaßen hochmütig, „Das Wasser ist etwas Besonderes, weil wir schon immer darin leben, seit tausenden von Jahren.“ „Aber“, so schnell gab Amélie nicht klein bei, „wie könnt ihr denn ‚schon immer‘ dort leben und ‚schon immer‘ getauft sein, wo doch Christi Geburt noch nicht einmal zweitausend Jahre her ist?“ „Was hat denn unsere Taufe mit eurem Christus zu tun?“ Fragte Amalunde ernsthaft erstaunt. „Die Taufe ist so alt wie das Wasser selbst!“
Das musste Amélie erst einmal verstehen und verkraften. Was würde Kaplan Mittelstaedt wohl dazu sagen? „Also ihr seid nicht ‚in Christi Namen‘ getauft?“ „Nein, im Namen aller Wassergötter und -göttinnen der Welt. Und deshalb dauert unsere Taufe auch sehr, sehr lange und ist ein großes, großes Fest. Ein Meeresnöck• bringt ein Fischerboot voller Meereswasser aus der griechischen See mit, ein Wassertroll aus den nordischen Fjorden große Zapfen von süßem Eiswasser, eine schwarzhaarige Nereide• regenbogenschillerndes Wasser in farbigen Muscheln aus dem pazifischen Ozean, die schöne Lau• bringt einen Bottich sprudelnden Quellwassers herbei und einer von den verrückten amerikanischen Siebzehnzehenreitern• einen Rucksack mit Wasser von den Niagarafällen. Und am Schluss kommen dann noch die Gobeline• aus der Wüste mit einem Lederschlauch voller Regenwasser. Dass diese Reise besonders lange dauert, kannst Du Dir wohl denken. Na ja, und all diese verschiedenen Wassersorten werden dann feierlich über einem ausgeschüttet. Aber vorher werden auch die Lippen damit bespritzt und man muss mindestens drei Tropfen davon kosten.“ Amélie war starr vor Staunen: „Und Du bist auch mit all dem Wasser getauft worden und hast davon gekostet?“ „Ja, natürlich! Alle Wasserkinder, gleich, ob Nixen oder Nöcke, werden im Alter von 150 Jahren getauft. Bei mir ist das erst vor kurzem gewesen, vor 27 Jahren. Unsere Taufe ist das Zeichen dafür, dass wir in die große Weltwasserfamilie aufgenommen worden sind und fortan mit dazu gehören, dass wir, so sagt man ja wohl, mit allen Wassern gewaschen sind.“
Amélie überging die Tatsache, dass Amalunde also schon offenbar 177 Jahre alt war. Sie war sich nicht sicher, ob sie die nächste Frage lieber nicht stellen sollte, tat es dann aber doch: „Und können damit auch Deine Sünden abgewaschen und die Seele und das Gewissen gereinigt und erneuert werden?“ „Seele? Gewissen? Was ist denn das?“, erkundigte sich Amalunde mit dem leicht spöttischen Unterton, der ihr zu eigen war, „ist das eine Art Haut oder Farbe?“ „Nein, das sitzt eher im Innern“, versuchte Amélie zu erklären, „Alle Menschen haben eine Seele und ein Gewissen.“ „Naja“, meinte die kleine Nixe, „wir sind ja auch keine Menschen, sondern nur mit ihnen verwandt. Aber sag mir doch: Wozu sind Seele und Gewissen denn nütze?“ Wenn ich das so genau wüsste, dachte Amélie, eigentlich sind sie nur eine Plage, behielt den Gedanken aber für sich. „Ich kann damit“, sagte sie dann laut, aber etwas beklommen, „herausfinden, ob das, was ich tue, gut oder schlecht ist, und wie sich das anfühlt.“
Nun gab es im Gespräch erst einmal eine längere Pause. Amalunde, so schien es Amélie, bekam vorübergehend schlechte Laune. „Ihr Menschen mit euren Gefühlen“, brummelte sie. Dann aber überzog ein listiges Lächeln ihr Gesicht. „Übrigens, Prinzessin“, rief sie, „was ich beinahe vergessen hätte! Seit dem 17. Jahrhundert ist überhaupt erst bekannt, dass wir mit den Menschen verwandt sind. Und daher gibt es seit der Zeit auch einen Extra-Guss aus einem Eimer der Menschen: Dazu wird ein Dienstmädchen aus der Küche des nächstgelegenen Schlosses oder Guts zur Feier eingeladen.“ „Und was bringt es mit?“, fragte Amélie gespannt. „Putzwasser“, jauchzte Amalunde übermütig, „einen Eimer voll mit herrlichem Putzwasser, aber das muss richtig gebraucht und schmutzig sein, sonst wirkt es nicht!“
Amélie konnte das nicht glauben: „Ist denn aus unserem Schloss bei Euren Taufen auch ein Dienstmädchen dabei gewesen? Vor 27 Jahren?“ Da brach Amalunde in glucksendes, silberhelles Lachen aus: „Du glaubst wohl nicht im Ernst, dass wir an diesem popeligen Flüsschen Oker unsere große Weltwassertaufe abhalten? Das glaubst Du nicht wirklich! Nein, das war am Rhein, direkt neben dem berühmten Loreley-Felsen. Und es war ein Dienstmädchen von einem der Weingüter dort. Bereits dorthin zu schwimmen, hat mehrere Wochen gedauert. Ein unvergessliches Erlebnis: 723 Nöcken, 415 Nixen und 75 der ältesten auf Neptun zurückgehenden Wassergötter samt ihrem Harem• von Wassergöttinnen mit Algenhaaren und Muschelpanzern zu begegnen. Dazu die Musik aus den Muschelhörnern, unsere Unterwasserballetts, das Festessen am Rhein zur Mitternacht … kurz: Es war nixisch schön!“ Amélie musste zugeben, sie wäre auch gerne dabei gewesen, begriff aber gleichzeitig, dass Amalunde ihr in Gewissensfragen nun wirklich nicht helfen konnte.
Jetzt schlug es vom Schlossturm fünf Uhr, was bedeutete, dass sie wieder einmal zu spät zum Tee erscheinen würde. Dabei war noch kein einziges Wort über Musik gesprochen worden, weil das Gespräch eine so unerwartete Wendung genommen hatte. Nach einer feuchten Abschiedsumarmung sputete Amélie sich tüchtig, um rasch noch den Kittel bei Anna-Greta abzulegen.