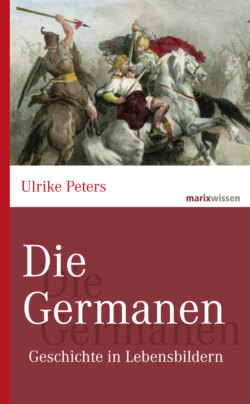Читать книгу Die Germanen - Ulrike Peters - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ariovist contra Caesar
ОглавлениеNicht nur diese erste Beschreibung der Germanen verdanken wir Caesar, sondern wir lernen durch ihn als Zeitzeugen auch erstmals eine germanische Führergestalt, Ariovist, »persönlich« kennen. Sein »Gallischer Krieg« ist die Hauptquelle zu Ariovist, aber auch Cassius Dio (153–229) erwähnt ihn in seiner »Römischen Geschichte«. Ariovist war ein Anführer der Sueben, »König der Sueben« nennt ihn Plinius der Ältere (23–79) in seiner »Naturalis Historia«. Gemeint sein dürfte damit eher ein Heerführer als ein König im heutigen Sinne. Caesar nennt ihn »Germanenkönig«. Die Sueben, von deren Name sich die spätere Bezeichnung Schwaben ableitet, waren ein Verband germanischer Stämme, deren Gebiet sich von der Ostsee bis zu den Mittelgebirgen und zwischen Elbe und Weichsel erstreckte. Nach Tacitus zählten die elb- und ostgermanischen Stämme zu den Sueben, so z. B. die Semnonen, Markomannen, Hermunduren, Quaden und Langobarden. Tacitus erwähnt auch die typische Haartracht der Sueben, den auf dem Scheitel hochgebundenen, sogenannten Suebenknoten. Der Suebenknoten war ein Statussymbol der Krieger, um damit »eine gewisse Größe zu erlangen und um Schrecken zu erregen« (Tacitus, Germania 38). Generell galten für die römischen Autoren zunächst die Sueben als Inbegriff der Germanen und prägten das damalige Germanenbild, bis diese Rolle dann später den Goten zukam.
Herkunft und Geburtsjahr des Ariovist sind unbekannt. Ariovist war ein keltischer Name, er soll auch die keltische bzw. gallische Sprache gut beherrscht haben. Neben seiner ersten Frau, einer Suebin, hatte er zudem eine Keltin zur Frau, die Schwester von Voccio, des Königs des keltischen Stammes der Noriker.
In den Blickpunkt der Römer und damit auch in unseren trat Ariovist erstmals, als er um 71 v. Chr. mit 15.000 Mann den Rhein überschritt und nach Gallien kam. Im Gefolge des Ariovist waren Söldner aus den suebischen Stämmen der Haruder, Triboker, Nemeter, Markomannen, Vangionen und Sedusier. Warum dieser Aufbruch? Der keltische Stamm der Sequaner im Gebiet zwischen Loire und Saône hatte Ariovist um Unterstützung gebeten in seinem Kampf mit den keltischen Haeduern um die Vorherrschaft in Gallien. Diese Kämpfe mit den Haeduern zogen sich zehn Jahr lang hin. Aber schließlich siegten die Sequaner mit Hilfe von Ariovist über die Haeduer 61 v. Chr. in der Schlacht von Magetobriga (heute La-Moigte-de-Broie an der Saône in Burgund). Einmal gerufen und durch den Sieg über die Haeduer an die Macht gekommen, blieb Ariovist mit seinem Stamm im Land der Sequaner, besetzte zunächst ein Drittel des Landes und forderte ein paar Jahre später, 58 v. Chr., ein weiteres Drittel. Dies ist auch ein Hinweis darauf, dass Ariovist nicht nur dem Hilferuf der Sequaner gefolgt war, sondern dass für ihn wahrscheinlich von Anfang an auch die Suche nach neuem, fruchtbarem Siedlungsgebiet auschlaggebend war. Und fruchtbar und ergiebig war das Land der Sequaner in der Tat. Ariovist erhöhte sein ursprüngliches Gefolge von 15.000 Mann auf 250.000, wie Caesar schreibt – ebenfalls ein Hinweis, dass er sich dauerhaft niederlassen wollte. Gruppen von Haruden, Vangionen, Markomannen, Triboker, Nemeter und Sedusier kamen und siedelten sich in Gallien an. Die Gallier baten daraufhin Rom, sie gegen Ariovist zu unterstützen. Rom unternahm aber zunächst nichts, um zu helfen. Im Gegenteil, noch im Jahre 59 v. Chr. wurde Ariovist vom römischen Senat zum »Freund des römischen Volkes« (amicus populi Romani) ernannt. Caesar höchstpersönlich war an dieser Ehrung als Konsul mitbeteiligt. Es war eine Ernennung, die das Ansehen Ariovists in Rom und seine bedeutende Stellung als germanischer Heerführer belegt. Von dieser Ehrung erhofften sich die Römer wohl Vorteile und ein Gleichgewicht der Kräfte in Gallien zu ihren Gunsten. Es sollte noch etwas dauern, ehe Caesar gegen Ariovist einschritt.
Denn zunächst – im Jahr 58 v. Chr. – ging Caesar gegen die Helvetier vor. Die Helvetier wollten nach Westen ins Gebiet der Santonen auswandern, weil Germanen in ihr Gebiet, die heutige Schweiz, vordrangen. Dabei wollten sie friedlich durch die römische Provinz ziehen. Caesar versperrte ihnen den Weg bei Genf, die Helvetier wurden zu einem Umweg durch das Juragebirge gezwungen. Die Haeduer richteten einen Hilferuf an Caesar, wie er selbst berichtet, weil sie sich von den Helvetiern bedroht fühlten. Ob dies stimmt oder nur erfunden ist, um einen Grund für seinen Angriff zu haben, ist unklar. Jedenfalls zog Caesar mit sechs Legionen gegen die Helvetier und besiegte sie bei Bibracte (Mont Beuvray). Nur ein Drittel der Helvetier überlebte und wurde zur Rückkehr in das Gebiet der Schweiz gezwungen.
Nach diesem Krieg gegen die Helvetier fand eine Versammlung der Gallier statt, bei dem sich der haeduische Häuptling Dividiacus gegenüber Caesar über die »grausame« Herrschaft des Ariovist beklagte: »Ariovist aber gab (…) grausame Befehle, forderte als Geiseln die Kinder jeweils der Vornehmsten und gab dabei alle Beispiele der Grausamkeit, wenn eine Sache nicht nach seinem Wunsche und zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurde. Er sei ein barbarischer Mensch, unbesonnen, man könne seine Befehle nicht länger ertragen.« (ebd., I, 31,12 f.)
Dieser Appell kam für Caesar wie gerufen, und es war ein willkommener Grund für ihn, in Gallien militärisch in Aktion zu treten. Zunächst schickte Caesar eine Gesandtschaft zu Ariovist, um sich mit ihm zu einer Unterredung zu treffen. Ariovist lehnte ein Treffen ab. Caesar schickte nochmals Gesandte zu Ariovist, um sich mit ihm zu unterreden. Caesar forderte in seiner Botschaft Ariovist auf, keine weiteren Germanen nach Gallien zu holen und die Geiseln der Haeduer freizugeben. Dabei erinnerte er Ariovist auch an seine Verpflichtung gegenüber den Römern, die er mit der Ehrung als »Freund des römischen Volkes« schuldig sei. Ariovist verweigerte wiederum ein Treffen mit Caesar und verwies selbstbewusst auf die Stärke seiner »unbesiegten Germanen, die erfahrensten Männer in Waffen« (ebd., I, 36,7) hin für den Fall, dass Caesar sie angreife. Kurz danach erhielt Caesar die Nachricht, dass Haruden, ein Unterstamm der Sueben, ins Gebiet der Haeduer eingefallen waren und weitere suebische Stämme auf dem Weg seien, sich im Gebiet der Treverer niederzulassen. Caesar wollte Ariovist zuvorkommen und besetzte daraufhin die strategisch wichtigste Stadt der Sequaner, Vesontio (Besançon). Die römischen Soldaten waren durch verschiedenste Informationen beunruhigt wegen der germanischen Kampfes- und Truppenstärke. Caesar konnte sie mit einer Rede überzeugen, weiter in das heutige Elsassgebiet zu marschieren. Dort im Elsass bei Mülhausen, ca. 8 km vom Rhein, wie Caesar angibt, trafen Römer und Germanen aufeinander. Es war im September des Jahres 58 v. Chr. Nun kam es doch noch zu einer Unterredung zwischen Caesar und Ariovist. Wie es im »Gallischen Krieg« heißt, »erinnerte Caesar am Anfang seiner Rede an die Wohltaten des Senats ihm [Ariovist] gegenüber, dass er König genannt wurde vom Senat und Freund, dass überaus großzügige Geschenke geschickt wurden (…)« (ebd., I, 43,4). Caesar forderte dann Ariovist auf, keinen Krieg gegen die Haeduer zu führen und deren Geiseln zurückzugeben. »Ariovist antwortete nur kurz auf Caesars Forderungen, viel dagegen sprach er von seinen eigenen Tugenden. Er sei nicht aus eigenem Antrieb über den Rhein gekommen, sondern durch Bitten der Gallier herbeigerufen worden. Er habe nicht ohne große Hoffnungen auf große Belohnungen sein Haus und seine Angehörigen verlassen. Die Wohnsitze, die er in Gallien habe, seien ihm von den Galliern zugestanden worden, die Geiseln auf deren Wunsch hin gegeben worden, Abgaben hätte er gemäß Kriegsrecht genommen, wie sie es gewohnt seien, sie den Besiegten aufzuerlegen. (…) Die Freundschaft des römischen Volkes müsse ihm eine Zierde und ein Schutz sein und dürfe ihm nicht zum Schaden gereichen. (…) Dass er eine große Zahl von Germanen nach Gallien geführt habe, geschehe, um sich selbst zu schützen, nicht um Gallien anzugreifen. (…) Er sei früher nach Gallien gekommen als das römische Volk, niemals zuvor sei das römische Volk aus dem Gebiet seiner gallischen Provinz herausgetreten. Was er [Caesar] eigentlich von ihm wolle? Warum er in seine Besitzungen eindringe? Seine Provinz sei dieses Gallien (…)« (ebd., I, 44,1-8). Noch während des Gesprächs griffen einige germanische Reiter die Römer mit Steinen und Geschossen an. Caesar beendete daher die Unterredung. Der Zwischenfall war sicher nicht im Interesse und im Sinne von Ariovist, der zwei Tage später Caesar um eine Fortsetzung des Gespräches bat. Caesar lehnte ein persönliches Erscheinen ab und schickte stattdessen Gesandte zu Ariovist. Der aber ließ diese Gesandten als angebliche Spione »in Ketten legen« (ebd., I, 47,6). Das war ein Verstoß gegen die Freiheit und Unversehrtheit von Gesandten. Ariovist war inzwischen zum römischen Lager vorgerückt und wollte mit der Festnahme der Gesandten verhindern, dass die Römer davon erfuhren, dass er bereits in Richtung ihres Lagers vorrückte.
Die anschließende Schlacht zwischen Römern und Germanen, die im September des Jahres 58 v. Chr. stattfand, dauerte mehrere Tage. Die Römer, die in der Überzahl waren und eine bessere Ausrüstung hatten, besiegten Ariovist und die Germanen. Der Sieg der Römer wird den Germanen bereits klar, als sie zum letzten Gefecht gegen diese aufbrechen und die in einer Wagenburg zurückgelassenen Frauen sie »mit Händeringen und weinend anflehten, sie nicht der Sklaverei bei den Römern zu überlassen« (ebd., I, 51,3). Am Ende des Kampfes bleibt den überlebenden Germanen nur die Flucht über den nahe gelegenen Rhein. »Unter diesen war auch Ariovist selbst, der ein kleines, am Ufer angebundenes Schiff erreichte und mit diesem floh. Ariovist hatte zwei Ehefrauen (…). Beide starben auf der Flucht. Zwei Töchter hatte er. Von diesen wurde die eine gefangen, die andere getötet.« (ebd., I, 53,3 f.) Caesar gibt an, dass die Römer 80.000 Germanen, fast zwei Drittel von Ariovists Truppen, in dieser Schlacht getötet hätten. Das ist sicher eine zu hohe Zahl, die den Verdienst von Caesar hervorheben soll.
Vermutlich starb Ariovist noch vor dem Jahr 54 v. Chr. Darauf weist eine kurze Randbemerkung Caesars hin, dass »der Schmerz der Germanen über den Tod Ariovists« (ebd., V, 29,3) groß sei. Mehr erfährt der Leser nicht. Mit Ariovist hatte erstmals ein Germane in der Geschichte eigene, persönliche Konturen erhalten – auch wenn wir nur wenige Informationen über ihn besitzen und dies auch nur von dem nicht ganz neutralen Bericht Caesars. Caesar konnte am Beispiel seiner Kämpfe mit Ariovist deutlich machen, dass die Germanen durchaus eine Bedrohung für die Römer darstellten und dass deshalb eine sichere Abgrenzung entlang des Rheins notwendig sei.
Die Konfrontation Caesars mit Ariovist war nicht das einzige Zusammentreffen Caesars mit den Germanen. Drei Jahre später, 55 v. Chr., kam es am Zusammenfluss von Rhein und Maas zu einer folgenreichen Auseinandersetzung zwischen Römern und den germanischen Stämmen der Usipeter und Tenkterer, die von der anderen Rheinseite her in Gallien eingefallen waren und die Caesar besiegte. Dabei nahm Caesar einen Übergriff der Germanen während eines Waffenstillstandes zum Anlass, eine Gesandtschaft von germanischen Führern, die um Entschuldigung bat, festzunehmen. Im anschließenden Gefecht verloren die meisten, nach Caesars Angaben insgesamt 430.000 Germanen, einschließlich Frauen und Kinder, ihr Leben (vgl. dazu »Der Gallische Krieg«, Buch V). Heute würde man dieses Vorgehen als Genozid bezeichnen. Aber auch damals in Rom war man darüber entsetzt, und Cato veranlasste die Einsetzung einer Untersuchungskommission zu diesem Vorfall.
Für Aufsehen in Rom sorgte Caesar aber auch danach, in den Jahren 55 und 53 v. Chr., mit zwei Überquerungen des Rheins. Denn er war der erste römische Feldherr, der in das rechtsrheinische Germanien militärische Expeditionen unternahm. Caesar wollte damit den Germanen zeigen, dass das römische Heer durchaus in der Lage war, den Rhein zu überqueren, und sie mit dieser Demonstration römischer Macht von Überfällen in Gallien abhalten. Für die erste Überquerung des Rheins im Jahr 55 v. Chr. ließ Caesar innerhalb von nur zehn Tagen eine Brücke aus Holz über den Rhein erbauen und überquerte so mit dem Heer den Fluss. Nahm man früher Bonn als Ort dieser Brücke an, spricht heute aufgrund von archäologischen Funden vieles dafür, dass sie zwischen Andernach und Koblenz erbaut wurde. Die zweite Brücke wurde wohl 53 v. Chr. bei Urmitz errichtet. Wie erwähnt, diente dieses Vordringen in das rechtsrheinische Germanien nur der Demonstration römischer Macht und es war keine dauerhafte Präsenz damit beabsichtigt. Caesars Ziel war mit der Eroberung Galliens erreicht und er hatte keine Ambitionen, das Gebiet des rechtsrheinischen Germaniens zu erobern.
Das änderte sich unter Augustus, dem Nachfolger Caesars, bald. Denn durch die Eroberung Galliens waren die Germanen zu direkten Nachbarn des Römischen Reiches geworden. Es kam immer wieder zu Überfällen der Germanen und die Römer reagierten darauf immer wieder mit Strafexpeditionen. Schließlich entschloss sich Augustus, das Gebiet des rechtsrheinischen Germaniens zu erobern. Das ist die Zeit des Arminius, des zweiten Germanen, der Geschichte mit weitreichenden Folgen schrieb.