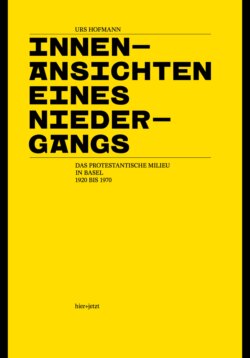Читать книгу Innenansichten eines Niedergangs - Urs Hofmann - Страница 26
2 – 3
ОглавлениеVEREINSAKTEN
Im dritten Teil der Untersuchung werden die Strukturen des Vereinswesens im Basel-städtischen Protestantismus aufgearbeitet. Hier steht die sogenannte «entlastete Kirchlichkeit» im Zentrum.108 Neben der Kirchlichkeit der engagierten «Kerngemeinde» und der distanzierten Kirchlichkeit der Kasualfrommen existierten Formen der Teilhabe an der kirchlichen Institution, die es erlaubten, Mitglied der Kirche zu sein, ohne starkem sozialen Konformitätsdruck oder autoritärer Disziplinierung zu unterliegen. Die Bildung eines breit gefächerten religiösen Vereinswesens, die Expansion des kirchlichen Zeitschriftenmarkts und die Entstehung eines organisatorisch selbständigen Sozialprotestantismus der diakonischen Vereine und Verbände ermöglichte es dem Einzelnen, sich durch selbst bestimmte «Ersatz-Leistungen» am kirchlichen Leben zu beteiligen – er war dadurch vom Konformitätsdruck der Kirche entlastet.
Entscheidende Indizien für ein protestantisches Milieu sind nach Blaschke und Kuhlemann die Bedeutung und Struktur des protestantischen Vereinswesens.109 Zur Bedeutung des protestantischen Vereinswesens und des Verbandsprotestantismus in Deutschland hat Jochen-Christoph Kaiser wegweisende Studien veröffentlicht. Nach Kaiser trat in Deutschland mit den protestantischen Vereinsgründungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine bewusste Politisierung des Protestantismus an die Stelle der kultivierten Überparteilichkeit des Kirchlichen; eine eigentliche protestantische Milieubildung habe sich erst in der Weimarer Republik vollzogen.110
Neben strukturellen Fragen, die sich zu diesen Vereinen stellen, wie jene nach ihrer Anzahl, deren Zwecksetzungen, nach Entstehungs- und Auflösungsgründen und nach den wichtigsten Akteuren, sind auch tiefer gehende Fragen zu stellen. So ist das Verhältnis von Verbandsprotestantismus und Säkularisierung noch ungeklärt.111 Zu fragen ist auch, ob es den protestantischen Vereinen gelang, den Prozess der Entkirchlichung zu verzögern, und ob die Vereine über das eigene Mitgliederpotenzial hinaus Wirkung entfalten konnten. Ein besonderes Problem im Rahmen der Frage nach sozialen und kulturellen Deutungsmustern ist die Differenzierung des Protestantismus in einen liberalen und einen konservativen Flügel. Insofern genügt eine konfessionelle Differenzierung nicht. Sie muss vielmehr, gerade im Protestantismus, begleitet sein von Reflexionen über die unterschiedlichen Aspekte von individueller und institutioneller Kirchlichkeit, das heisst sie muss die verschiedenen Gruppen, die sich im Basler Protestantismus unter dem Dach einer «Volkskirche» zusammenfanden, vor Augen haben. Interessant ist weiter die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Vereinswesen und Milieu in Basel.
Zum Zweck seiner Untersuchung wird das Vereinsund Verbandswesen von den jeweiligen Forschenden in unterschiedlicher Art und Weise systematisiert. Günter Brakelmann differenziert die Protestanten auf der Ebene der Kirchgemeinde in drei Gruppen: traditionelle, kirchlich-theologisch und politisch Konservative; Gemeindegruppen, die zum Beispiel auf die Herausforderung der «sozialen Frage» mit innovativen Reformvorschlägen antworten; Kleinstgruppen und Persönlichkeiten, die eine öffentliche Wirkung ausübten.112 Jochen-Christoph Kaiser unterscheidet zeitliche Phasen in der Entwicklung des Vereinswesens und die im Lauf der Zeit zunehmende Spezialisierung der Vereinszwecke.113 Der Ursprung der Vereinstypisierung nach Kaiser liegt im heterogenen deutschen Protestantismus beziehungsweise in den Schwierigkeiten der deutschen Forschung, die Protestanten einem einzelnen, geschlossenen und eng definierbaren Milieu zuzuordnen.114 Kaiser unterscheidet die konfessionellen Vereine nach ihrer Zwecksetzung in die Typen a–h: a) missionarische Verbände; b) karitative Verbände; c) kirchenpolitisch tätige protestantische Verbände; d) Vereine für Sozialreform auf konfessioneller Grundlage; e) Berufsverbände; f) wissenschaftlich(-theologische) Vereine; g) «Naturstände» (Frauenund Jugendverbände); h) Bildungsvereine.115
Eine noch differenziertere Typisierung unternimmt Brigitte Gysin für die christlichen Vereine im «frommen Basel».116 Sie unterscheidet die Hauptzwecke nach religiös (a), sozial (b), Bildung (c) und wohltätig-religiös (d), teilt diese weiter nach untergeordneten Zwecken auf, die dann wiederum auf einer weiteren Ebene nach ihren Zielgruppen unterschieden werden.
Nach der These von Thomas Nipperdey haben die Kirchen bei der Entstehung des Verbandswesens keine Vorreiterrolle gespielt – sie hängten sich an die Verbandsentwicklung gewissermassen an, «in der sie ein zentrales Element der modernen Bürgerlichkeit zur Mobilisierung des Kirchenvolks gegen die Säkularisierung und zur Wiederverchristlichung der Gesellschaft sahen».117 Ob nun die Evangelischreformierte Kirche selbst das Vereinsprinzip übernahm und für ihre Zwecke instrumentalisierte, oder ob es die einzelnen Kirchenmitglieder als «Christen und zugleich Bürger» waren, wird vielleicht im Folgenden beantwortet werden können. Kaiser postuliert, die kirchlichen Vereinsgründungen bei den Protestanten basierten primär auf der Initiative von einzelnen Pfarrern, «die im Kirchenregiment entweder keine Rolle spielten» – er führt hier das Beispiel von Johann Hinrich Wichern an – «oder aufgrund des Pfarrerüberschusses gar nie in ein geistliches Amt gelangten».118 Auf jeden Fall stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Kirche und den christlichen Vereinen. Wenn die christlichen Vereinsgründungen keinen bewussten Akt der Kirche darstellten, sondern der Initiative von einzelnen Pfarrern oder Laien überlassen wurde, stellen sich Fragen zur Kontrolle und Konkurrenz der kirchennahen Vereine. Die neuen Gruppierungen konnten sich zu «nebenkirchlichen Institutionen mit eigenem Selbstbewusstsein»119 entwickeln. Die katholische Kirche löste diese Frage durch das Prinzip der Verkirchlichung der Vereine von Anfang an, während den evangelischen Landeskirchen dazu die Autorität fehlte. Wie die Verhältnisse diesbezüglich in Basel waren, wird die Untersuchung zeigen.
In diesem Sinne können die Vereinsakten über Ziele und Zwecke dieser kirchennahen Organisationen Auskunft geben. Sie zeigen weiter, mit welchen Mitteln diese Ziele erreicht werden wollten, ob die Vereinsmitglieder mit ihren Absichten erfolgreich waren oder nicht. Aus den Vereinsakten lässt sich weiter herauslesen, welche Rolle die Pfarrer in den Vereinen gespielt haben. Handelten sie im Auftrag ihrer Kirche, prägten sie die Vereinsausrichtung im Sinne ihrer Institution, oder waren sie frei in der Art und Weise der Mitgestaltung? Weiter kann Auskunft darüber gewonnen werden, wie die Vereinskonjunkturen über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg verliefen. Auch für die Forschungsarbeit mit einem mentalitätsgeschichtlichen Blickwinkel stellen die Vereinsakten eine ideale Quelle dar und versprechen gewinnbringende Aussagen.