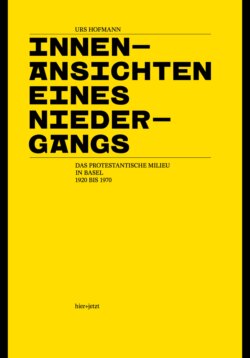Читать книгу Innenansichten eines Niedergangs - Urs Hofmann - Страница 30
3 – 1 – 1
ОглавлениеMETHODISCHES VORGEHEN
Da die Analyse von Diskursen neben Soziologen und Historikern wesentlich von Linguisten und Literaturtheoretikern mitentwickelt wurde, existieren in Bezug auf ihre Operationalisierung grosse Unterschiede. Entsprechend variiert je nach Methode auch das Verhältnis von technischem Aufwand und dem Nutzen für Historiker. Besonders die Disziplin der Soziolinguistik hat (im deutschen Sprachraum) mit Jürgen Link und Siegfried Jäger zwei produktive Verfechter der «kritischen Diskursanalyse».157 Methodologisch allerdings sind diese Ansätze nur mit grossen Schwierigkeiten auf das historische Feld übertragbar – die Fokussierung der Linguisten auf den Mikrobereich der Sprache, das heisst auf die Wort- und Zeichenebene, macht es für den Historiker ungeheuer aufwändig, längere Texte und oder gar serielle Textproduktionen zu untersuchen. Die Spannweite soziolinguistischer Ansätze reicht von der Lexikometrie, die lexikologische Analysen mit Hilfe von Computerprogrammen durchführt, über die Untersuchung von Fachtermini und politischem Vokabular bis zum semiotischen Ansatz von Jürgen Link, der die Funktionsweise sprachlicher «Kollektivsymbole» untersucht.158 Link nennt zum Beispiel den Terminus «Fairness», der sowohl in der «hohen Literatur» als auch in Alltagstexten und vor allem in mehreren Diskursen Verwendung findet; «Fairness» beschränkt sich nicht auf den Sportdiskurs, man findet den Begriff auch im juristischen, politischen oder religiösen Diskurs. Fairness ist im Sinne von Link deshalb ein typisches Beispiel für ein «interdiskursives Element».159
Auf das diffizile Feld der Operationalisierung für die historische Forschung wagen sich gewinnbringend vor allem Achim Landwehr, Peter Haslinger und Philipp Sarasin. Umfassend und überzeugend führt Landwehr von der Theorie zur Praxis. Auch Philipp Sarasin hilft methodisch weiter, obwohl er Diskursanalyse ausdrücklich nicht als Methode versteht, sondern «eher als eine theoretische, vielleicht sogar philosophische Haltung».160 Peter Haslinger schliesslich formuliert noch einmal zentrale Probleme der Diskursanalyse, wie sie auch Landwehr und Sarasin erörtern, und führt dann zu deren Bewältigung neue Instrumentarien ein: «die Diskursarena, die diskursive Versäulung, die diskursive Reichweite, die diskursive Kreativität des Individuums, den Rekurs auf Themen».161 Am Ende schliesst, wie bei Landwehr auch, ein stichwortartiges Modell an, eine Art Leitfaden zur praktischen Bewältigung der Diskursanalyse.162 Das in der vorliegenden Studie verwendete und im Folgenden erläuterte Vorgehen lehnt sich im Wesentlichen an die Arbeiten dieser drei Autoren an.
Für das Gelingen der Diskursanalyse zentral, darin sind sich alle Autoren einig, ist die Korpusbildung der Quellen. Selbstverständlich ist diese eng mit der jeweiligen Fragestellung verknüpft. Obwohl die historische Diskursanalyse zur klassischen Hermeneutik auf Distanz geht, beruht die Zusammenstellung des Textkorpus wesentlich auf hermeneutischen Verfahren; es besteht also ein nicht geringer Spielraum bezüglich der thematischen Eingrenzung und der damit heranzuziehenden oder auszuschliessenden Texte. Wichtig ist die Gleichförmigkeit der Quellen, die es erlaubt, die Wiederholungen von immer wieder ähnlich Gesagtem oder Geschriebenem zu analysieren. Denn es ist genau diese Aneinanderreihung von miteinander verbundenen Aussagen, konkret Einzeltexten – die «Einschreibung», wie sie Sarasin bezeichnet –, die die Diskursanalyse empirisch begründet.163 Die Hermeneutik spielt hier insofern eine Rolle, als die Eingrenzung des Textkorpus nicht ohne ein bestimmtes Vorwissen möglich ist. Von der Gesamtheit aller Äusserungen zu einem bestimmten Diskurs – dem sogenannten imaginären Korpus – ist in der Regel nur noch ein Teil der Texte erhalten und analysierbar. Aus diesem konkreten Korpus gilt es, nach Sichtung und Gewichtung eine möglichst repräsentative Auswahl an Texten vorzunehmen, die auch noch in ausreichender Zahl vorhanden sind und sich über einen gewissen Zeitraum erstrecken. Diese Auswahl ist natürlich bereits hypothesengeleitet und somit nicht «objektiv».
Diskursanalyse ist eine historische Methode, die sozusagen zwischen der Linguistik auf der einen und der klassischen historischen Kontextanalyse auf der anderen Seite liegt.164 In Bezug auf das Verhältnis von Text und Kontext bedeutet die Diskursanalyse eine Umkehr des Blickwinkels und damit der Arbeitsreihenfolge: Während in geschichtswissenschaftlichen Arbeiten in aller Regel «eine Beobachtung aus dem Kontext – ein Ereignis, eine Person, eine Institution, eine Entwicklung – zum Ausgangspunkt einer Fragestellung gemacht wird»,165 bilden bei der Diskursanalyse die Texte den Ausgangspunkt der Untersuchung. Um dieser Vorzugsstellung des Textes vor dem Kontext gerecht zu werden, muss ihr auch methodisch Ausdruck verliehen werden. Der hier vertretene Ansatz folgt dem Vorschlag von Landwehr, der nach der Korpusbildung als zweiten Schritt die vertiefte Kontextanalyse vorschlägt.166 Die abschliessende Analyse der Diskurse lässt sich indes nicht erfolgreich vornehmen, ohne vorgängig den Kontext zu erörtern, denn auch zur Bestimmung eines Diskurses wird es immer notwendig sein, sich über Zeitpunkt, Ort und Form der Aussagen im Klaren zu sein.167 In diesem Sinne wird der Vorschlag von Philipp Sarasin verfolgt, der für seine diskursanalytische Untersuchung des hygienischen Körpers im 19. Jahrhundert fünf Ansatzpunkte definiert:168 «erstens die serielle Erfassung dieser Textproduktion, um die Struktur ihrer materiellen Produktions- und Distributionsformen zu erkennen; zweitens die Untersuchung der Protokolle der Lektüre; drittens die Rekonstruktion der grundlegenden diskursiven Regelmässigkeiten; viertens eine Skizze des populärwissenschaftlichen Interdiskurses und fünftens die Konfrontation des Hygienediskurses mit konkurrierenden Formen des Aussagens über den Körper.»169
Die Bedeutung von «Diskurs», die im Folgenden verwendet wird, versteht sich als Gesamtheit der Begriffe, Redewendungen und Sprechakte zur protestantischen Sicht der Kirche in der sich verändernden, modernen Gesellschaft. Die gesammelten Aussagen sind Teil dieses Diskurses und beziehen sich jeweils aufeinander. Der imaginäre Korpus zum protestantischen Diskurs über den gesellschaftlichen Wandel enthält sämtliche Äusserungen zu diesem weit gefassten Themenbereich – seien es Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel, Flugblätter, Radio- oder Fernsehsendungen. Aus dem davon noch erhaltenen und recherchierbaren Teil, dem virtuellen Korpus, bilden die Artikel aus protestantischen Zeitschriften die Grundlage der in dieser Arbeit vorgenommenen Diskursanalyse. Es handelt sich dabei um knapp 700 Artikel, die in den sechs verschiedenen kirchlichen und kirchennahen Zeitschriften im Zeitraum von knapp 60 Jahren erschienen sind. Der lange Untersuchungszeitraum von 1920 bis in die 1970er-Jahre erlaubt es, die diskursiven Konjunkturen zu verfolgen: Einzelne Themen erscheinen regelmässig auf dem Radarschirm der protestantischen Medien, nur um dann wieder für einige Jahre zu verschwinden. Anderes wiederum ist 40 Jahre lang kein Thema, wird dann aber in den 1950er- und 60er-Jahren umso intensiver diskutiert.
Die gesammelten Artikel können unterschieden werden in solche, die sich ausschliesslich theologischen Fragen widmen, und in alle anderen, die theologiefremde Themen zum Inhalt haben. Während uns Erstere an dieser Stelle weniger interessieren, machen die gesellschaftsnahen Themen rund einen Viertel aus und ergeben damit einen zur Untersuchung zur Verfügung stehenden Korpus von ungefähr 175 Texten. In diesen Zeitschriftenbeiträgen äusserten sich die Autoren (zur grossen Mehrheit Pfarrer) zu verschiedenen gesellschaftsrelevanten Themen. Die Zeitschriftenartikel in der protestantischen Basler Presse erfüllen weiter die Kriterien der «Einheitlichkeit des Mediums» und der Wiederholung und Gleichförmigkeit von immer wieder ähnlich Geschriebenem.170 Das verhältnismässig aufwändige Verfahren der Diskursanalyse verunmöglicht es jedoch, jede einzelne Diskussion und somit jeden einzelnen Text zu analysieren. Stellvertretend wurden deshalb einige repräsentative Debatten zur Analyse ausgewählt, und zwar mit folgendem Vorgehen: Diese Auswahl erfolgte nach einer qualitativen Sichtung aller Artikel – sie gab Auskunft über die Anzahl der relevanten Texte zu einem Thema, über die Regelmässigkeit und Häufigkeit ihres Erscheinens und somit über ihre Bedeutung im vorliegenden Kontext. Der sogenannte Oberdiskurs, hier als gesellschaftlicher Wandel in der Wahrnehmung der protestantischen Kirche bezeichnet, kann in verschiedene Unterdiskurse aufgeteilt werden: Armut/Arbeitslosigkeit/soziale Frage; Wirtschaft/Teuerung; Basels protestantische Kirche/Theologische Fakultät; Stellung der Frau (in der Kirche und der Gesamtgesellschaft); Neuer Lebensstil/Moderne (Neue Medien, Sexualmoral, Atomwaffen, Wahrnehmung der Prosperität etc.). Diese Unterdiskurse wiederum können in 15 verschiedene, thematisch eng begrenzte Bereiche unterteilt werden. Jeder der 175 ausgewählten Artikel wurde einem dieser Themenkreise zugeordnet.171 Sämtliche Themen berühren die Kirche in ihren Beziehungen gegen aussen und auch in ihrem Innern, über ihre Mitglieder, die gesellschaftliche Veränderungen in sie hineintragen. Zur Diskursanalyse ausgewählt wurden schliesslich die folgenden Themenbereiche: Die Nachfolge Karl Barths an der Theologischen Fakultät der Universität/die «Atom-Initiative»; Die Stellung der Frau in der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt; «Kirche und Sexualmoral»; Radio, Fernsehen und Kirche; Die Krisenzeit. Die Auswahlkriterien für diese Themenbereiche waren: 1.) Relative Häufigkeit des Themas, 2.) Anzahl der dazugehörigen Texte (die Relevanz eines Themas steigt mit der Anzahl der dazugehörigen Texte), 3.) Regelmässigkeit des Erscheinens (bevorzugt wurden Themen, die über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder in den Zeitschriften erscheinen), 4.) Relative thematische Relevanz.