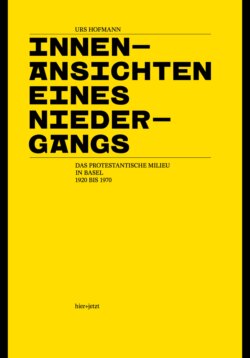Читать книгу Innenansichten eines Niedergangs - Urs Hofmann - Страница 31
3 – 2
ОглавлениеSTRUKTUR- UND AKTEURSGESCHICHTE
Die Vereinigung dieser zwei in der Theorie gegensätzlichen methodischen Herangehensweisen gleicht einem Oxymoron – für die vorliegende Arbeit macht sie durchaus Sinn. Wenn hier auf eine eingehende Diskussion dieser beiden Methoden verzichtet wird,172 muss stattdessen auf die Vorteile eingegangen werden, die eine Verbindung beider Herangehensweisen bietet. Während die Strukturgeschichte als Teil der «Historischen Sozialwissenschaft» eben die überindividuellen Strukturen in Wirtschaft oder Gesellschaft und soziale Lagen von Schichten und Gruppen in den Blick nimmt, fokussiert die Personen- oder Akteursgeschichte auf genau jene Individuen, die als Kollektiv eine Gruppe oder einen gesellschaftlichen Stand ausmachen. «Als Produkt der Modernisierung machte die Sozialgeschichte das Studium der Gesellschaft in der Modernisierung zu ihrem wohl zentralen Projekt», postuliert Josef Mooser.173 Insofern eignet sich die Sozialgeschichte in besonderem Masse, den Einbruch der Moderne in die Kirchen zu erfassen. Von diesem grösstmöglichen Bezugsrahmen einer Gesellschaftsgeschichte (im Sinne einer «histoire totale»), kann, quasi unter dem Vergrösserungsglas, der individuelle Akteur im kulturgeschichtlichen Sinn in den Blick genommen werden. So erfährt die Sozial- beziehungsweise Strukturgeschichte eine sinnvolle Ergänzung durch die Kulturgeschichte als ihre Hauptkritikerin, die unter anderem das Handeln des Einzelnen unter mikrogeschichtlichen Vorzeichen zum Forschungsgegenstand hat.174 Im vorliegenden, auf die Regionalgeschichte beschränkten Untersuchungsraum können so neben den kirchlichen und kirchennahen Vereinsstrukturen auch die massgebenden Akteurinnen und Akteure des baselstädtischen Protestantismus identifiziert werden. Namen, Aktivitäten und Ziele dieser Protagonisten können umrissen und die vorhandenen Verbindungen untereinander offen gelegt werden. Es ergeben sich Fragen nach den Formen und Gründen des Engagements, nach den Formen der Beziehungen zwischen den Akteurinnen und Akteuren und der offiziellen Kirche. Es kann weiter danach gefragt werden, welche politische Grundhaltung sich in ihrem Engagement offenbarte, welchem Flügel (liberal/positiv/konservativ) sie angehörten und ob es einzelnen Exponenten gelang, über den Kreis der engen Anhängerschaft hinaus Wirkung zu entfalten.
1 Robert Leuenberger in «Gottesdienst – Angebot ohne Nachfrage? Zwei Umfragen unter der reformierten Bevölkerung Basels, Basel 1969», hg. von der Evangelischen Kirche Basel-Stadt, S. 8.
2 Raulff, Ulrich (Hg.): Mentalitäten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse, Berlin 1987.
3 Burke, Peter: Stärken und Schwächen der Mentalitätengeschichte, in: Raulff, Ulrich (Hg.), Mentalitätengeschichte, Berlin 1987, S. 127–145, hier S. 128.
4 Ebd., S. 128
5 Möller, Johann Michael: Die eigene Epoche ist wie ein Vaterland. «Mentalitäten-Geschichte» – Aufsätze zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse, in: FAZ 11. 5. 1988, zit. nach Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 182.
6 Le Goff, Jacques: Les mentalités: une histoire ambiguë, in: Ders., Pierre Nora (Hg.), Faire de L’histoire, Bd. 3, Paris 1974, S. 76–94, hier S. 76.
7 Sellin, Volker: Mentalität und Mentalitätsgeschichte, in: Historische Zeitschrift 241 (1985), S. 555–598; Ders: Mentalitäten in der Sozialgeschichte, in: Schieder, Wolfgang (Hg.), Sozialgeschichte in Deutschland: Entwicklungen und Perspektiven im internationalen Zusammenhang, Göttingen 1987, S. 101–121; Schöttler, Peter: Mentalitäten, Ideologien, Diskurse. Zur sozialgeschichtlichen Thematisierung der «dritten Ebene», in: Lüdtke, Alf (Hg.), Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen, Frankfurt a. M., New York 1989; Dinzelbacher, Peter: Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen, Stuttgart 1993; Kuhlemann, Frank-Michael: Mentalitätsgeschichte. Theoretische und methodische Überlegungen am Beispiel der Religion im 19. und 20. Jahrhundert, in: Hardtwig, Wolfgang (Hg.), Kulturgeschichte heute, Göttingen 1996, S. 182–211; Ders.: Bürgerlichkeit und Religion. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der evangelischen Pfarrer in Baden 1860–1914, Göttingen 2002.
8 Geiger, Theodor: Die soziale Schichtung des deutschen Volkes, Stuttgart 1967, S. 77f.
9 Blessing, Werner K.: Staat und Kirche in der Gesellschaft. Institutionelle Autorität und mentaler Wandel in Bayern während des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1982, S. 14.
10 Nipperdey, Thomas: Die anthropologische Dimension der Geschichtswissenschaft, in: Gerhard Schultz (Hg.), Geschichte heute, Göttingen 1973, S. 225–255, hier S. 245.
11 Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 187ff.
12 Ebd., S. 187.
13 Auch Ulrich Raulff fragt, «ob sich Mentales überhaupt theoretisch fassen lässt oder nicht vielmehr immer nur retrospektiv, von der positiven Realisation der Disposition her, beschrieben werden kann.» Raulff, Mentalitäten-Geschichte, S. 11.
14 Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 189.
15 Ebd., S. 193.
16 Schieder, Rolf: Mentalitätsgeschichte als Predigtgeschichte. Analyse einer Rundfunkpredigt aus dem Jahr 1932, in: Graf, Friedrich Wilhelm, Klaus Tanner (Hg.), Protestantische Identität heute, Gütersloh 1992, S. 176–191. S. 177f.
17 Schieder, Predigtgeschichte, S. 178f.
18 Schulze, Hagen: Mentalitätsgeschichte – Chancen und Grenzen eines Paradigmas der französischen Geschichtswissenschaft, in: GWU 36 (1985), S. 247–270, hier S. 255.
19 Schöttler, Mentalitäten, S. 87. Insbesondere Peter Schöttler hat sich um die Rezeption der Französischen Mentalitätsgeschichte im deutschen Sprachraum verdient gemacht. Zum Verständnis des Mentalitäts-Begriffs bei den Vertretern der Annales-Schule: Burguière, André: Der Begriff «Mentalitäten» bei Marc Bloch und Lucien Febvre: zwei Auffassungen, zwei Wege, in: Raulff, Mentalitäten-Geschichte, S. 33–49.
20 Ariès, Philippe: Geschichte der Kindheit, München 1975 (franz. 1960); Vovelle, Michel: Die Französische Revolution – soziale Bewegung und Umbruch der Mentalitäten, München 1982; Corbin, Alain: Pesthauch und Blütenduft. Kulturgeschichte des Geruchs, Berlin 1984 (franz. 1982).
21 Pollack, Martin: Abbrechende Kontinuitätslinien im deutschen Protestantismus nach 1945, in: Gailus, Manfred, Hartmut Lehmann (Hg.), Nationalprotestantische Mentalitäten. Konturen, Entwicklungslinien und Umbrüche eines Weltbildes, Göttingen 2005, S. 453–466, hier S. 454.
22 So Greschat, Martin: «Rechristianisierung» und «Säkularisierung». Anmerkungen zu einem europäischen interkonfessionellen Interpretationsmodell, in: Kaiser, Jochen-Christoph, Anselm Doering-Manteuffel (Hg.), Christentum und politische Verantwortung. Christentum im Nachkriegsdeutschland, Stuttgart 1990, S. 1–24, hier S. 9.
23 Le Goff, Jacques, in: Ders., Roger Chartier, Jacques Revel (Hg.): La nouvelle histoire, Paris 1978, S. 324.
24 Burke, Stärken und Schwächen, S. 134; Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, S. 574ff.
25 Rohe, Karl: Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland. Kulturelle Grundlagen deutscher Parteien und Parteiensysteme im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt 1992, S. 17.
26 Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 191. Der Ausdruck «Lebenswelt» stammt ursprünglich von Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Den Haag 1954, bes. Teil III, 105ff., zit. nach Sellin, Mentalität, S. 573.
27 Ebd., S. 191.
28 Sellin, Mentalität, S. 573f.
29 Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 192.
30 Zitat M. R. Lepsius, nach Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 192.
31 Raulff, Ulrich: Vorwort Mentalitäten-Geschichte, in: Ders. (Hg.), Mentalitäten-Geschichte, Berlin 1987, S. 14.
32 Dahm, Karl-Wilhelm: Pfarrer und Politik. Soziale Position und politische Mentalität des deutschen evangelischen Pfarrerstandes zwischen 1918 und 1933, Köln 1965.
33 So z. B. Altermatt, Katholizismus und Moderne, S. 17. Für Altermatt rückt jede Religionsgeschichte Mentalitäten in den Vordergrund und schafft so ein fälliges Korrektiv zur bislang stark materialistisch orientierten Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Mooser, Josef: Frommes Volk und Patrioten. Erweckungsbewegung und soziale Frage im östlichen Westfahlen 1800–1900, Bielefeld 1989; Schieder, Predigtgeschichte.
34 Blaschke, Olaf, Frank-Michael Kuhlemann: Religion im Kaiserreich. Milieus – Mentalitäten – Krisen, Gütersloh 1996.
35 Burke, Stärken und Schwächen, S. 127.
36 Lepsius, M. Rainer.: Interessen und Ideen. Die Zurechnungsproblematik bei Max Weber, in: Neidhardt, F. (Hg.), Kultur und Gesellschaft, Opladen 1986, S. 20–31, zit. nach Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 192. Volker Sellin rechnet sogar ideologische Aussagen den Quellen der Mentalitätsgeschichte zu, in Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, S. 594.
37 Kuhlemann, Mentalitätsgeschichte, S. 203.
38 Lepsius, M. Rainer: Parteiensystem und Sozialstruktur. Zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, in: Abel, Wilhelm (Hg.), Wirtschaft, Geschichte, Wirtschaftsgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Friedrich Lütge, Stuttgart 1966, S. 371–393. Brakelmann, Günter: Ruhrgebiets-Protestantismus, Bielefeld 1987; Hübinger, Gangolf: Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhältnis von Liberalismus und Protestantismus im wilhelminischen Deuschland, Tübingen 1994; Mooser, Frommes Volk; Nipperdey, Religion im Umbruch.
39 Blaschke/Kuhlemann, Religion im Kaiserreich, S. 45ff.
40 Altermatt, Katholizismus und Moderne.
41 Brakelmann, Günter: Das kirchennahe protestantische Milieu im Ruhrgebiet 1890–1933, in: Schmale, Wolfgang (Hg.), Bericht über die 38. Versammlung deutscher Historiker in Bochum, 26.–29. September 1990, Stuttgart 1991, S. 175–179, S. 176; Nipperdey, Religion im Umbruch, S. 91ff.
42 Hübinger, Kulturprotestantismus, S. 306. Zum Konzept der «Versäulung» vgl. Luykx, Paul: Niederländische Katholiken und die Demokratie 1900–1960, in: Greschat, Martin, Jochen-Christoph Kaiser (Hg.), Christentum und Demokratie im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1992. Er verweist auf die Fragmentierung der niederländischen Gesellschaft in mehrere Subkulturen (katholisch, protestantisch, sozialistisch).
43 Kuhlemann, Frank-Michael: Protestantisches Milieu in Baden. Konfessionelle Vergesellschaftung und Mentalität im Umbruch zur Moderne, in: Blaschke/Kuhlemann, Religion im Kaiserreich, S. 316–349, S. 347.
44 Ebd., S. 348.
45 Zur Modernisierungstheorie in den Geschichtswissenschaft differenziert: Mergel, Thomas: Geht es weiterhin voran? Die Modernisierungstheorie auf dem Weg zu einer Theorie der Moderne, in: Ders., Thomas Welskopp (Hg.): Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theoriedebatte, München 1997, S. 203–232, hier S. 214ff. Mergel sieht in der «klassischen» Modernisierungstheorie fünf Vorannahmen und «eingebaute Probleme», u. a. ein strukturell-funktionalistischer, makrotheoretischer Ansatz; ein umfassendes Inderdependenztheorem; die Annahme einer Linearität; die Dichotomie von Tradition und Moderne.
46 Lepsius, Parteiensystem und Sozialstruktur, S. 383.
47 Kuhlemann, Protestantisches Milieu in Baden, S. 348.
48 Ebd., S. 349.
49 So Sperber, Jonathan: Kirchengeschichte or the Social and Cultural History of Religion?, in: Neue Politische Literatur, 43 (1998), S. 13–35, hier S. 15.
50 Lepisus, Parteiensystem und Sozialstruktur, S. 382.
51 Ziemann, Benjamin: Die katholische Kirche als religiöse Organisation, in: Graf, Friedrich Wilhelm, Klaus Grosse Kracht (Hg.): Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert, Köln 2007, S. 329–351, S. 332.
52 In diesem Sinne Ziemann, Religiöse Organisation, S. 332; Schmidtmann, Christian: Katholische Studierende 1945–1973. Eine Studie zur Kultur- und Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Paderborn 2006, S. 18f.
53 Ziemann, religiöse Organisation, S. 331 sowie Fussnote 8, S. 331. Weitere Kritik am Milieukonzept siehe u. a. Dowe, Christopher: Auch Bildungsbürger. Katholische Studierende und Akademiker im Kaiserreich, Göttingen 2006, S. 15ff.; Schmidtmann, Christian: Katholische Studierende 1945–1973. Ein Beitrag zur Kultur- und Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Paderborn 2006, S. 17ff.
54 Pollack, Detlef: Rückkehr des Religiösen?, Tübingen 2009, S. 60f. Pollack hat sich um eine religionssoziologische Definition von Religion verdient gemacht. Siehe dazu ausführlich auch Pollack, Detlef: Säkularisierung – ein moderner Mythos?, Tübingen 2003, S. 29–55; Ders.: Religion und Moderne. Zur Gegenwart der Säkularisierung in Europa, in: Graf/Kracht, Religion und Gesellschaft, S. 73–103, insbes. S. 74–80; Ders.: Individualisierung statt Säkularisierung? Zur Diskussion eines neuen Paradigmas in der Religionssoziologie, in: Gabriel, Karl (Hg.), Religiöse Individualisierung oder Säkularisierung. Biographie und Gruppe als Bezugspunkte moderner Religiosität, Gütersloh 1996, S. 57–85.
55 Pollack, Individualisierung statt Säkularisierung, S. 59.
56 Knoblauch, Hubert: Die Verflüchtigung der Religion ins Religiöse. Thomas Luckmanns Unsichtbare Religion, in: Luckmann, Thomas: Die unsichtbare Religion, Frankfurt a. M. 1991, S. 7–41, S. 12.
57 In diesem Sinne Pollack, Individualisierung, S. 59; Stolz, Jörg: Secularization Theory and Rational Choice. An Integration of Macro- and Micro-Theories of Secularization Using the Example of Switzerland, in: Pollack, Detlef, Daniel V. A. Olson (Hg.), The Role of Religion in Modern Societies, New York 2008, S. 251–270, hier S. 254f.; Wallis, Roy, Steve Bruce: Secularization: The Orthodox Model, in: Bruce, Steve (Hg.), Religion and Modernization. Sociologists and Historians Debate the Seculariziation Thesis, Oxford 1992, S. 8–31, S. 10.
58 Stolz, Secularization Theory and Rational Choice, S. 254; Wallis/Bruce, Orthodox Model, S. 9f.
59 Wallis/Bruce, Orthodox Model, S. 11.
60 Hölscher, Lucian: Religion im Wandel. Von Begriffen des religiösen Wandels zum Wandel religiöser Begriffe, in: Gräb, Wilhelm (Hg.), Religion als Thema der Theologie. Geschichte, Standpunkte und Perspektiven theologischer Relgionskritik und Religionsbegründung, Gütersloh 1999, S. 45–62, S. 45.
61 Pollack, Religion und Moderne, S. 78. Ausführlicher: Pollack, Rückkehr, S. 293–303.
62 In diesem Sinne Pollack, Religion und Moderne, S. 78.
63 Ebd., S. 80.
64 Luckmann, Die unsichtbare Religion, S. 57.
65 Ebd., S. 55ff.
66 Pollack, Individualisierung statt Säkularisierung, S. 57.
67 Luckmann, Die unsichtbare Religion, S. 58.
68 Pollack, Individualisierung statt Säkularisierung, S. 78f.
69 Einen solchen bietet Detlef Pollack, Rückkehr des Religiösen?, S. 1–16.
70 Pollack, Individualisierung statt Säkularisierung, S. 61.
71 Nach Pollack, Rückkehr, S. 7.
72 Ebd., S. 5. Er bezieht sich hier auf Casanova, José: The problem of Religion and the Anxieties of European Secular Democracy, in: Motzkin, Gabriel, Yochi Fischer (Hg.), Religion and Democracy in Contemporary Europe, Jerusalem 2008, S. 63–74.
73 Knoblauch, Verflüchtigung, S. 11.
74 Hach, J.: Gesellschaft und Religion in der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1980, zitiert nach Knoblauch, Verflüchtigung, S. 16.
75 Nach Pollack, Individualisierung, S. 63.
76 Hervieu-Léger, Danièle: Religion and Modernity in the French Context: For a New Approach to Secularization, in: Sociological Analysis 1990 (51), S. 15–25, S. 22.
77 Zum ökonomischen Marktmodell der Religionen siehe u.a. Iannaccone, Laurence R.: Religious Markets and the Economics of Religion, in: Social Compass 39 (1992) Nr. 1, S. 123–131; Ders.: Voodoo Economics? Reviewing the Rational Choice Approach to Religion, in: Journal for the scientific Study of Religion 34 (1995) Nr. 1, S. 76–89; Ders., Rodney, Stark: A Supply-Side Reinterpretation of the «Secularization» of Europe, in: Journal for the scientific Study of Religion 33 (1994) Nr. 3, S. 230–252; Stark, Rodney, William Sims Bainbridge: The Future of Religion. Secularization, Revival and Cult Formation, Berkeley 1985; für die Schweiz aktuell: Stolz, Jörg: Secularization Theory and Rational Choice. An Integration of Macro- and Micro-Theories of Secularization Using the Example of Switzerland, in: Pollack, Detlef, Daniel V. A. Olson (Hg.), The Role of Religion in Modern Societies, New York 2008, S. 251–270.
78 Dazu u. a. Graf, Friedrich Wilhelm: Dechristianisierung. Zur Problemgeschichte eines kulturpolitischen Topos, in: Lehmann, Hartmut (Hg.): Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa, Göttingen 1997, S. 32–66, S. 33; Schieder, Wolfgang: Säkularisierung und Sakralisierung der religiösen Kultur in der europäischen Neuzeit. Versuch einer Bilanz, in: Lehmann, Säkularisierung, S. 309–313, S. 310; Greschat, Martin: Rechristianisierung und Säkularisierung: Anmerkungen aus deutscher protestantischer Sicht, in: Lehmann, Säkularisierung, S. 76–85, S. 81; Hölscher, Lucian: Säkularisierungsängste in der neuzeitlichen Gesellschaft, in: Gailus, Manfred, Hartmut Lehmann: Nationalprotestantische Mentalitäten. Konturen, Entwicklungslinien und Umbrüche eines Weltbildes, Göttingen 2005, S. 133–147, S. 135.
79 Greschat, Martin: «Rechristianisierung» und «Säkularisierung». Anmerkungen zu einem europäischen interkonfessionellen Interpretationsmodell, in: Kaiser, Jochen-Christoph, Anselm Doering-Manteuffel (Hg.): Christentum und politische Verantwortung, Kirchen im Nachkriegsdeutschland, Stuttgart 1990, S. 1–24, S. 19; Schieder, Säkularisierung, S. 311.
80 Greschat, Säkularisierung 1997, S. 81.
81 Berger, Peter L. (Hg.): The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, Washington 1999.
82 Casanova, José: Public Religions in the Modern World. Chicago 1994, S. 211ff.
83 Davie, Grace: Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging, Oxford 1994.
84 Lehmann, Säkularisierung, Dechristianisierung, S. 13.
85 Graf, Dechristianisierung, S. 62. Er wiederholt seine These in: Graf, Wiederkehr, S. 55.
86 Ebd., S. 52
87 Pollack, Säkularisierung, S. 12: «Zuweilen erinnert das Argumentationsmuster ‹die Kirchen leeren sich, aber Religion boomt› an ein System kommunizierender Röhren, in dem keine Substanz verloren gehen, sondern sich allenfalls eine Umschichtung der Verteilungsverhältnisse vollziehen kann.»
88 Bruce, Steve: Secularization: The Orthodox Model, in: Ders. (Hg.): Religion and Modernization. Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis, Oxford 1992, S. 8–30; Ders.: God is dead. Secularization in the West. Oxford 2001; Wilson, Brian R.: Religion in Secular Society. A Sociological Comment, London 1966; Ders.: The Secularization Thesis: Criticisms and Rebuttals, in: Laermans, Rudi, Bryan Wilson, Jaak Billiet (Hg.), Secularization and Social Integration: Papers in Honour of Karel Dobbelaere, Leuven 1998.
89 Hölscher, Religion im Wandel, S. 48.
90 Sperber, Kirchengeschichte, S. 13.
91 Panesar, Rita: Religion im Abonnement. Zeitschriften als Medium religiöser Vergemeinschaftung in Deutschland um 1900, in: Geyer, Michael, Lucian Hölscher (Hg.), Die Gegenwart Gottes in der modernen Gesellschaft. Transzendenz und Religiöse Vergemeinschaftung in Deutschland, Göttingen 2006, S. 277–319, hier S. 277.
92 Nach Panesar, Religion im Abonnement, S. 309.
93 Zu den kirchlichen Zeitschriften im 19. Jahrhundert siehe Stalder, Paul: Fromme Zeitschriften in Basel im 19. Jahrhundert, in: Kuhn, Thomas K., Martin Sallmann (Hg.), Das «fromme Basel». Religion in einer Stadt des 19. Jahrhunderts, Basel 2002, S. 199–204; Hofmann, Urs: Adolf Stoecker in Basel. Antisemitismus und soziale Frage in der protestantischen Presse der 1880er-Jahre, Basel 2004 (unveröff. Lizentiatsarbeit Universität Basel). Zu den kirchlichen Zeitschriften im 20. Jahrhundert siehe Lindt, Andreas: Der schweizerische Protestantismus – Entwicklungslinien nach 1945, in: Conzemius, Victor, Martin Greschat und Hermann Kocher (Hg.), Die Zeit nach 1945 als Thema kirchlicher Zeitgeschichte, Göttingen 1988, S. 62–71; Zur Geschichte der Evangelischen Presse in Deutschland grundlegend: Mehnert, Gottfried: Evangelische Presse. Geschichte und Erscheinungsbild von der Reformation bis zur Gegenwart, Bielefeld 1983.
94 Auch nach dem Zusammenschluss trug die Zeitschrift ein programmatisches Motto im Titel: «Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.»
95 Schweizerisches Reformiertes Volksblatt 26, 1. 7. 1939.
96 Lindt, der schweizerische Protestantismus, S. 63.
97 Kirchenfreund 12, 15. 12. 1918, S. 382.
98 Kirchenfreund 8, 15. 8. 1951, S. 211f.
99 Ebd., S. 212.
100 Christlicher Volksfreund 46, 12. 11. 1941, S. 362. Die genauen Gründe für die Aufgabe werden nicht genannt, allerdings lässt die Wortwahl der Einstellungserklärung darauf schliessen, dass der letzte Herausgeber, Pfarrer Georg Vischer, nicht bereit war, die unrentable Zeitschrift weiterhin zu unterstützen.
101 «Der ‹Christliche Volksfreund› im dritten Vierteljahrhundert 1924–1948», Christlicher Volksfreund 49, 4. 12. 1948, S. 580f.; Christlicher Volksfreund 51, 18. 12. 1948, S. 604.
102 «Wir stehen heute vor einer theologischen Situation, die verheissungsvoll genannt werden darf», Christlicher Volksfreund 49, 4. 12. 1948, S. 580.
103 Evangelische Volkszeitung 1, Juli 1920, S. 1.
104 Ebd., S. 1.
105 Das im Jahr 1961 als eines der wenigen kirchlichen Zeitschriften noch existierende Kirchenblatt für die reformierte Schweiz kostete im Abonnement 19 Franken pro Jahr, für die Einzelnummer der zweiwöchentlich erscheinenden Zeitschrift bezahlte man 75 Rappen.
106 Bei gesamtschweizerisch verbreiteten Zeitschriften gelten diese Zahlen für die Abonnenten im Raum Basel.
107 Mitteilung der Geschäftskommission, Kirchenbote Nr. 2, Pfingsten 1941.
108 Graf, Dechristianisierung, S. 54f.
109 Blaschke/Kuhlemann, Religion in Geschichte und Gesellschaft, S. 40.
110 Kaiser, Formierung, S. 277, 284.
111 Kaiser, Jochen-Christoph: Sozialer Protestantismus im 20. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte der Inneren Mission 1914–1945, München 1989, S. 3.
112 Brakelmann, Milieu im Ruhrgebiet, S. 175ff.; Kaiser, Formierung, S. 259.
113 Kaiser, Formierung, v. a. S. 266ff.; ausführlicher: Ders.: Konfessionelle Verbände im 19. Jahrhundert. Versuch einer Typologie, in: Baier, Helmut (Hg.): Kirche in Staat und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Referate und Fachvorträge des 6. Internationalen Kirchenarchivtags in Rom 1991, Neustadt a. d. A. 1992, S. 187–209.
114 Kaiser, Formierung, S. 265ff., schlägt verschiedene chronologische und typologische Schemata vor. Die Differenzierung des protestantischen Basler Vereinswesens in zeitlicher Hinsicht ist in der vorliegenden Untersuchung nicht notwendig, weil sich der gesamte Untersuchungszeitraum innerhalb der, nach Kaiser, letzten Phase (Hochindustrialisierung, Weltpolitik, Politisierung, Individualisierung) befindet. Zu den Vereinszielen siehe Kaiser, Peter: Die Realisierung des Vereinszwecks. Zur Dynamik von Zielen und Erfolg im Vereinswesen, in: Jost, Hans Ulrich, Albert Tanner (Hg.), Geselligkeit, Sozietäten und Vereine, Zürich 1991, S. 31–47. Kaiser, Vereinszweck, S. 33, weist darauf hin, dass der Vereinszweck ein komplexes Wertesystem beinhaltet, der schon aus terminologischer Sicht nicht als feste Grösse betrachtet werden kann.
115 Kaiser, Formierung, S. 267.
116 Gysin, Brigitte: Sicht der Stadt und Selbstbild der christlichen Vereine im «frommen Basel». Anhand der Jahresberichte, Basel 1999 (unveröff. Lizentiatsarbeit Universität Basel).
117 Zit. nach Kaiser, Formierung, S. 267. Nipperdey, Thomas: Verein als soziale Struktur im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Boockmann, Hartmut u. a. (Hg.): Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte historischer Forschung in Deutschland, Göttingen 1972, S. 1–44. Nipperdey, soziale Struktur, S. 4, schreibt dazu weiter: «Die Kirche, die im paritätischen Staat und einer sich säkularisierenden Gesellschaft ihre Selbstverständlichkeit verlor, wurde ein Stück bürgerlicher Gesellschaft und nahm sogleich manche von deren Lebensformen auf, darunter eben das Organisationsmodell Verein. Um der anhebenden Verdrängung aus der Öffentlichkeit zu begegnen, das Volk (wieder) kirchlicher zu machen und für die kirchliche Selbstbehauptung zu aktivieren, musste die Kirche volkstümlicher werden – dem diente der Verein, der Amts- und Anstaltsstrukturen abschwächte. Es gibt kaum etwas, was den Siegeszug des Vereinswesens stärker bezeugt als diese Übernahme durch eine traditionelle soziale Macht wie die Kirche.»
118 Kaiser, Formierung, S. 268.
119 Ebd., S. 269.
120 Gysin, Selbstbild; Janner, Sara: Mögen sie Vereine bilden ... Frauen und Frauenvereine in Basel im 19. Jahrhundert, Basel 1995; Dies.: Zwischen Machtanspruch und Autoritätsverlust. Zur Funktion von Religion und Kirchlichkeit in Politik und Selbstverständnis des konservativen alten Bürgertums in Basel während des 19. Jahrhunderts, Basel 2007 (unveröff. Dissertation Universität Basel).
121 Die Ausnahme von der Regel: Organisationen wie die Basler Predigergesellschaft oder der Evangelische Schulverein figurierten im Adressbuch der Stadt Basel zu Beginn der Untersuchungsperiode noch unter dem Titel «Wissenschaftl. und Bildungsvereine».
122 Zentralkommission für Armenpflege und soziale Fürsorge in Basel (Hg.): Führer durch Basels Wohlfahrtseinrichtungen, Basel 1924; Verwaltung der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt (Hg.): Kirchlicher Wegweiser, Basel 1920.
123 «[...] it reminds us that the explicit indicators by which texts are designated and classified create expectations of the reading and anticipations of understanding. [...] A similar process takes place with purely formal or material indicators – the format and the image, for example. From the folio to smaller formats, a hierarchy exists that links the format of the book, the genre of the text, and the moment and mode of reading. In the eighteenth century Lord Chesterfield bore witness to this fact: ‹Solid folios are the people of business whith whom I converse in the morning. Quartos are the easier mixed company whith whom I sit after dinner; and I pass my evenings in the light, and often frivolous chitchat of small octavos and duodecimos.› [...] This hierarchy distinguished the book that had to be laid flat in order to be read; the humanist book, which was more manageable in its medium format and suitable for both classic and newer texts; and the portable book, the libellus, a pocketbook and bedside book with multiple uses and more numerous readers.» Chartier, Roger: Texts, Printing, Readings, in Hunt, Lynn (Hg.), The new cultural history, London 1986, S. 154–175, hier S. 167f.; Sarasin, Philipp: Subjekte, Diskurs, Körper. Überlegungen zu einer diskursanalytischen Kulturgeschichte, in: Hardtwig/Wehler, Kulturgeschichte heute, S. 131–164, S. 145f.
124 Sarasin, Philipp: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M. 2003, S. 38f.
125 Sarasin, Diskursanalyse, S. 22, erläutert hier das Mentalitäts-Modell von Frantisek Graus.
126 Ebd., S. 29.
127 Peter Schöttler bezeichnet das Wort «Diskurs» als einen der erfolgreichsten internationalen Neologismen der letzten Jahrzehnte, in: Schöttler, Peter: Wer hat Angst vor dem «linguistic turn»?, in Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), S. 134–151, S. 134.
128 Sarasin, Subjekte, S. 141. Auch der häufig anzutreffende Begriff «öffentlicher Diskurs» bezeichnet eine laut Schöttler «soziologisch bestimmbare räsonierende Öffentlichkeit, und keineswegs eine historisch spezifische, nach bestimmten impliziten Regeln funktionierende Redeweise.», Schöttler, Peter: Sozialgeschichtliches Paradigma und historische Diskursanalyse, in: Fohrmann, Jürgen, Harro Müller (Hg.), Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, Frankfurt a. M. 1988, S. 159–199, S. 177.
129 Jones, Gareth Stedman: Languages of Class. Studies in English Working Class History 1832–1982, Cambridge 1983.
130 In diesem Sinne Schöttler, Mentalitäten, S. 102.
131 Sarasin, Subjekte, S. 158 (Hervorhebungen im Original).
132 «Eine Geschichte ist nie identisch mit der Quelle, von der diese Geschichte zeugt.» Koselleck, Reinhart: Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historiographischen Erschliessung der geschichtlichen Welt, in: Ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M., 1985, S. 176–207 (11979), S. 204.
133 Sarasin, Diskursanalyse, S. 55f. Einen solchen Abwehrreflex, ja sogar «Angst» vor Fiktion konstatierte auch Schöttler, linguistic turn, S. 146ff.
134 Sarasin, Philipp: Autobiographische Ver-Sprecher. Diskursanalyse und Psychoanalyse in alltagsgeschichtlicher Perspektive, Werkstatt Geschichte 7 (1994), S. 31–41, S. 33.
135 Landwehr, Achim: Geschichte des Sagbaren: Einführung in die historische Diskursanalyse, Tübingen 2004, S. 12.
136 In diesem Sinne Landwehr, Diskursanalyse, S. 12, 104, 132; Sarasin, Diskursanalyse, S. 29f.
137 Sarasin, Subjekte, S. 157 (Hervorhebungen im Original).
138 Jones, Klassen, Politik und Sprache, S. 137.
139 So liest Sarasin, Diskursanalyse, S. 29, die Foucaultsche Zurückweisung des klassischen «Die-Zusammenhänge-verstehen».
140 Zum Diskursbegriff von Habermas vgl. u. a. Habermas, Jürgen, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M. 1985, S. 390ff.; Ders., Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a. M. 1991. Zit. in Schöttler, Wer hat Angst, S. 136ff.
141 Peter Schöttler weist auf die sprachanalytischen Fragestellungen hin, die die mentalitätshistorischen Projekte von Anfang an begleitet haben, in Schöttler, Paradigma, S. 161.
142 Schöttler, linguistic turn, S. 139.
143 Landwehr, Diskursanalyse, S. 104.
144 Ebd., S. 172.
145 Schöttler, Paradigma, S. 163f., bezieht sich hier auf Roland Barthes’ Aufsatz «Literatur oder Geschichte», Frankfurt a. M. 1969, S. 11–35; im französischen Original unter dem Titel «Litterature ou Histoire», in Ders., Sur Racine, Paris 1963, S. 145–167, in dem Barthes u. a. die klassische Frage nach dem Autor und seiner Intention zurückweist. Der Begriff «Möglichkeitsbedingungen» auch bei Roger Chartier: Die unvollendete Vergangenheit. Geschichte und die Macht der Weltauslegung, Berlin 1989, S. 15. Für Chartier muss sich jede historische Analyse von Diskursreihen auf die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen von Aussagen einlassen.
146 Dazu u. a. Eder, Franz X.: Historische Diskurse und ihre Analyse – eine Einleitung, in Ders. (Hg.), Historische Diskursanalysen. Genealogie, Theorie, Anwendung, Wiesbaden 2006, S. 9–23, hier S. 13.
147 Landwehr, Diskursanalyse, S. 98.
148 Zit. nach Haslinger, Peter: Diskurs, Sprache, Zeit, Identität. Plädoyer für eine erweiterte Diskursgeschichte, in Eder, Historische Diskurse, S. 27–50, S. 29.
149 Zit. nach Schöttler, linguistic turn, S. 139.
150 So Foucault: Politics and the study of discourse, in: Burchell, Graham et al. (Hg.), The Foucalut effect. Studies in gouvernmentality, Londen u. a. 1991, S. 53–72, S. 63, zit. nach Landwehr, Diskursanalyse, S. 80.
151 Nach Landwehr, Diskursanalyse, S. 98.
152 Mergel, Thomas: Kulturgeschichte – die neue «grosse Erzählung»? Wissenssoziologische Bemerkungen zur Konzeptualisierung sozialer Wirklichkeit in der Geschichtswissenschaft, in Hardtwig/Wehler, Kulturgeschichte heute, S. 41–77, S. 70.
153 Sarasin, Subjekte, S. 161f. (Hervorhebungen im Original).
154 Ebd., S. 162.
155 Landwehr, Diskursanalyse, S. 101f.
156 Ebd., S. 129.
157 Jäger, Siegfried: Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Duisburg 32001; Link, Jürgen et al. (Hg.): Elementare Literatur und generative Diskursanalyse, München 1983; Ders.: Was ist und was bringt Diskursdidaktik. Stichwort «Interdiskurs», in: KultuRRevolution 2, 1983, S. 60–66.
158 Eine Methode zur «Automatischen Diskurs-Analyse» entwickelte M. Pêcheux. Zusammenfassende Darstellung: Pêcheux, M. u. a.: Présentation de l’analyse automatique du discours. Théories, procédures, résultats, perspectives, in: Mots, Nr. 4, 1982, S. 95–122, zit. nach Schöttler, Mentalitäten, S. 114f. u. Anm. 125. «Automatisch» wird im Sinne von «nicht-subjektiv» verstanden, in der Tradition der «écriture automatique». Diese Methode ist laut Schöttler «äusserst aufwendig und kompliziert; sie eignet sich auch nur für den Vergleich von kurzen exemplarischen Texten [...]».
159 Dazu Link, Elementare Literatur, S. 16. Der Begriff des Interdiskurses bezeichnet dann nach Link sozusagen den grössten gemeinsamen Nenner zwischen den vorhandenen Spezialdiskursen (z. B. dem religiöser, juristischer Diskurs usw.). Nach Schöttler, Mentalitäten, S. 107.
160 Sarasin, Diskursanalyse, S. 8.
161 Haslinger, Diskurs, S. 45.
162 Ebd., S. 46ff.; Landwehr, Diskursanalyse, S. 106ff.
163 Sarasin, Subjekte, S. 144; Landwehr, Diskursanalyse, S. 106.
164 in diesem Sinne auch Landwehr, Diskursanalyse, S. 107f.
165 Ebd., S. 108f.
166 Ebd., S. 108ff.; ebenso Haslinger, Diskurs, S. 46f.
167 in diesem Sinne Landwehr, Diskursanalyse, S. 133.
168 Ein Abriss des Forschungsprojekts in Sarasin, Diskurse, S. 147ff.; ausführlich in Sarasin, Philipp: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers, 1765–1914, Frankfurt a. M. 2001.
169 D. h. die Art und Weise, wie Bücher ihre Leser durch Titel, Vorworte etc. auf ganz bestimmte Weise «prädisponieren», Sarasin, Diskurse, S. 147.
170 Vgl. dazu das Vorgehen bei Kuhlemann, Frank-Michael: Bürgerlichkeit und Religion. Zur Sozial und Mentalitätsgeschichte der evangelischen Pfarrer in Baden 1860–1914, Göttingen 2002, S. 232f. Kuhlemanns Diskursanalyse verschiedener Mentalitätsthemen basiert auf der protestantische Presse, d. h. Zeitschriften, Vereinsnachrichten, Mitteilungsblättern etc.
171 Diese 15 Themenkreise sind: 1) Juden, Antisemitismus; 2) Politik, Kirche u. Politik; 3) Armut, Arbeitslosigkeit, soziale Frage; 4) Basels protestantische Kirche, theologische Fakultät; 5) Katholizismus; 6) Nationalsozialismus, Krieg, Hitler; 7) Die eigene Zeitschrift; 8) Personen/Persönlichkeiten; 9) Andere Zeitschriften; 10) Neuer Lebensstil/Gesellschaft/Moderne; 11) Landesstreik; 12) Liebesgaben; 13) Vereinswesen; 14) Die Stellung der Frau in der Kirche; 15) Deutschland, Kirche u. Politik.
172 Eine sehr gute Einführung dazu: Mooser, Josef: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Historische Sozialwissenschaft, Gesellschaftsgeschichte, in: Goertz, Hans-Jürgen (Hg.), Geschichte. Ein Grundkurs, Reinbeck b. Hamburg 32007, S. 568–591; Kocka, Jürgen: Sozialgeschichte. Begriff – Entwicklung – Probleme, Göttingen 21986; Mergel/Welskopp, Kultur und Gesellschaft.
173 Mooser, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, S. 585f.
174 Ebd., S. 586ff.