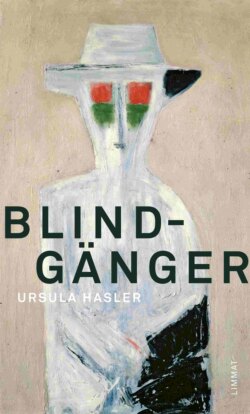Читать книгу Blindgänger - Ursula Hasler - Страница 4
ОглавлениеDie nette Frau, die behauptet, meine Frau zu sein, hat mir gestern das Laptop ihres Mannes mitgebracht.
«Typische Ausdrucksweise von Marty», habe ich an den Rand meiner Gesprächsnotizen unserer ersten Therapiesitzung gekritzelt. Jean-Pierre Marty war ohne Zweifel mein sonderbarster Fall, und an eigenartigen Fällen mangelte es mir beileibe nie.
In weiser Voraussicht hatte ich kraft meiner Autorität als leitender Arzt der Klinik Rychenegg den Fall Jean-Pierre Marty zur Chefsache erklärt. Zu Beginn deutete nichts darauf hin, dass seine Krankengeschichte in irgendeiner Weise ungewöhnlicher wäre als vergleichbare Anamnesen von Gedächtnisverlust. Im Gegenteil, meine Einschätzung der Heilungschancen war aufgrund der neurologischen Abklärungen vorsichtig optimistisch. Dann nahm die Geschichte eine merkwürdige, für mich bis heute kaum nachvollziehbare, geschweige denn medizinisch erklärbare Entwicklung. Ich bin auf der ganzen Linie ratlos, was beim Fall Marty wahr ist, ob irgendetwas wahr ist.
Die erste Sitzung war am Dienstag, 9. September 2003, auf zehn Uhr angesetzt, in meinem Büro im alten Ostflügel der Klinik, in dem jegliche Assoziation mit einer ärztlichen Praxis sorgsam vermieden wird, ein herrschaftlicher Raum mit hohen Fenstern, durch die an diesem Vormittag eine kräftige Septembersonne drängte, in Schach gehalten von unästhetischen, aber äußerst praktischen Hängestoren, die eine subtile Regelung des Lichteinfalls ermöglichen.
Beim Eintreten fiel Martys Blick sogleich auf die Couch, von mir zwar nie gebraucht, aber doch als analytisches Requisit vorhanden. Er wünsche ein gleichberechtigtes Gespräch, face à face.
Ich bat ihn, im Sessel mir gegenüber Platz zu nehmen.
Er sei mit dem festen Vorsatz zur Sitzung gekommen, sich nicht in therapeutische Spielchen verwickeln zu lassen, er wolle klare Antworten auf schwierige Fragen. Ob ich als Psychiater in der Lage sei, seine Lage zu erfassen?
Ich schluckte, die Professionalität gebot mir, vorerst zu schweigen.
Marty sprach jedoch nicht weiter, er saß im Besuchersessel mit Blick auf das Fenster, sah mich unverwandt an und bat nach einiger Zeit, die Plätze zu tauschen.
Er brachte mich ein erstes Mal aus dem Konzept.
Bitte schön, ich erhob mich, schritt um den breiten Glastisch herum und überlegte fieberhaft, welches Spiel er zu spielen beabsichtigte. Nach dem Platzwechsel saß Marty mir gegenüber, hinter dem Schreibtisch auf dem ledernen Therapeutensessel, meinem Sitz, und ich befand mich erstmals auf dem leicht tieferen Klientensessel, eine wesentliche Kleinigkeit. Ich sah Marty und sah ihn nicht, sah auf der andern Seite der spiegelnden Tischplatte im Gegenlicht einen Schattenriss, eine dunkle Silhouette.
Wie weiß man, wer man ist?
Marty hatte eine Weile gewartet, sich zurückgelehnt und die Frage gestellt: Wie weiß man, wer man ist? Was, wenn mit dem Gedächtnis auch das Ich ausgelöscht ist?
Ich schwieg vorsichtshalber, die Fragen stellt eigentlich der Therapeut. Aber auf dessen Sessel saß jetzt Marty.
Hmh, wer kann schon von sich behaupten zu wissen, wer er ist? Die Identität, vielleicht ist sie ein Sammelsurium der Spekulationen über die Bilder, die andere von einem haben.
Es klang wenig überzeugend, ich nahm einen neuen Anlauf.
Eine psychologische Theorie besagt, dass die Identität der Filter ist, der entscheidet, wie Erlebnisse als Erinnerungen gespeichert werden.
Marty zuckte die Schultern. Eben, dann verschwinde logischerweise bei Gedächtnisverlust auch die damit verbundene Identität. Er habe keine mehr.
Seine Hände schoben die Patientenakten auf meinem Tisch umher. Die Sinnlosigkeit der entstehenden Unordnung machte mich ganz nervös.
Wie war einer, der sich so kleidete wie der Besitzer dieser Kleider? Marty zupfte nun an seinem Hemd herum.
Jeden Morgen betrachte er, was ihm in den Kleiderschrank gehängt worden war, und wähle aus. Heute das hellblaue Leinenhemd und die dunkelbeige Twillhose, die Hosen seien ihm übrigens alle ein bisschen zu weit. Da hingen noch feine Cordhosen mit Bundfalten und eine Jeans, weitere unifarbene Hemden, zwei feine Wollpullover, dunkelblau mit Rundausschnitt und dunkelgrün mit V-Ausschnitt, und eine braune Wildlederjacke. Auch drei Schlafanzüge aus bestem Baumwolljersey. Unterwäsche und Socken seien nicht weiter nennenswert. Dass er hier nicht in rotglänzendem Trainingsanzug und klotzigen Sportschuhen mit drei Streifen vor mir sitze, ich muss erstaunt den Kopf gehoben haben, ja, solche Exemplare seien ihm in den Gängen begegnet, das beweise doch nur, abgesehen davon, dass solches nicht im Schrank hänge, dass er, oder müsste er vielmehr sagen: der Besitzer dieser Kleider, damit die Zugehörigkeit und Identifikation mit einer bestimmten sozialen Gruppe signalisieren wolle.
Meine Frage, ob er sich denn unwohl fühle in diesen Kleidern, wusste er nicht gleich zu beantworten.
Keine Gefühle, nein. Ohne Vorstellung einer Identität wisse er schlicht nicht, welcher Kleiderstil ihm entsprechen würde. Also sei es egal, wie er sich zurzeit kleide, er könne genauso gut die Kleider dieses Gymnasiallehrers Marty tragen, offensichtlich ein Feingeist mit ganz gutem Geschmack. Vielleicht auch derjenige seiner Frau.
Marty schwieg, und ich nutzte die Gelegenheit für einen den konventionellen Standard wieder etablierenden Platzwechsel. Auf dem vertrauten Sessel und mit der Sicherheit der hergestellten Ordnung, auch die Patientenakten säuberlich zurück auf einer Beige, lenkte ich den weiteren Verlauf der Therapiesitzung, wie es sich gehörte.
Gut, ich denke begriffen zu haben, dass Ihr Problem nach dem totalen Verlust der Erinnerungen die Frage nach der Identität ist. Ob er sich hier in der Klinik Rychenegg wohlfühle, ob er bereits Gelegenheit hatte, den wunderschönen Park mit dem alten Baumbestand zu erkunden, ich klang schon wie der Marketingfritz unserer Klinik.
Er nickte abwesend.
Ob er mir nicht erzählen wolle, wie er die beiden Tage seit seiner Ankunft verbracht habe? Das ihn überweisende Kantonsspital hatte eine retrograde Amnesie als Folge eines Sturzes mit seitlichem Aufschlagen des Kopfes diagnostiziert. Marty schien aufgrund erster Untersuchungen unter einem kompletten Verlust persönlicher Erinnerungen zu leiden, jedoch ohne Beeinträchtigung der andern Gedächtnissysteme, ich vermutete ein mnestisches Blockadesyndrom des episodischen Langzeitgedächtnisses.
Er nickte erneut. Die nette Frau, die behaupte, seine Frau zu sein, habe ihm gestern Vormittag das Laptop ihres Mannes mitgebracht.
Martys demonstrative Abwehr machte mich hellhörig, er akzeptiere doch, dass keine Zweifel über seine faktische Identität bestünden? Dass er Jean-Pierre Marty sei. Es sei leider nicht zu überhören, wie angestrengt er die Ichform zu vermeiden trachte, wenn er über die Zeit vor dem Gedächtnisverlust spreche. Es höre sich für einen Außenstehenden an, als handle es sich bei Jean-Pierre Marty vor dem 15. August um eine andere Person.
Richtig. Unerwartet erhob sich Marty, beugte sich erregt über den Schreibtisch, ich hätte den Finger treffsicher in die Wunde gelegt. Täglich erwache er in einem ihm komplett fremden Körper. Jeden Morgen putze er sich die Zähne mit dessen Zahnbürste, benutze dessen Rasierer und Rasierwasser, unsicher, ob er den Duft überhaupt möge. Jeden Morgen ziehe er sich die Hüllen des Besitzers dieser Kleider über, selbstverständlich alles frisch gewaschen, schlüpfe täglich in dessen Haut, und manchmal ekle es ihn. Sein Ich sei, er rechnete kurz, genau neunzehn Tage alt, davor steckte ein Jean-Pierre Marty im gleichen Körper, ja, diese Tatsache sei ihm bestens bekannt. Er sei ein Schauspieler, der zwar den Namen seiner Figur kenne, bloß leider das Stück nicht, das gespielt werde.
Ich bat ihn, sich wieder zu setzen. Und weiterzuerzählen.
Ja. Das Laptop liege seither auf seinem Tisch, genau in der Mitte, eine zugeklappte Auster. Er habe Kreise um den Tisch gedreht, wollte es erst öffnen, wenn er sichergehen konnte, nicht mehr gestört zu werden. Nach dem Essen lasse man ihn gewöhnlich in Ruhe. Aber dann habe er nicht gewagt, das Ding zu berühren. Er habe die Balkontür aufgerissen, kühle Luft mit heiteren Geräuschen sei von außen in den Raum geflossen und er habe sich draußen in den Korbstuhl gesetzt, als ihn plötzlich eine unbändige Lust zu rauchen anfiel. Keiner habe ihn vorgewarnt, offensichtlich sei Marty kein starker Raucher gewesen, der süchtige Körper hätte dem unwissenden Kopf sonst längst gezeigt, was er braucht. Hastig habe er einen Schluck Wasser getrunken, überall und jederzeit stünden in der Klinik ja Mineralwasserflaschen und Gläser herum, Wassertrinken als Grundlage und Voraussetzung jeglicher Behandlung, wenn nicht der Existenz überhaupt. Trinken Sie, Herr Marty, Sie haben ja heute noch gar nichts getrunken! Wie oft er das zu hören bekomme, der Wasserstand in der Flasche markiere seine Folgsamkeit oder Rebellion. Die sei schwach, gegen die Überzeugungskraft des Wassers komme er nicht an, also trinke er, soll sich dieses Gehirn, das ihn so schmählich im Stich lasse, doch vollsaugen wie ein Schwamm, besser noch ersaufen im lauwarmen Mineralwasser. Er habe mit der Faust auf das Eisentischchen geschlagen, das Glas sei weggerutscht, auf dem Steinboden zersprungen. Solche Wutanfälle überfielen ihn häufig, unvorbereitet und kurz, vermutlich Hinweis auf eine cholerische Persönlichkeit, nicht wahr.
Ich schüttelte den Kopf, es sei unwichtig, ob er aus der Erinnerung beschreiben könne, was er von seinem Balkon aus sehe.
Marty verzog den Mund, belustigt, ihm sei schon klar, dass ich ihn testen wolle, nur zu. Also, er habe sich ans Geländer gelehnt, es laufe das ganze Stockwerk entlang, bestimmt hundert Meter, auch über die zwei Stockwerke darunter und noch eines über ihm. Eine uniforme Balkonfassade auf der Südseite des Gebäudes, halb transparente, in Eisenrahmen gefasste Glaswände begrenzten die jedem Zimmer zugeteilten Balkonmeter. Vermutlich ehemals ein Kurhotel, nicht wahr, Jahrhundertwende, wie er angesichts der hohen Räume und verzierten Eisengeländer schätze.
Ich nickte.
Im Klinikpark rauschende Eschen oder Ulmen, so gut kenne er die Bäume nicht, aber die Namen tauchten ohne Nachdenken im Kopf auf, wie er mit Erleichterung festgestellt habe. Unten schlängelten sich Wege zwischen mächtigen, in die Jahre gekommenen Büschen. Rhododendren, Azaleen, Hortensien, auch die Sträuchernamen fielen ihm problemlos ein, sein Gedächtnis könne also Schulwissen abrufen, welch lächerlicher Trost.
Ich nickte erneut und notierte: semantisches Gedächtnissystem funktionsfähig.
Er möge den Blick von oben, Personal in weißen Schürzen querte den Park, immer beschäftigt, oder sie taten so, andere Personen spazierten oder ruhten auf Bänken, in der bequemen, das heißt unverkennbar schlabbrigen Bekleidung, mit der sich niemand ins Freie trauen würde, außer im Schutz einer Klinik.
Ich schmunzelte und schrieb: perzeptuelles Gedächtnissystem ebenfalls nicht betroffen.
Die jetzt überall draußen sitzenden Insassen seien Patienten, man werde aber mit professionellem Lächeln, das mit keinem Widerspruch rechne, als Gäste bezeichnet. So viel habe er gelernt. Auch er ein Gast, Aufenthaltsdauer unbestimmt, Ende ungewiss.
Selbstredend enthielt ich mich einer Antwort, schrieb: ausschließlich retrograde Amnesie.
Er wisse, warum er hier sei, und wisse doch nichts. Täglich falle sein Blick beim Aufstehen als erstes auf die Uhr und das leuchtende Datum, beides zu wissen gehöre wohl zur Therapie, Uhrzeit, Datum, unbestechliche Messgrößen für Realität und die stumme Aufforderung an ihn, sie sich zu merken. Das dürfte doch die wirkliche Bestimmung des Digitalweckers sein, nicht wahr. Nicht ihn zu wecken. Jeden Morgen hole ihn eine weiß gekleidete Person mit weißen, leise knirschenden Gesundheitsschuhen aus dem Schlaf. Aus einem schweren, traumlosen, vermutlich medikamentösen Schlaf, man nötige ihn zur Einnahme einer beachtlichen Menge von pharmazeutischen Mitteln. Noch schicke er sich drein, eines nach dem andern, aber zu gegebener Zeit würde er sich genauer mit dem Pharmacocktail beschäftigen.
Ich beruhigte ihn, Wahl und Dosierung der medikamentösen Behandlung seien Teil der Therapie und würden gemeinsam mit ihm beschlossen. Dazu brauche es jedoch genauere Kenntnis meinerseits über seinen eher ungewöhnlichen Fall. Ich bat ihn, nun an den Anfang zurückzugehen, zum Zeitpunkt des Aufwachens aus dem Koma.
Ja, der Anfang seines jetzigen absurden Zustands lasse sich genau festlegen, es begann an jenem Sonntag, dem 24. August, als er im Kantonsspital erwachte, in einem älteren Männerkörper, da gab es nichts zu deuteln. Und kein Ende in Sicht. Der Kopf fühle sich merkwürdigerweise nicht leer an, obwohl da nichts Brauchbares mehr drin war. Marty fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar, diese Geste, sehen Sie, scheint eine typische Handbewegung von mir zu sein. Unverständliche Gesten, unwillkürliche kleine Ticks, er beobachte sich gnadenlos. Ein neugeborener Geist im erfahrungsmüden Körper eines bald Sechzigjährigen. Es sei nicht auszuhalten.
Das Aufwachen aus dem Koma, in dem er nach Aussagen der Ärzte des Kantonsspitals über eine Woche gelegen hatte, war schubweise verlaufen. Nach einigen Anläufen habe er es geschafft, wach zu bleiben, fühlte sich gesund und wusste nicht, weshalb er an Schläuchen angeschlossen in einem Spitalbett lag, an dem ein Schild mit Jean-Pierre Marty hing. Die Pflegerin, deren freundliche Stimme unermüdlich versucht hatte, ihn bei seinen Auftauchern festzuhalten, begrüßte ihn fröhlich, so Herr Marty, diesmal haben wir es geschafft, möchten Sie was trinken? Ja, sein Mund fühlte sich pelzig an. Aber in welchem Irrenhaus war er da gelandet? Warum sie ihn ständig Marty nenne, das Sprechen fiel ihm schwer, die Zunge so dick, er heiße doch … Bleierne Leere im Kopf und keine Vorstellung, wer er war. Ein Panzer lag ihm auf der Brust, er rang nach Luft, bloß weg hier, gleich würde er aus dem Albtraum aufwachen, er sank wieder weg. Die Pflegerin schüttelte ihn unsanft, nicht mehr einschlafen, Herr Marty, bleiben Sie hier. Gut, dann blieb er halt, auch wenn er nicht die geringste Ahnung hatte, wer dieser Marty war und wo er bleiben sollte. Keine Erinnerung. Nichts.
Das wortlose Entsetzen nach dem Aufwachen vermöge er auch jetzt, zwei Wochen später, noch beliebig auszulösen, sobald er den inneren Film wieder ablaufen lasse. Die Leere liege nicht im Kopf, nein, im Herzen, in der Seele, falls es denn so was geben sollte, flaumig weich und nicht zu fassen. Der Geist erwachte in einem unbekannten Leib. Wieder und wieder habe er seine Hände betrachtet, eher schmal, schlanke Finger, die sich Tausende Male gedehnt und die zugepackt hatten, Haut mit Falten und ohne Schwielen, welche Tätigkeit gehörte zu diesem Mann? Jede Minute habe sich im Gedächtnis eingebrannt, das nach dem Neustart, so nenne er das Aufwachen an jenem Sonntag, 24. August, wieder zuverlässig arbeitete, geradezu auf Hochtouren, sich alle Einzelheiten einprägte, wie um das Verlorene bei ihm gutzumachen.
Am Sonntagnachmittag war nach dem Erwachen nur wenig Zeit geblieben, das Ungeheure zu erfassen. Die Ärzte beruhigten ihn, solch temporäre Amnesien könnten nach einem mittelschweren Schädel-Hirn-Trauma wie in seinem Fall auftreten, die Erinnerungen seien in der Regel nach Stunden, manchmal auch Tagen langsam wieder abrufbar. Er solle sich keine unnötigen Sorgen machen, Aufregung sei ganz schlecht, jetzt werde erst mal abgewartet. Kaum hatten die Ärzte die ersten Untersuchungen beendet, öffnete sich die Tür, und eine nicht mehr ganz junge, gutaussehende Frau und ein etwa gleich großes Mädchen stürzten freudig ins Zimmer. Mit knapper Not habe er der Umarmung der beiden fremden Frauen ausweichen können.
Das Drama begann. Stunden, Tage, Nächte vergingen, er marterte sein Gehirn, sprach die Namen Annet und Nadine laut aus, vielleicht gab es über die Ohren einen Zugang zum Gedächtnis, er suchte fiebrig, kein noch so winziges Bildfetzchen blitzte auf, nur graue Flusen, wo einst seine Erinnerungen lagen. Hartnäckig besuchten ihn die Frau und das Mädchen, versuchten alles Mögliche, gemeinsame Erlebnisse, Familienausflüge, Kindergeschichten von Nadine, Vertrautes aus dem Alltag. Sie kamen mit Fotoalben, lieb gewonnenen Gegenständen, Souvenirs. Hilflos und gerührt ließ er alles über sich ergehen, kam gar in Versuchung, Erkennen zu simulieren, die Kleine tat ihm leid.
Er musste unbedingt wissen, weshalb er ins Koma gefallen war. Die Frau hatte ihn in seinem Studierzimmer am Boden liegend gefunden, als sie von der Arbeit kam, an jenem Freitagabend des Jahrhundertunwetters, am 15. August. Beim offenen Fenster in einer Wasserlache. Vermutlich war er ausgerutscht und mit dem Kopf seitlich so unglücklich an der Möbelkante oder am Boden aufgeschlagen, dass er bewusstlos wurde. Ein Rätsel, weshalb er bei dem heftigen Regen das Fenster nicht geschlossen hatte.
Ein Unfall also. Sie fügte an, dass das Laptop lief, als sie ins Zimmer kam, sich jedoch später ausgeschaltet hatte, Akku leer. Die Frau zögerte, nervös, wollte seine Hand ergreifen und brach rechtzeitig ab, er ertrug keine Berührung. Seine Sinne reagierten überscharf, unterfordert, wie sie waren, sie vermochten keinen Eindruck mit Erlebtem zu vergleichen, besonders Geruchssinn und Tastsinn. Die ganze Haut schien ihm in ständiger Alarmbereitschaft.
Der wahre Schock stand ihm noch bevor. Zwei Tage nach dem Aufwachen hatten sie all die hinderlichen Schläuche entfernt und ihn von der Intensivstation auf die Medizin verlegt. Er fühlte sich fit, hatte bloß seitlich eine kleine Platzwunde am Kopf, er konnte aufstehen. So erlebte er beim Betreten der Toilette den zweiten Schlag. Aus dem Spiegel über dem Waschbecken blickte ihn ein Mann an, dem das blanke Entsetzen im Gesicht stand.
Langsam hob er seine Hände, der Unbekannte im Spiegel fixierte ihn. Er sah, wie beide Hände über die stoppeligen Wangen strichen, die Haut noch mit einer Sommerferienrestbräune, die Mundwinkel zuckten, die Finger pressten auf jeder Seite die Schläfen, die Augenlider flatterten kaum merklich, der Mann im Spiegel hatte auffällig blaugrüne Augen. Die Finger spreizten sich und strichen die dunklen, bereits stark angegrauten Strähnen zurück, die ins Gesicht fielen. Ein Haarschnitt war überfällig.
Er schloss die Augen, gab dem Mann im Spiegel drei Sekunden, um zu verschwinden, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. Der Mann hatte sich nicht geregt, blickte ihn unverwandt an, nun eher neugierig. Ich. Nein.
Er begriff zum ersten Mal die volle Bedeutung des Wortes Gesichtsverlust. Genau genommen hatte er nicht sein Gesicht verloren, sondern ein unbekanntes gefunden. Was auf dasselbe hinauslief. Die Physiognomie eines Mannes in den sogenannt besten Jahren. Der Spiegelmann sah recht gut aus, feingeschnittene Gesichtszüge, er gefiel ihm. Glücklicherweise. Aber ich bin es nicht.
In den folgenden Tagen hatte er beim Rasieren stundenlang auf das Spiegelbild gestarrt, prägte sich Hautporen, Bartstoppeln, Hautfalten ein. Jeden Quadratzentimeter musste er sich aneignen, die Falten füllen mit Erfahrungen, das Erlebnis erfinden, das mit der kaum sichtbaren Narbe an der Unterlippe geendet hatte. Man brachte ihm mit fragendem Blick den zweiten Spiegel, um den er gebeten hatte. Mit der Verdoppelung des Spiegelbildes würde er den Mann so sehen, wie die andern ihn sahen. Das Bild des Bildes schafft erst die Wirklichkeit. Doch es half nicht, der andere blieb ein Anderer, täglich wusch er unvertraute Haut, rasierte einen Fremdling und fuhr mit dem Kamm durch den Haarschopf eines völlig Unbekannten.
Frau und Tochter schwankten zwischen Verzweiflung und Zweifel, Unglauben, Zuversicht und Ratlosigkeit. Nichts konnte er tun, er begriff, dass der Albtraum jeden Morgen erneut beginnen würde. Selbst der unerschütterliche Optimismus der Ärzte zeigte Risse, immer öfter besprachen sie sich bei der Visite so, dass er kein Wort verstehen konnte. Sie ordneten neue oder ergänzende Untersuchungen an, Elektroenzephalogramm, Computertomografie, prüften seine Verarbeitung von Reizen, während er Bilder eines unbekannten Hauses und von fremden Leuten betrachten musste. Natürlich löste das keine emotionalen Reize in seinem Gehirn aus, wie sollte es auch.
Man meinte etwas hilflos, dass die Wissenschaft seinen Zustand sehr wohl einzuordnen und zu benennen wisse, nämlich retrograder, das heiße rückwirkender Gedächtnisverlust, ausschließliche Störung des episodisch-autobiografischen Gedächtnisses, normale Funktion der Gedächtnissysteme für Motorik, Priming, Perzeption, Semantik. Kurz, mit Ausnahme der persönlichen Erinnerungen funktionierte sein Gedächtnis einwandfrei, er wusste, wie Geräte zu bedienen waren, kannte belanglose Jahreszahlen, die Namen von unwichtigen Politikern und konnte auf Bildern Schädlinge korrekt bezeichnen. Man könne sich medizinisch jedoch nicht plausibel erklären, weshalb seine nur mittelschwere und mittlerweile wieder ausgeheilte Gehirnerschütterung die anhaltende Amnesie induziere. Eine allfällige psychogene Ursache werde nicht mehr ausgeschlossen.
Als er das gehört habe, sei ihm nur noch Sarkasmus geblieben.
Ich sah in Martys Blick bodenlose Verzweiflung. Wieder seine Geste mit beiden Händen im Haar, nach vorn gebückt.
Der ganz persönliche Erinnerungsschatz, die unwiederbringlichen Erlebnisse aus einem achtundfünfzigjährigen Leben, sein Alter hatten sie ihm sagen müssen, alles weg. Verschwunden. Und mit ihnen auch die Gefühle. Alles auf einen Schlag unzugänglich, was er in seinem Lebensarchiv abgelegt und vermeintlich mittels Erinnerungen gesichert hatte. Zugriff verweigert. Was bloß habe der «Andere» getan, dass das Gehirn zu einem solchen Radikalschnitt gezwungen wurde. Und ihn als Ahnungslosen schutzlos ins Leben zurückgeworfen habe.
Jetzt wollte ich die Sache ansprechen. Ob er es auch so ausdrücken könne: Ich, was bloß habe ich getan, dass mein Gehirn jegliche Erinnerung daran blockiert?
Er schüttelte den Kopf, er habe kein Bild eines Ichs. Und schuld an seiner Misere jetzt sei doch eindeutig der frühere Andere, nicht sein frisch geborenes Ich, oder?
Ich schwieg, beunruhigt, eine merkwürdige Abspaltung, vermutlich notwendig, um nicht auch noch die Schuld am Gedächtnisverlust tragen zu müssen, die Verantwortung dafür lag beim «Anderen». Im Auge behalten.
Es sei ihm schlicht unmöglich gewesen, nach dem Krankenhaus, aus dem sie ihn nach drei Wochen entlassen hatten – organisch sei alles in Ordnung –, an den Ort zurückzukehren, den die Frau und das Mädchen als Zuhause bezeichneten, wo er ihren beharrlichen Bemühungen, mit allen Mitteln sein Gedächtnis zu wecken, hilflos ausgeliefert gewesen wäre. Deshalb habe er sich für eine nachbehandelnde Therapie hier in die Klinik Rychenegg einweisen lassen, bekannt für Behandlungen von posttraumatischen Störungen, auf Empfehlung einer jüngeren Oberärztin im Kantonsspital. Er brauche einen neutralen Ort, ohne den Druck von scheinbar vertrauten Gegenständen, sowie Zeit. Zeit herauszufinden, wer der «Andere» war, dieser Kerl mit Namen Jean-Pierre Marty. Warum er ihm diese Amnesie eingebrockt habe.
Meine Worte wog ich mit wissenschaftlicher Vorsicht ab. Es bestehe durchaus Hoffnung, dass sich durch Gedächtnistraining und spezifische Therapien die Erinnerungen wieder schrittweise öffnen lassen. Das episodische Langzeitgedächtnis sei ja nicht organisch gestört, nur der Zugang blockiert.
Marty zweifelte, er habe Angst vor weiteren Streichen seines Gehirns. Die Panik, eines Morgens wieder in einem unbekannten Zimmer zu erwachen und erneut mit einem fremden Namen begrüßt zu werden, begleite ihn hartnäckig.
Ich schlug vor, ihn für eine PET/CT-Untersuchung in das Universitätsspital Zürich zu überweisen, und erklärte auf seinen skeptischen Blick, dort sei dieses neue bildgebende Verfahren zur Sichtbarmachung der Stoffwechselprozesse in den verschiedenen Hirnarealen vor zwei Jahren weltweit erstmals klinisch eingesetzt worden. Ein hervorragendes diagnostisches Verfahren, um die Aktivität von Hirnzellen über Stoffwechselvorgänge sichtbar zu machen.
Marty nickte, gut, einverstanden.
Jetzt Hausaufgaben auf die nächste Sitzung, das sei ihm als Lehrer bestimmt vertraut. Ich bat ihn alles aufzuschreiben, was er über sein früheres Leben in Erfahrung bringen könne, Fakten, aber ebenso eine Charakterisierung seiner Persönlichkeit durch seine Familie.
Sie meinen wohl über diesen Unbekannten namens Jean-Pierre Marty; er zweifle, dass das etwas bringe, aber er tue sein Bestes.
Noch am selben Nachmittag suchte ich Marty in seinem Zimmer auf, seine Frau hatte am Mittag beim Empfang eine Plastiktüte für ihn abgegeben. Ich öffnete auf sein Herein wohl etwas schnell die Tür, Marty schloss ertappt den Kleiderschrank.
Ach, warum sollen Sie es nicht wissen, und er zog mit einem kräftigen Ruck die leicht klemmende Schranktür wieder auf, an deren Innenseite der Spiegel hing. Er vermöge an keinem Spiegel vorbeizugehen, ohne kurz das Gesicht zu prüfen. Was, wenn ihn unerwartet wieder ein anderer, neuer Unbekannter anstarrte? Er beruhige sich jeweils erst, wenn er den gleichen vertrauten Fremden erblicke.
Keine Sorge, ich stellte die prall gefüllte Tüte auf den Stuhl, es gebe wahrlich schlimmere Zwangshandlungen, und die seinige sei durchaus nachvollziehbar. Ich wies auf die Tüte, die habe er laut Aussage seiner Frau so aus Royan zurückgebracht nach seinem dreimonatigen Weiterbildungsurlaub und seither offensichtlich nicht mehr angerührt. Ich überreichte ihm auch einen Brief, der in seinem Postfach lag. Postbote zu spielen zählte zwar nicht zu meinen Kernaufgaben, diente diesmal aber als praktischer Vorwand, ich wollte mit Marty besprechen, wie er mit den Inhalten seines Laptops umgehen solle, meines Erachtens eine heikle Angelegenheit.
Er riss den an Jean-Pierre Marty adressierten Brief auf. Das Gefühl, unrechtmäßig fremde Post zu lesen, verlasse ihn nicht. Briefpapier des Rektorats der Kantonsschule, unterschrieben von der Rektorin, die Jean-Pierre Marty duzte, eine offizielle Mitteilung, aber in herzlichem Tonfall, die beiden schienen sich seit Langem und bestens zu kennen. Seine Beurlaubung aus Krankheitsgründen sei vom Personalamt des Kantons bis nach den Herbstferien am 20. Oktober bestätigt worden, danach würde man weitersehen. Sie schicke ihm die Besserungswünsche aller Kolleginnen und Kollegen, man respektiere seinen Wunsch, keine Besuche zu erhalten. Marty rechnete, ihm blieben sechs Wochen. Entweder er würde die Gedächtnisblockade lösen oder genug über diesen Jean-Pierre Marty in Erfahrung bringen, um zu entscheiden, ob er dessen Leben weiterführen wolle. Was, wenn nicht? Gab es eine dritte Option, ein neues Leben ab achtundfünfzig ohne Erinnerung? Kann man die Zukunft gestalten, ohne eine Vergangenheit zu haben?
Er ließ sich in den Lehnstuhl fallen, die Finger strichen über den dunkelgrünen, an einigen Stellen abgewetzten Samt, immer gegen den Strich. Er sitze oft hier und betrachte sein Zimmer, ein helles Eckzimmer, auf der Südseite der große, gedeckte Balkon, auf der Westseite ein weiteres Fenster, durch das jetzt bereits die blasse Nachmittagssonne schien. Er traue seinem neuen Gedächtnis keine Sekunde und präge sich zum wiederholten Mal alle Details ein. Sein Kopf arbeite jetzt ohne Ballast der Erinnerungen logisch und effizient. Welch eine Ironie, nicht wahr.
Mein Blick fiel auf den Tisch, das Laptop lag in der Mitte, nach wie vor geschlossen. Wie er das Material sichten wolle? Gemäß Aussagen seiner Frau habe er auf dem Laptop immer schon eine Art Tagebuch geführt. Er müsse darauf gefasst sein, dass seine eigenen Texte, ganz besonders die Mails der vergangenen Monate, unter Umständen unerwartete Reaktionen provozieren könnten. Weiter wies ich ihn darauf hin, dass im Haus weder Mobiltelefone noch Laptops erlaubt, die Zimmer ohne Internetzugang seien. Sein Laptop habe er dank einer Ausnahmebewilligung erhalten, als Teil der Therapie. Und dass ich den Prozess des Auswertens eng zu begleiten wünsche.
Ich klang wohl etwas autoritär, Marty erhob sich, ergriff die Plastiktüte und leerte sie kurzerhand über dem Bett aus, wild flatterten Zettel und Prospekte heraus, landeten auf dem Boden.
Marty hatte während seines Sabbaticals in Royan alles gesammelt, Restaurantrechnungen, Busfahrscheine, Mietvertrag der Wohnung und Quittungen für bezahlte Mieten, unzählige Prospekte über Royan und sehenswerte Orte der Umgebung, Programme von Aktivitäten, mehrere gleiche Stadtpläne mit markierten Stellen, Michelinkarten der Gegend und Region in allen Maßstäben, Ausleihscheine der städtischen Bibliothek. Zahlreiche Ausdrucke von Webseiten und Onlinetexten, alle zu Themen aus dem Zweiten Weltkrieg. Marty blätterte sie flüchtig durch, Leben unter deutscher Besatzung, Bau des Atlantikwalls, Wehrmachtsbordelle, obligatorischer Arbeitsdienst in Deutschland, Befreiung und Epuration, Kollaboration. Sogar ein dickes Bündel gehefteter Fotokopien, es sah aus wie ein komplettes Buch, mit vielen Fotos von Bombardierungen und zerstörten Städten.
Was soll ich damit? Er schob alles achtlos zusammen und legte den Haufen auf die Kommode.
Vielleicht ergebe alles Sinn, wenn er den Inhalt des Laptops kenne.
Er nickte und strich mit der Hand über die grauschimmernde Oberfläche, wie wusste er, wie es zu bedienen war? Gestern habe ihm das Mädchen einen CD-Player und Musik mitgebracht, die der Vater gerne hörte. Musik könne ebenfalls durch Blockaden dringen. Nichts, er habe ihr nicht zu sagen gewagt, dass er mit dieser Art von Musik – Funky-Jazz, hatte sie ihn belehrt – beim besten Willen nichts anfangen konnte. Aber er habe den CD-Player problemlos zum Funktionieren gebracht, vielleicht klappe es auch mit dem Computer. Er öffnete den Laptopdeckel, entnahm der Tasche Netzkabel und Maus, die Frau hatte an alles gedacht. Es sei ihr nicht gelungen, sich einzuloggen, das Passwort stimme nicht mehr, mit diesen Worten habe sie ihm das Laptop übergeben. Die vorwurfsvolle Verärgerung in ihrer Stimme sei unüberhörbar gewesen, der Inhalt des Laptops war also nicht für die Augen der Frau bestimmt, der Besitzer hatte vorgesorgt. Er zögerte, auf den Startknopf zu drücken, etwas Lauerndes gehe vom Laptop aus.
Und wenn ihm nun das Passwort nicht einfalle, wo speichert das Gehirn ein Passwort?
Nicht nachdenken, einfach tun, schärfte ich ihm ein, Routinebewegungen seien direkt mit dem prozeduralen Gedächtnissystem verbunden.
Also steckte er geschäftig, Spiel der Muskeln gegen Leere im Gedächtnis, das Netzkabel ins Laptop und in die Steckdose, hängte die Maus an, drückte auf den Startknopf, starrte auf die herunterlaufenden Programmierzeilen, die Einlogmaske, tippte Namen und Passwort ein, ohne Nachdenken, es glückte, er war erleichtert.
Bloß verunmögliche der Trick, dass er das Passwort jetzt kenne.
Ich schob ihm einen Zettel zu, hatte ihm beim Einloggen über die Schultern gesehen, außergewöhnliche Situationen legitimierten leicht unkorrekte Methoden. Er könne es ja jetzt erneut ändern. Marty grinste dankbar.
Das Desktopbild zeigte eine lang gezogene Meeresbucht mit kargem Strand und mächtiger Düne dahinter. Im Sand lagen verschiedene Ordner verstreut, er entschied sich für ROYAN und klickte den Ordner an. Er bemerkte nicht mehr, wie ich das Zimmer verließ.
Auch das prozedurale Gedächtnissystem konnte ich somit abhaken, funktionierte alles. Obwohl es laut seiner Frau in den letzten Monaten vor dem Sturz keinerlei außergewöhnliche Vorkommnisse gegeben hatte, abgesehen von seinem Weiterbildungsaufenthalt in Frankreich, war auch ich je länger je mehr von einer psychogenen Ursache von Martys Amnesie überzeugt.
Ich kann mittlerweile auf über zwanzig Jahre ärztliche Tätigkeit in der renommierten Privatklinik Rychenegg zurückblicken, davon die letzten zehn Jahre als Chefarzt der psychiatrischen Abteilung, eine Position, die ich, daran ist kaum zu zweifeln, meiner Expertise für alle Formen von Störungen des Erinnerungsvermögens verdanke. Seit meiner ersten Begegnung noch als Oberassistent mit einer Amnesiepatientin faszinieren mich die Kapriolen des Gehirns. Als Psychiater und Psychotherapeut begegne ich dem menschlichen Gehirn mit größtem Respekt, und als Amnesiespezialist unterschätze ich in keiner Weise dessen Fähigkeiten, bei Bedarf passende Realitäten zu erschaffen oder störende Wirklichkeiten auszuschalten. Auch mein Psychiatergehirn verdrängt erfolgreich, wie anmaßend es doch ist, mit dem eigenen Denkwerkzeug das Funktionieren dieses Werkzeugs bei andern beurteilen zu wollen. Welch Größenwahn des menschlichen Gehirns, sich selbst verstehen zu wollen.
Meine intensive Beschäftigung mit den Manipulationen der Gedächtnisfunktionen durch das, was wir Bewusstsein nennen, trug mir in der Folge zahlreiche, von Kollegen in Kantonsspitälern überwiesene Amnesiefälle zu. Die im Laufe der Jahre entwickelte Spezialisierung fand ihren Niederschlag auch in meinen stark beachteten Fachartikeln zum Thema. Die Klinik Rychenegg gilt nicht zuletzt dank meines Renommees in Fachkreisen, ich darf dies in aller Bescheidenheit anmerken, landesweit als erste Adresse für komplexe Fälle jeglicher Art von funktionellen Gedächtnisstörungen. Zum großen Bedauern der Klinikleitung leider kein lukrativer Geschäftszweig.
Rychenegg erlebte in den vergangenen Jahren eine starke Expansion. Das Klinikmanagement hatte, gemäss Eigeneinschätzung, dank weitsichtiger Marketingstrategie auf dem boomenden Markt psychosomatischer Erkrankungen und Stresssyndrome, man denke an Burn-out, rechtzeitig in ein Image von Exzellenz investiert. Oder um es mit den Worten der in unserer Institution ein- und ausgehenden Consultants auszudrücken: Als Privatklinik ohne öffentlichen Leistungsauftrag fokussieren wir ärztliche Dienstleistungen auf psychische Störungen mit hoher Renditeerwartung. Die Behandlung meiner unrentablen, aber medizinisch interessanten Amnesiefälle rechtfertige ich gegenüber dem Direktor durch Querfinanzierung mit einträglicheren Therapien. Und auch diese gut zahlende Klinikgäste sind schließlich Patienten, so jedenfalls bringe ich meine idealistische Bedenken jeweils erfolgreich zum Schweigen.
Die zweite Sitzung, an der ich mich zu meinem ziemlich ungewöhnlichen Therapievorschlag hatte hinreißen lassen, fand eine Woche später wiederum in meinem Büro und wiederum um zehn Uhr statt.
Marty brachte ein Notizheft in der Art von Schülerheften mit. Hausaufgaben erledigt dank intensiver Gespräche mit der Frau und dem Mädchen, ob ich zuerst die Fakten oder die gesammelten Bemerkungen zur Persönlichkeit von Jean-Pierre Marty hören wolle.
Die Fakten.
Er blätterte kurz im Heft und schob es mir mit der betreffenden Seite geöffnet zu.
Ob er es bitte laut lesen würde? Ich wollte auf feinste Veränderungen in Stimme und Intonation achten.
Marty überflog seine Notizen, obwohl er sie bestimmt auswendig kannte, und räusperte sich so gründlich, dass das anfänglich verhalten kratzende Geräusch sich bald zu einem veritablen Husten auswuchs. Er las mit reichlich belegter Stimme.
– Jean-Pierre Marty, geboren angeblich am
31. März 1945, tatsächlicher Geburtstag und -ort
unbekannt, französisches Kriegswaisenkind, adoptiert von Hanspeter und Elisabeth Marty
– erfuhr erst als Dreißigjähriger durch Zufall, dass adoptiert
Er blickte auf, die Frau habe ihn irgendwie lauernd beobachtet, als sie das erzählte, als habe sie einen Erinnerungsdurchbruch erwartet, natürlich vergeblich.
Ich bat ihn fortzufahren.
– Kindheit in Murten, Vater Direktor der örtlichen Kantonalbank, Mutter Hausfrau, aufgewachsen mit vier Jahre älterem Stiefbruder Daniel Marty, leiblicher Sohn von Hanspeter und Elisabeth Marty
– Vater 1993 gestorben
– 1965–73 Studium, Romanistik und Geschichte
an der Universität Bern, Abschluss mit Doktorat, erste Stellen als Hilfslehrer an Gymnasien in Bern und in Biel, 1980 Wahl zum Hauptlehrer für Französisch und Italienisch an der Alten Kantonsschule Aarau. Tätig dort als Gymnasiallehrer bis heute
– Verheiratet seit 1983 mit Annet Uttenberg, geb. 25.11.1953 (verbürgt!) in Hamburg, hat Betriebswirtschaft studiert, leitet das Marketingteam
bei einer mittelgroßen Softwarefirma in Aarau, kennengelernt im September 1979 bei der Weinlese in Südfrankreich, Frau zog 1982 in die Schweiz
– 19. Oktober 1986 Geburt von Nadine, einziges Kind (warum keine weiteren?)
– Familie wohnt seit Sommer 1987 in Einfamilienhaus, alternative Wohnsiedlung, in ehemaligem Bauerndorf, heute zersiedelter Vorort, enge, zuverlässige (??) Nachbarschaft
– wichtig die letzten Monate: drei Monate Weiterbildungsurlaub von Mai bis Anfang August in Royan, französische Atlantikküste, Auszeit, wollte über den Atlantikwall und die deutsche Besatzungszeit in Frankreich recherchieren. Besuch der Frau ab Mitte Juli und gemeinsame Heimreise. Verbrachte die Tage bis Beginn des neuen Schuljahres mit Unterrichtsvorbereitungen
– Sturz am Freitag, 15. August (letzter Ferientag, Montag, 18. August Schulbeginn – Zusammenhang?)
Nach dem anfänglichen Husten vermochte ich keine Regung mehr aus seiner Stimme herauszuhören, Marty las die Angaben zu seinem Leben unbeteiligt, beinahe gelangweilt.
Ein fades Leben, er frage sich, ob es sich lohne, die Erinnerungen dieses Langweilers zu finden, ob es überhaupt etwas zu finden gebe. Das einzig Bemerkenswerte vielleicht die unbekannte Herkunft, ein ziemlich auffälliges Detail in dieser banalen Biografie.
Ich ging nicht darauf ein. Wie das Gespräch mit seiner Frau denn verlaufen sei?
Während er vom letzten Besuch seiner Frau erzählte, spielten seine Hände unaufhörlich mit dem Notizheft, rollten es ein, ließen es dank sperrigem Material wieder aufspringen, drehten den Zylinder wieder enger, er schob die Rolle von der linken in die rechte Hand und zurück, unaufhörlich.
Sie hätten ins Städtchen spazieren können, er war schließlich nicht in einer geschlossenen Anstalt. Jedoch die Vorstellung von Menschenmengen sei ihm nach wie vor unerträglich. Jegliche Situation draußen im Leben sei eine mögliche Ursache für Panik, er wisse nie, ob er intuitiv richtig reagieren würde. Sie seien also im Klinikpark spazieren gegangen, schlenderten langsam über die Kieswege, auch der Park hielt am frühen Nachmittag Siesta, weder Angestellte, die jetzt ihre übliche lange Mittagspause hielten, waren zu sehen noch andere Gäste, er halte sich an die offizielle Namensregelung, die hatten sich in ihre Zimmer zurückgezogen. Die Wege gehörten ihnen.
Er habe bei jedem Schritt sorgfältig darauf geachtet, einen ausreichenden Abstand zu seiner Begleiterin einzuhalten, um auch eine unbeabsichtigte Berührung ihrer unbekleideten Arme zu verhindern. Es war spätsommermild, er trug die Wildlederjacke an einem Finger über die Schulter geworfen. Die Distanz war so austariert, dass sie als zusammengehörend wirkten, aber für eine Berührung hätte einer von ihnen den Arm ausstrecken müssen. Die Faktenlage war nicht zu diskutieren, er war Jean-Pierre Marty und die Frau, die ebenfalls nicht sehr locker neben ihm herschritt, somit seine Ehefrau.
Er blickte sie verstohlen an, manchmal auch unverhohlen. Bald fünfzig wurde sie also, wirkte aber eindeutig jünger. Ihr sportlicher Stil, auch das fahlblonde Haar, mittellang und gerade geschnitten, gefiel ihm. Was sie beruflich machte und ihre gemeinsamen Lebensfakten kannte er bereits, sie schien mit beiden Beinen im Leben zu stehen.
Ihre beiden Körper kannten sich also seit einem Vierteljahrhundert, vertraut durch viele Umarmungen, anfänglich bestimmt leidenschaftlich. Und heute? Mochten sich, begehrten sich ihre aneinander gewöhnten Körper noch? Schliefen sie noch zusammen? Er habe seine Begleiterin unbemerkt gemustert, er konnte sie ja nicht unverblümt danach fragen. Wie hatte er sie verführt? Mochte er ihre Brüste? Wie fühlte sich die Haut ihrer Schenkel an? Er versuchte sich seinen Körper verschlungen in ihren vorzustellen. Nichts, keine Fantasien formten sich. Keine Regung, nur sein Rücken wurde steif. Er wäre ziemlich nervös geworden, hätte er nicht mittlerweile die Bestätigung, dass bei ihm physisch alles noch funktionierte.
Unter Männern könne er ja darüber reden, das habe ihn stark beschäftigt, klappte diesbezüglich noch alles bei diesem fremden Körper, in dem er steckte. Nach dem Aufwachen aus dem Koma sei, obwohl er sich körperlich fit fühlte, tagelang alles schlaff geblieben. Es brauchte einige Überwindung, bis er das Thema im Spital anzusprechen gewagt hatte. Der Arzt hatte ihm augenzwinkernd einschlägige Magazine zugesteckt, das buche er unter Therapie ab. Auch Sexualität sei eine Frage der Bilder im Kopf, die ihm eben fehlten. Er habe die Fotos eingehend studiert, Schmollmünder, verkeilte Leiber, Zoom auf erigierte Körperteile und Öffnungen. Dasselbe in der nächsten Bildstrecke und wieder in der nächsten, nur andere Blickwinkel und andere Körper. Nichts zu machen. Fußballbilder aus dem Sportteil der Zeitung erregten ihn fast mehr. Der Arzt riet zur Geduld. Die Angelegenheit beunruhigte ihn jedoch zutiefst.
Bis er hier in der Klinik eines Morgens von einer neuen Pflegerin geweckt worden sei, einer Wochenendvertretung, er hatte sie noch nie zuvor bemerkt. War es die Leichtigkeit ihrer Schritte, die Anmut ihrer Armbewegung, als sie die Vorhänge aufzog, das Maliziöse in ihren Augen oder ihr reizendes Lächeln? Jedenfalls strahlte die Frau, als Person interessierte sie ihn keineswegs, eine Erotik aus, auf die sein Körper in Sekundenschnelle reagierte. Völlig überrumpelt von dieser unbekannten, aber lange erwarteten Empfindung habe er instinktiv die Decke hochgezogen, ihr ziemlich betreten einen guten Morgen gewünscht. Alles in Ordnung, alles bestens.
Aber seine Reglosigkeit jetzt bei der Frau, die seit zwanzig Jahren seine Ehefrau war, bedeutete wohl, dass in der Ehe zwischen den beiden nicht alles in Ordnung war. Dass in dieser Hinsicht nicht mehr viel los war. War es denkbar, eine Ehe ohne jegliche sinnliche Anziehung weiterzuführen? Vielleicht reichten ja im Normalfall langjährige Zuneigung und die Erinnerung an vergangene Leidenschaft. Nur fehlte ihm beides. Also war es schwer denkbar.
Die mittägliche Leere im Park zwang die beiden einzigen Spaziergänger zusammen, gerne wäre er jetzt durch Entgegenkommende abgelenkt worden, wäre mit einem Lächeln ausgewichen. Er dankte seiner Begleiterin höflich, was eher einer Fremden gegenüber angebracht war, dass sie sich den Nachmittag freigenommen und so schnell gekommen war. Er hoffe auf ihre Hilfe, viele der tagebuchartigen Aufzeichnungen von Marty auf dem Laptop seien für ihn unverständlich, beruhe auf Wissen, das er nicht habe.
Sie hielt den Blick konzentriert auf den Weg gerichtet, hob die Schultern, er solle fragen.
Weshalb ihr Mann diesen Weiterbildungsurlaub gemacht habe und warum gerade in Royan?
Schon die erste Frage könne sie nicht beantworten. Ihre Stimme klang leicht bitter. Das Sabbatical nach über zwanzigjähriger Lehrtätigkeit war dein Recht und die Chance auf eine Auszeit. Das Unterrichten befriedigte dich seit einiger Zeit nicht mehr. Dann war irgendein Vorfall in der Schule, darüber wolltest du aber nie sprechen. Wie immer. Ziemlich sicher hast du auch eine andere Auszeit gesucht, Eheferien, Abstand von mir. Jedenfalls hast du mir nie angeboten mitzukommen, wenigstens für einen Teil der Zeit.
Es habe ihn ziemlich irritiert, so direkt angesprochen und mit unterschwelligen Vorwürfen konfrontiert zu werden, die den Andern betrafen. Der Abstand zwischen ihnen vergrößerte sich merklich. Er hakte nach. Und darüber habe es zwischen ihnen keine Diskussion gegeben?
Sie zögerte, offensichtlich auf der Hut, sie wusste ja nicht, ob er davon in den Aufzeichnungen gelesen hatte. Im vergangenen Herbst sei er erstmals mit der Idee gekommen, einen Weiterbildungsurlaub zu beantragen, habe dabei die Möglichkeit, dass sie mitkommen könnte, mit keinem Wort auch nur angedeutet. Du hast diese Option mit einer Bestimmtheit ausgeschlossen, die nicht einmal zuließ: Es wäre schön gewesen wenn. Die Kränkung brodelte wochenlang wie Gift in mir, nachher war ich zu stolz, selber den Vorschlag zu machen, ich hätte gut vier Wochen unbezahlten Urlaub nehmen und Nadine in dieser Zeit bei ihrer Freundin Lea wohnen können. Es war klar, du hast allein gehen wollen. Nadine und ich sollten im Juli nachkommen und als Abschluss wollten wir alle gemeinsam die Sommerferien dort verbringen. Ich bin gefahren, aber Nadine hat es vorgezogen, den Urlaub mit Freunden zu verbringen. Du warst sehr aufgebracht.
Er vermied es, sie anzublicken, bereits zum dritten Mal bogen sie nun in den Weg ein, der sich zwischen ausladenden Rhododendrenbüschen windend zur Lichtung mit der Statue führte. Es war unwichtig, welchen Weg man einschlug, irgendwann kam man in diesem Park immer an den Ausgangspunkt zurück. Was sie mit Eheauszeit gemeint habe?
Die Frau war unzufrieden mit ihrer Ehe, er sei immer ausgewichen, seine Absicht, ohne sie zu fahren, hatte sie so gedeutet. Sie hoffte auf einen Neuanfang, das einzig Positive, das sie seinem Urlaub abgewinnen konnte. Wenn schon mehr als zwei Monate allein zu Hause mit der pubertierenden Tochter, mit Arbeit, Haus, Garten, wollte sie herausfinden, ob sie alles alleine schaffe, als Rückversicherung. Dass sie sich nicht aus Angst vor dem Alleinsein an eine Beziehung klammerte, die es nicht mehr wert war. Sie rechnete sehr wohl mit der Möglichkeit, dass die mehr als zehnwöchige Trennung ihre Beziehung nicht wiederbeleben, sondern die Entfremdung besiegeln könnte.
So war das also, er habe endlich begriffen, warum seine Amnesie mehr Ratlosigkeit als Verzweiflung bei der Frau auslöste. War es möglich, dass sie sich bereits getrennt hatten, dass da andere Beziehungen waren, sie, oder er? Was, wenn der Andere eine Affäre hatte, die jetzt irgendwo verzweifelt auf Nachricht wartete? Es ließe sich manch hübsches Melodrama zusammenfantasieren. Aber kann eine Beziehung weitergeführt werden, wenn der eine die Geschichte der Beziehung kennt, der andere nicht? All die Paare, die nur noch von der Geschichte ihrer Liebe leben. Was bleibt nach zwanzig Jahren Ehe, wenn die Erinnerung weg ist und nicht wieder kommt? Nur ein Neuanfang, aber dazu müsste er sich neu in die Frau verlieben. Er war weit weg davon.
Und, wie kam es heraus? Er habe sie direkt gefragt.
Darüber wolle sie nicht sprechen, das finde er bestimmt in aller Ausführlichkeit in seinen eigenen Aufzeichnungen. Sie beschleunigte ihre Schritte, sodass sich der Abstand zwischen ihnen wieder vergrößerte. Der Kiesweg bog um die Büsche und endete vor dem Herrn Kurhoteldirektor. Sie blieb stehen, die Gründerfigur des ehemaligen Kurhotels in Überlebensgröße mit steinernem Gehrock, Stock und Hut in der Hand, ein patriarchalisches Lächeln unter dem majestätischen Bart, mit festem Blick in die erfolgreiche Zukunft. Nase, Stirn und Haar weiß gefleckt, jahrzehntealter Taubendreck, dem auch der Regen nichts mehr anzuhaben vermochte. Der Herr Kurhoteldirektor trug es mit Würde. Kam ohnehin selten einer bis in die hinterste Parkecke. Sie drehten um, nur ein Weg führte weiter, im großen Bogen zurück. Die Baumwipfel rauschten, unten zwischen den Büschen war es angenehm windstill, auch heute keine Fernsicht, in großer Höhe zogen dunkle Wolken über den weißen Himmel.
Marty blickte mich leicht verunsichert an, die Notizheftrolle mit beiden Händen umklammert. Sie habe gezögert, ihren Mann zu beschreiben, auf der Hut, in ihren Augen habe er Zweifel an seinem Gedächtnisverlust gelesen. Es scheine viel Misstrauen zwischen ihr und dem Mann gegeben zu haben. Ihm sei klar geworden, dass sie ihm genau das erzählen würde, was er denken solle. Jetzt hatte sie die Gelegenheit, ihrer beider Ehevergangenheit ganz nach ihren Absichten und ohne Protestmöglichkeit seinerseits zu beschreiben. Beim Sprechen habe sie Augenkontakt vermieden. Er habe in ihrer Stimme viel enttäuschte Erwartungen gehört, wenn auch das, was sie über ihren Mann sagte, eher nach Nichts-Schlechtes-über-einen-Toten-sagen als nach ehrlicher Meinung klang.
Sie sei sichtlich verunsichert gewesen, ob sie im Präsens oder in der Vergangenheitsform über ihn reden sollte. Ja, was kann ich dazu sagen, du entzogst, also du entziehst dich erfolgreich allen nachbarschaftlichen Annäherungen und den damit verbundenen Verpflichtungen, die sozialen Kontakte pflege vor allem ich. Auch um die Erziehung der Tochter kümmere ich mich in erster Linie, du bist zwar körperlich anwesend, geistig aber meist anderswo. Eigentlich genau wie jetzt, fügte sie bitter an. Irgendwann habe sie aufgehört zu fragen, was er eigentlich ständig lese und schreibe. Er sei eher nicht so entscheidungsfreudig, um nicht zu sagen konfliktscheu. Geschätzt im Lehrerkollegium, sie habe den Eindruck auch von den Schülern, und äußerst charmant, wenn ihm danach sei. Er könne brillante Diskussionen führen, um ein Gegenüber zu beeindrucken, bei dem es sich lohne, aber auch scharf und sarkastisch sein, wenn ihn jemand nerve. Nein, ein Langweiler bist du nicht.
Sie schwieg, ergänzte dann, dass er nach der Zeit in Royan stark verändert gewesen sei, sehr launisch, nur noch Extreme, mal sprühend vor Zuvorkommenheit ihr gegenüber, dann plötzlich kränkend abweisend. Etwas sei in Royan vorgefallen. Eine andere Frau, vielleicht. Vielleicht auch nicht, sie habe nie irgendwelche Hinweise gefunden. Mehr hatte sie nicht sagen wollen und war bei den letzten Worten seinem Blick noch hartnäckiger ausgewichen.
Besser das Thema wechseln. Zweite Frage, ihr Mann – es war ihm einfach nicht möglich, ich zu sagen – habe in Royan einen Weiterbildungskurs für Französischlehrer besucht, weshalb habe er sich denn mit der Besatzungszeit beschäftigt?
Sie nickte. Jeder Teilnehmer hatte ein landeskundliches Thema als persönliches Projekt zu bearbeiten. Du bist ja auch Historiker und hast deshalb als Thema die Besatzungszeit durch die Deutschen gewählt. Royan an der Atlantikküste war nicht nur besetzt, sondern befestigt, Atlantikwall, und wurde kurz vor Kriegsende von den Alliierten bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht.
Ja, das hatte er in den Notizen gelesen. Aber ihr Mann erwähne persönliche Recherchen, die er damit verbinden wollte. Etwas, was mit einem Besuch bei seiner Mutter an Ostern in Verbindung stand.
Sie blieb stehen, schaute ihn lange und nachdenklich an. Nein, von persönlichen Recherchen wisse sie nichts, aber eine Ahnung, worum es gehen könnte. Sie blickte sich um, suchte eine Bank, wo sie ungestört sein konnten.
Inzwischen kreuzten sie immer häufiger andere Klinikgäste, die Mittagsruhe war zu Ende. Den einen oder die andere kannte er aus dem Speisesaal, er grüßte und ignorierte ihre neugierigen Blicke auf seine Begleiterin, stellte sie niemandem vor, als was auch.
Als sie eine leere Bank gefunden hatten, zögerte sie plötzlich, setzte sich nicht, schaute vielmehr auf die Uhr, sie müsse zurück, sie habe um halb vier noch einen Termin. Er solle besser seine Mutter fragen, sie komme ja am Sonntag. Sie bedaure. Sie wich einem Spaziergänger aus und eilte davon, flüchtig zurückwinkend. Es sah ganz nach Flucht aus.
Also habe er sich alleine auf die Bank gesetzt, die Arme verschränkt und die Beine gestreckt, passender Moment für eine Zwischenbilanz. Mehr als zwei Wochen war er nun hier, er habe die Besuche Revue passieren lassen, die Frau kam heute zum dritten Mal, vor drei Tagen war überraschend der Bruder erschienen. Sein Besuch dauerte nur kurz, es gab wenig zu sagen, von seiner Seite ohnehin nichts, aber auch der Bruder blieb merkwürdig wortkarg, die Brüder schienen nicht sehr verbunden zu sein.
Er habe versucht, die verschiedenen Gespräche wieder aus dem Gedächtnis abzurufen, schwierig, Kopfschmerzen kündigten sich sofort an. Er notiere deshalb nach jedem Gespräch sorgfältig, was er als behaltenswert erachte. Er hielt die Hand hoch, in der sich die Heftrolle gerade befand. Sich Neues zu merken erweise sich als äußerst anstrengend. Er könne das Gehörte nicht mit Bildern verknüpfen, auch nicht mit Tönen oder Gerüchen.
Das Mädchen sei gestern zum zweiten Mal gekommen, sie mochte ihren Papa und habe es ihm offen gesagt, vermutlich keine Selbstverständlichkeit bei einer Sechzehnjährigen. Sie hatte ihren schulfreien Nachmittag geopfert, kam mit Zug und Bus hierher, nur um ihrem Vater einen Besuch abzustatten, einem Vater, der vermutlich immer stärker mit seinen eigenen Dingen beschäftigt war als mit seiner Tochter. Er habe Nadine an der Bushaltestelle abgeholt, sie verspürte keine Lust auf einen langweiligen Spaziergang, also setzten sie sich auf die Terrasse der Klinikcafeteria und bestellten für sie einen Eisbecher und für ihn ein Bier.
Das Mädchen kicherte, du hast mich noch nie so offiziell auf ein Eis eingeladen. Dann verlegenes Schweigen. Er konnte doch unmöglich fragen, na, wie war denn dein Vater so?, und noch weniger, na, wie war ich denn so als Vater? Er habe sie die ganze Zeit aufmerksam beobachtet, ihre Gesten, die unnachahmliche Weise, wie sie die zu langen Ponysträhnen aus dem Gesicht pustete, bevor der nächste Löffel Eis in den Mund geschoben wurde, wie sehr möchte er die Bilder von früher im Kopf finden. Ein kleines Mädchen, das auf seinem Arm ein Eis am Stiel schleckt, es tropft auf seinen Ärmel. Eine klebrige kleine Hand, die sich vertrauensvoll von der sicheren Vaterhand führen lässt. Nichts. Kein Bild. Kein Gefühl. Sie beugte sich nach vorn und meinte verschwörerisch, er habe ihr ohne Wissen von Mama öfter großzügig etwas zugesteckt, wenn das Taschengeld wieder alle war.
Marty sah mich hilflos an, nicht einmal das habe er richtig einzuordnen gewusst, brauchte sie etwa Geld? Er habe ihr zwanzig Franken über den Tisch geschoben. Sie habe gestrahlt und weitergeplaudert. Als ihr irgendwann auffiel, wie wortkarg er war, habe sie geseufzt, und nun behaupte er, nichts mehr zu wissen, das verstehe sie einfach nicht.
Nachdenklich blickte Marty auf das Heft in seiner Hand, er hoffe sehr, dass ihr Vater stolz auf sie war und es ihr auch gesagt hat. Ihr hilfloser Schmerz beschäftige ihn, er habe ihr den Vater weggenommen, den sie mit sechzehn mehr denn je brauche. Nadine habe schließlich gemeint, eigentlich sei es nicht so schlecht, wenn er von ihren Dummheiten nichts mehr wisse und ihre Streiche vergessen habe, davon erzähle sie ihm bestimmt nichts. So könne sie nun alles richtig machen. Er habe geschwiegen, ihm blieb das Richtigmachen verwehrt, ohne Vorstellung, was ihr Vater früher alles falsch gemacht hatte. Auch keine Vaterschaft lässt sich weiterführen, wenn nur einer die Geschichte kennt.
Aber Nadine war rührend, so ein Gedächtnisverlust sei doch eine unglaubliche Chance, nochmals anzufangen. Diesen Satz der Sechzehnjährigen habe er sofort aufgeschrieben, sie habe ihm die Augen geöffnet. Ja, was auch immer diesen Jean-Pierre Marty früher belastet hatte, war nun einfach weggepustet. Er sei zwar ein Heimatloser in seinem eigenen Leben, aber frei.
Ich nickte, das sei ja schon eine ganze Menge. Und zum Schluss, was sich denn nun auf dem Laptop befinde?
Marty nickte, eine umfangreiche Sammlung von tagebuchartigen Dokumenten aus der Zeit in Royan, alle ohne Titel, aber mit Datum, die ersten habe er gelesen, dann einzelne herausgepickt, zudem noch ein ziemlich großes PDF, könnte ein Manuskript sein, er sei ratlos. Eher unwahrscheinlich, dass ihm die stichwortartigen und für ihn oft unverständlichen Aufzeichnungen helfen würden, die Person dieses Jean-Pierre Marty zu verstehen. Die Hoffnung, dass sie ihm eine Spur zu seinem verschütteten Gedächtnis öffnen könnten, zerbrösle, je mehr er davon lese. Ihm fehlten zahlreiche Fakten, um Anspielungen einordnen zu können. Denn etwas habe er in seiner anfänglichen Euphorie nicht bedacht. Die persönlichen Notizen seien nicht für das Lesen durch fremde Augen bestimmt gewesen, Marty habe mit wenigen Ausnahmen weder Hintergründe noch Fakten notiert, die kannte er ja, meist nur kryptische Eindrücke, Beobachtungen, Gefühle. Kurz, die Notizen seien für Außenstehende schwer verständlich und erwiesen sich nun für das Wiederlesen durch den Schreiber mit Gedächtnisverlust als unnütz.
Ich schüttelte den Kopf, dessen sei ich mir nicht so sicher. Es war sein letzter Satz, der mich auf die unorthodoxe Therapie brachte. Da war vor einigen Monaten ein Fachartikel zum Thema Sprache und Erinnerung erschienen, die Rolle des Erzählens beim Speichern von Erinnerungen, der mich fasziniert hatte. Ich hatte der Thematik nachgehen wollen, mangels Zeit jedoch die Sache ad acta gelegt. Jetzt bot sich unvermutet eine einmalige Gelegenheit. Denn, fuhr ich fort, es gebe durchaus Hoffnung. Die PET/CT-Untersuchungen der Uniklinik zeigten zwar, dass im rechten Schläfenlappen, wo die Steuerung des autobiografischen Gedächtnissystems vermutet wird, der Stoffwechsel praktisch inaktiv sei, obwohl bei ihm keine Gewebeschädigung vorliege. Es gebe verschiedene Gründe, weshalb die biochemischen Austauschprozesse in dieser Gehirnregion gestört sein könnten, zum Beispiel Ausschüttung eines blockierenden Stresshormons. Das sei durchaus beeinflussbar. Ich würde ihm nun eine ungewöhnliche Behandlungsmethode vorschlagen, die ich wissenschaftlich begleiten wolle.
Dazu müsse ich etwas ausholen. Der Mensch kenne mittels eines ordnenden Gedächtnisses seine Vergangenheit, er habe eine mentale Vorstellung, wer er in der Gegenwart ist, und weil der Mensch auch wisse, dass er unaufhörlich auf seinen Tod zugehe, verhülle das menschliche Bewusstsein dieses unerträgliche Wissen mit Zukunftsplänen. Kurz, der Mensch könne kraft seines Bewusstseins seine eigene Geschichte erzählen, gestalten und planen.
Marty folgte mir stirnrunzelnd.
Ihm sei momentan durch eine Blockade der Zugang zu seiner Vergangenheit verwehrt, damit die Grundlage der gegenwärtigen Identität entzogen und die Imagination für Zukunftsplanung verunmöglicht. Auf der andern Seite liege ihm außergewöhnlich viel sprachliches Material in Form von eigenen Tagebuchnotizen vor, die ihm zurzeit fremd und unverständlich erschienen, aber eine einmalige Chance darstellten, zumindest die fehlende Vergangenheit der letzten Monate mittels Sprache wieder Wirklichkeit werden zu lassen.
Mein Vorschlag: Er solle die Journaltexte auf dem Laptop als Stoff, als Material für seine Wunschvergangenheit betrachten. Er solle sich das dort Erzählte aneignen und so umformulieren, dass es seine Aufzeichnungen würden. Er dürfe hemmungslos eingreifen, weglassen, erfinden. Fabulieren solle er, fantasieren, erdichten, die Gedanken im Journal zu seinen eigenen machen, die Notizen der drei Monate in Frankreich neu schreiben, sodass es seine Geschichte werde.
Marty starrte mich zweifelnd an, und wie das mit der Wahrheit sei? Wie es wirklich war?
Kein Problem, ich persönlich würde ihn von der moralischen Wahrheitspflicht entbinden. Als Bestätigung unterstrich ich die Vergabe meiner therapeutischen Lizenz zum Lügen noch mit einer wegwerfenden Geste. Was in den vorliegenden Aufzeichnungen stehe, stelle bloß eine Wahrheit dar. Er sei frei für andere Wahrheiten. Übrigens, was das Gedächtnis als Erinnerung darstelle, wenn wir etwas Vergangenes erzählen, habe weder mit realen Erlebnissen noch mit Wahrheit etwas zu tun. Es präsentiere eine Version, die zum aktuellen Zeitpunkt gerade die passendste sei. Erinnerungen sind immer Fiktionen, die wir laufend anpassen und neu erzählen. Sie haben ein neues Ich, aber keine Vergangenheit dazu? Dann erfinden Sie sie.
Aha, ich würde also nicht beabsichtigen, die Gedächtnisblockade mit Gedächtnistraining zu therapieren. Ich wolle seine Blockade oder vielmehr ihn überlisten, via Hintertür des Wunschdenkens und Neuerfindens die tatsächlichen Erinnerungen zu provozieren. Ja, das Spiel gefalle ihm, obwohl er selbst der Proband sei. Er nickte, einverstanden.
Zwei Tage später bat er einen Pfleger, mich rufen zu lassen, es hätten sich neue Erkenntnisse ergeben, über die er mit mir vor unserer nächsten Sitzung sprechen müsse, es sei fraglich, ob er dann wie ausgemacht die ersten Überarbeitungen der Royantexte mitbringen könne. Als ich ins Zimmer trat, lag Marty auf dem Bett, ein feuchtes Tuch auf der Stirn, die Balkontüren weit geöffnet.
Nie zuvor hätten ihn solch stechende Kopfschmerzen angegriffen, jetzt verlangsame sich das Hämmern zum Glück, und zwar mitten im Gespräch mit der liebenswürdigen alten Dame, der Mutter von Jean-Pierre Marty, die nicht seine biologische Mutter sei, was er bereits wusste. Der Tatsache, dass sein Alter Ego, so nenne er den Andern jetzt, adoptiert war, habe er bisher nicht so viel Wichtigkeit beigemessen, bloß ein interessantes biografisches Detail. Er habe die Bedeutung gewaltig unterschätzt, ein Lebensdrama war damit verbunden. Die Mutter sei bereits einmal im Spital vorbeigekommen und habe ihre Tränen nicht zurückhalten können. Erst jetzt, nach diesem Besuch, verstehe er ihren mysteriösen Satz, sie habe ihn ein zweites Mal verloren.
Ich setzte mich in den Lehnstuhl, womit wir uns, ohne es zu beabsichtigen, in klassischer Therapieaufstellung wiederfanden, mit dem kleinen Unterschied allerdings, dass ich nicht am Kopfende, sondern zu seinen Füßen saß. Aber Marty war in jeglicher Hinsicht mein Sonderfall. Erzählen Sie bitte.
Auch mit ihr sei er im Park spazieren gegangen, die alte Dame war nicht mehr so gut zu Fuß, sie gehe leicht gebückt, klein, aber mit Haltung halte sie das Alter im Griff, elegante Kleidung, bestimmt vor Jahren maßgeschneidert, trägt sie mit zeitloser Würde, er sei der liebenswürdigen Dame sehr zugetan. Dann habe er sie nach jenem Ostermittagessen bei ihr gefragt. Sie war nach seiner Frage direkt auf die nächste Bank zugesteuert, es erzähle sich besser im Sitzen. Sie habe seine Hand genommen, sie trug feine weiße Stickereihandschuhe.
Du kennst die Fakten, begann sie, du hast von der Adoption erst als Dreißigjähriger durch einen unglücklichen Zufall erfahren, dein Bruder hatte damals einen schweren Unfall, und es ging um eine Blutspende, die Blutanalyse ergab, dass ihr beide nicht verwandt sein konntet. Natürlich sei es dumm von ihnen gewesen, ihm das nicht früher zu sagen, aber der Zeitpunkt sei eben nie der richtige bei unangenehmen Sachen. In blinder Kränkung habe er jahrelang nicht mehr mit ihnen gesprochen.
Die Stimme der alten Dame zitterte kaum merklich. Er habe ihnen den Verrat, so nannte er ihr Verschweigen der Adoption, nicht verzeihen können. Erst als seine Tochter auf der Welt war, habe er seine sture Haltung gelockert. Sie und Vater hätten sehr unter der Zurückweisung gelitten. Du, der aufgeklärte, rationale Intellektuelle, bist durch die Entdeckung, dass zwischen dir und uns keine Blutsbande bestanden, in eine existenzielle Krise gestürzt. Was haben wir uns nicht alles anhören müssen. Die Familie eine einzige große Lüge, keine verwandtschaftliche Beziehung, keine Großeltern und Urgroßeltern, hinter dem Zeitpunkt der Geburt weiße Leere. Ja, du hast deinen Weltschmerz kultiviert. Sie habe seine Selbstbemitleidungen irgendwann nicht mehr hören können.
Marty schob das Stirntuch beiseite, setzte sich auf und blieb gebückt am Bettrand sitzen, den Kopf in die Hände gestützt. Die Mutter habe an jenem Ostersonntag ihm und seiner Familie erstmals alle Einzelheiten seiner Adoption erzählt, ausgelöst durch Nadine, die für eine Geschichtsarbeit ihren Familienstammbaum recherchieren sollte. Er dürfe auf keinen Fall vergessen, das Mädchen beim nächsten Besuch nach dieser Arbeit zu fragen. Mutters Erzählung, er habe alles stichwortartig aufgeschrieben, hier, er reichte mir sein Notizheft.
Ich winkte wiederum ab, er möge es mir bitte vorlesen.
Hochzeit der Eltern 1939, kurz danach Generalmobilmachung, Geburt des Bruders Daniel 1942, mit Komplikationen, keine weiteren Kinder möglich. Vater im Grenzdienst, bei Waldarbeiten verwundet, wurde 1944 entlassen. Leiter der freiburgischen Kantonalbankfiliale in Murten, ehrenamtlicher Treuhänder verschiedener Heime im Kanton, Familie nahm mehrmals Flüchtlingskinder auf, zeitlich befristet, Kinder mussten zurück. Mutter litt, wollte noch ein Kind adoptieren.
Marty blickte auf. In einem Nonnenkloster mit Kinderheim, Frankreich war nicht weit weg, habe es einige Flüchtlingskinder gegeben, die illegal über die jurassische Grenze gebracht und so gerettet wurden. Es waren vor allem Kriegswaisen oder Kinder, die in den Flüchtlingsströmen ihre Eltern verloren hatten, davon gab es Hunderte, sie waren beim Roten Kreuz gemeldet. Aber auch Kinder, die man bei der Kirche versteckte, weil ihre Eltern deportiert wurden. Vichy-Frankreich sei in der Judenverfolgung ja übereifrig gewesen. Die Schwestern brachten die Kinder bei ihren Ordensgemeinschaften in der Schweiz unter, mit dem stillschweigenden Einverständnis der Schweizer Grenzwache. Beim Grenzübertritt schauten die vermutlich konzentriert durch ihre Feldstecher oder auf die andere Seite.
31. Juli 1945, Vater brachte aus dem Heim einen kranken Säugling, Vollwaise, zur Pflege in die Familie, keine Geburtspapiere, der Säugling sehr klein und das Alter schwierig zu bestimmen, Arzt schätzte etwa vier Monate, also wurde der 31. März 1945 als Geburtstag in die Adoptionspapiere eingetragen.
Der «Andere» sei an Ostern völlig in Rage gekommen, weil auch der Geburtstag ein beliebiges Datum war, sein ganzes Leben eine einzige Erfindung, seine Identität eine reine Fiktion. Wie immer übertrieben und Mutter sehr gekränkt. Der Kleine wurde Jean-Pierre genannt, die französische Version von Hanspeter, Vorname seines Adoptivvaters. Der Säugling war lange kränklich, hatte vermutlich Traumatisches erlebt, lange blieben sie im Ungewissen, ob er durchkommen würde. Für Mutter war sein Überleben ein Sieg über den Krieg.
Das Wichtigste komme jetzt, Marty vergewisserte sich, dass ich zuhörte. Offizielle Bescheinigung des französischen Staates, dass Eltern unbekannt, Findelkind, leibliche Eltern vermutlich in den Befreiungskämpfen an der Westküste Frankreichs umgekommen, Kriegswaise, somit adoptierbar. Nonnen verweigerten weitere Auskünfte. Adoptivvater fand dank Beziehungen später heraus, dass das Kind aus dem Département Charente gekommen sein müsse, Gegend zwischen La Rochelle und Girondemündung, dort heftige Befreiungskämpfe und Bombardierungen Anfang 1945, die Deutschen in Atlantikfestungen verschanzt. Säugling war vermutlich Waisenkind nach Bombardierung.
Ihm sei nun klar, welche Recherchen der Andere mit seinem Weiterbildungsurlaub verbunden habe. Ein verrückter Kerl, seine Familie aufspüren zu wollen, ohne verlässliche Hinweise, nicht einmal seinen Familiennamen kannte er. Bloß ein Monogramm, GQ, falls die Mutter die gestickten Buchstaben auf dem Tuch richtig gelesen hatte, das einzige materielle Indiz für die Herkunft. Der Säugling war den Schwestern in einen Kissenbezug und ein Stück Wolldecke eingewickelt übergeben worden. Sagten sie jedenfalls. Mutter hütete das Stoffstück wie eine Reliquie und hatte es dem Andern vor einem Monat, kurz vor dem Unfall, geschickt.
Und jetzt, erregt stand Marty auf und begann im Zimmer auf und ab zu marschieren, während ich versuchte, durch Sitzenbleiben einen Kontrapunkt zur Unruhe zu bilden. Es bestehe kein Zweifel, er stehe am selben Punkt. Eine Vergangenheit zu finden, zu der alle Verbindungen gekappt waren. Aber diesmal mit miserablen Karten. Mit dem Gedächtnisverlust werde die große Lebensproblematik der unbekannten Vergangenheit quasi wiederholt, nein, auf die äußerste Spitze getrieben. Marty rieb sich die rechte Schläfe, die stechenden Kopfschmerzen hatten schlagartig wieder eingesetzt. Er blieb an der geöffneten Balkontür stehen, holte tief Luft. Er, der Mann ohne Vergangenheit, müsse die Erinnerungen eines Mannes finden, der selber auf der Suche nach seiner Vergangenheit war. Wer blicke da noch durch. Was, wenn der Andere vor dem Unfall nichts über seine Herkunft herausbekommen hatte? Dann suche er jetzt die Identität von einem, der nicht wusste, wer er war. Er frage sich, ob er die Erinnerungen des Andern, falls sie wieder auftauchten, überhaupt ertragen würde.
Er starrte durch die Baumwipfel in die Ferne. Draußen begann es zu dunkeln, hinter den schwarzen Umrissen der Parkbäume funkelte tiefblau der Abendhimmel.
Marty presste beide Fäuste gegen die Schläfen, es muss einfach einen tieferen Sinn für diesen wahnwitzigen Albtraum geben. Erregt schloss er die Balkontür und setzte sich mir gegenüber an den Tisch, der alte, verzogene Fensterflügel klirrte ob der uneleganten Heftigkeit.
Er zermartere sich das bockige Gehirn, wie es nach der Klinik weitergehe. Man könne das kaum als Leben bezeichnen, so wie er zurzeit Tag für Tag hinter sich bringe und mühsam einen Lebenslauf zusammenstückle, der ihn zunehmend befremde. Leben bedeute doch, Wünsche zu haben. Er habe keine. Ohne Erinnerungen keine Wünsche und somit auch keine Lebensziele. Da habe einer die Tür hinter ihm zugeschlagen. Die Neuschreiberei des Journals bringe nichts, er bedaure, aber er steige aus dem Schreibprojekt aus.
Ich hatte es geahnt, wollte aber unter allen Umständen den vorzeitigen Abbruch verhindern. Falls es nicht gelingen sollte, damit die Gedächtnisblockade zu lockern, nicht einmal Haarrisse zu provozieren, durch die feinste Erinnerungen zu dringen vermochten, dann habe er sich mit den neu formulierten Texten immerhin doch Wunscherinnerungen erschrieben, habe zumindest etwas in der Hand respektive im Kopf, und vielleicht reiche dies bereits, damit sich Ziele und Wünsche für die Zukunft formierten, seien sie noch so bescheiden.
Marty blickte mich nachdenklich an. Klingt nachvollziehbar. Er stand auf, begann zwischen Tisch und Fenster hin und her zu gehen, blieb dann schließlich vor mir stehen. Gut, er werde also versuchen, mögliche, wahrscheinliche, wünschbare Vorstellungen zu entwerfen, wie das Leben seines Alter Ego in den vergangenen drei Monaten gewesen sein könnte. Aber er zweifle, ob man mit Wörtern das Vergessen zurückbuchstabieren könne. Trotz Lizenz zum Lügen. Sein Lächeln geriet ziemlich schief.
Das war am Sonntagabend, am folgenden Freitagmorgen brachte Marty die ersten Überarbeitungen seines Royan-Journals, oder, wie er zu sagen pflegte, der «Aufzeichnungen des Anderen», auf dem USB-Stick zum Ausdrucken ins Sekretariat und hinterließ die Mitteilung, dass er um ein zusätzliches Gespräch mit mir außerhalb der abgemachten Sitzungen bitte, so bald wie möglich.