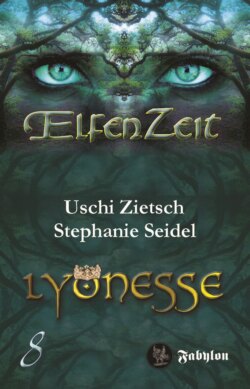Читать книгу Elfenzeit 8: Lyonesse - Uschi Zietsch - Страница 11
3.
Mord am Stachus
Оглавление»Normalerweise«, sagte Robert, während er ein Buchregal umsortierte, »enden Romane an der Stelle, wo ich angekommen bin.«
»Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.« Der Spott in Annes Stimme war angemessen. Sie sprach, ohne aufzusehen, da sie gerade auf allen vieren über das Parkett kroch, unter den Sessel und Regale schaute.
»Stimmt genau. Aber meine Geschichte geht eben noch weiter … oder fängt neu an.« Robert seufzte. »Das verunsichert mich.«
»Warum? Als Sterblicher hast du doch stets im Ungewissen gelebt.« Sie wandte sich der anderen Wand zu.
Robert runzelte die Stirn, räumte eine Reihe wieder aus und sortierte sie neu. »Nicht ganz. Ich kannte ungefähr meine Lebensspanne, wenn nicht Unfälle oder Krankheiten dazwischenkamen. Meine Möglichkeiten waren begrenzt.«
»Du bist eine Nervensäge«, stellte Anne in scharfem Tonfall fest. »Ständig geht deine Stimmung rauf und runter. Da warst du mir als Alkoholiker noch lieber, andauernd im Selbstmitleid versunken und …«
Robert hielt inne und sah zu ihr hinunter. »Was machst du da eigentlich?«
»Moment … ah!« Plötzlich sprang Anne los, wie eine Katze auf die Beute, ihre rechte Hand schoss vor, und Robert hörte ein leises Quieken. Verdutzt sah er Anne zu, als sie sich aufrichtete und eine kleine graue Hausmaus in ihren Krallen präsentierte. »Sie wollte deine Bücher anknabbern!« In ihren Augen lag ein gieriges, wildes Glitzern, das Robert einen eiskalten Schauer den Rücken hinunterlaufen ließ. Ein Raubtier, das sich genüsslich über die Fangzähne leckte.
»Tu ihr nichts!«, sagte er schnell.
Sie zog die Brauen zusammen. »Warum?«
»Ich dachte, Catan wäre die Katze …«
»Falsch gedacht.« Sie näherte die Hand ihrem Mund, und die Maus quietschte in Panik auf.
»Nein!«, rief Robert und hielt ihren Arm fest. »Sie … das ist doch ein ganz harmloses und sehr niedliches Wesen. Lass sie laufen, bitte!«
Anne war nun deutlich ungehalten. »In unserer Wohnung? Ausgeschlossen. Lasse ich sie im Treppenhaus frei, findet sie wieder ein Schlupfloch zu uns. Lasse ich sie auf der Straße frei, erfriert sie. Dann erklär mir, was mit der Maus geschehen soll, ohne ihr zu schaden!«
Robert sah ein, dass sie recht hatte. »Tut mir leid, kleine Maus«, murmelte er und wandte sich ab. Kurz darauf hörte er das Klappen der Wohnungstür, Anne und die Maus waren verschwunden. Erleichtert atmete er auf.
Eine halbe Stunde später war sie zurück. »Ich weiß gar nicht, warum ich das alles mache!«, bemerkte sie. Unsicher sah er sie an, er konnte ihrem Tonfall nicht entnehmen, ob sie wütend war. »Mein Leben ist völlig auf den Kopf gestellt.«
Aber sie hatte die Maus am Leben gelassen. Sie an einen sicheren Ort gebracht. »Und … äh … gefällt es dir?«
»Es ist nicht uninteressant«, gab sie zu. »Mal was Neues.« Dann grinste sie.
Er lächelte erleichtert zurück. Als er das Regal zu seiner Zufriedenheit sortiert hatte, setzten sie sich gemeinsam aufs Sofa und sahen dem Schneetreiben vor dem Fenster zu.
»Ob Nadja unsere Nachricht bekommen hat?«, äußerte Robert, was ihn bewegte. Er hatte einen Beleg seines Buches mit einer Widmung zum Baumschloss der Crain geschickt, Anne hatte den Transport übernommen.
»Ganz sicher. Sie weiß jetzt, dass wir noch leben.«
»Und … wie stehst du zu ihr?«
»Ich respektiere sie. Sie ist sehr mutig und eine echte Kämpferin. Ich stehe nicht mehr zwischen dir und ihr, falls du das wissen willst.« Anne setzte sich auf. »Aber wir beide werden uns nicht mehr einmischen. Nadja kann auf sich selbst aufpassen, und ebenso auf ihren Sohn. Außerdem sind da noch David und Rian und der ganze Rest der Bande. Sie braucht uns nicht. Ich bin schon weit genug gegangen. Keinesfalls werde ich mich in die Dienste Fanmórs stellen.«
»Das verlange ich ja gar nicht«, beschwichtigte er. »Ich habe nur das Gefühl, als ob sie schon wieder in Schwierigkeiten steckt …«
Sie blickte finster. »Und du möchtest, dass ich das via Elfenkanal herausfinde.«
»Ähm … ja.«
»Vergiss es. Ende der Diskussion.«
Notgedrungen gab er nach. Dann musste er eben einen anderen Weg finden.
Es kam in den Abendnachrichten. Nachdem einige Penner in den vergangenen Nächten erfroren waren, war nun etwas Neues an die Presse durchgesickert – hervorgerufen durch die nächste aufgefundene Leiche. Einer undichten Polizeistelle zufolge war keiner der Obdachlosen eines natürlichen Todes gestorben, wobei die genaue Todesursache noch nicht feststand. Aber alle waren grausam entstellt, teilweise habe sogar die Haut gefehlt, oder sie wären wie eingetrocknet gewesen …
Robert war hellwach. »Das geht nicht mit rechten Dingen zu! Komm, das müssen wir uns ansehen, und zwar sofort!« Er sprang auf und lief zur Garderobe. Nicht, dass er einen Mantel brauchte, aber es würde doch zu sehr auffallen, wenn er bei mehreren Minusgraden im Hemd spazierenging.
Nach kurzem Zögern folgte Anne ihm. Robert war auf Fragen, Vorhaltungen gefasst gewesen, doch sie zog schweigend ihre weiche Samtjacke an, und er fühlte sich auf einmal beschwingt, als wäre etwas von ihr auf ihn übergesprungen.
Sollte etwa … Er dachte nicht zu Ende, das war unwichtig und lenkte nur ab. Jetzt wartete eine Reportage auf ihn!
Um schneller dort zu sein, fuhren sie eine Station mit der U-Bahn zum Karlsplatz und kamen in der Nähe des Mathäser Filmpalastes heraus, wobei es nicht einfach war, nach oben zu gelangen. Unten herrschte dichtes Gedränge, einige Ausgänge waren gesperrt worden, und überall war Polizei. Sie brauchten fast zehn Minuten, bis sie endlich die Station verlassen hatten. Eine Menge Schaulustige waren vor Ort, sowie Übertragungswagen diverser TV-Sender. Scheinwerfer schnitten grelle Lichtbahnen in die Dunkelheit und schufen in unmittelbarer Nähe harte Schlagschatten, die in unregelmäßigen Abständen dick eingemummte Gestalten gebaren, beschäftigt mit irgendwelchen wichtigen Dingen.
Robert sah sich aufmerksam um, und dann hoben sich seine Brauen. Hastig ergriff er Annes Hand und zog sie mit sich, auf die Absperrung zu. Als ein Polizist ihn aufhalten wollte, zeigte er seinen Presseausweis und deutete auf einen Mann Ende fünfzig, dessen Halbglatze dem erneut einsetzenden Schneefall schutzlos ausgeliefert war. Er trug einen billigen Mantel, einen dampfenden Kaffeebecher in der linken Hand und eine Brille auf der Nase, die sein halbes Gesicht bedeckte.
»Das ist Hans-Peter Dauß, wir sind schon sehr lange befreundet«, erklärte er dem Polizisten. »Er erwartet mich!«
»Tut mir leid«, erwiderte der Uniformierte. »Ich habe strikte Anweisung, niemanden durchzulassen, und das gilt besonders für die Presse.«
»Aber …«, setzte Robert an, und Anne schob sich neben ihn.
»Haben Sie nicht gehört, dass wir erwartet werden?«
Der Polizist schluckte trocken und wirkte eingeschüchtert, wich trotzdem keinen Millimeter. »Ich habe die Anweisung, meine Dame, wenn ich die nicht befolge, bin ich meinen Job los.«
»Lass nur«, winkte Robert ab. Er sprang vor dem Absperrband auf und ab, wedelte heftig mit den Armen und rief: »Jim! He, Jim Gordon!«
Der Mann mit dem Kaffeebecher fuhr herum, und feiner Sprühregen verteilte sich rings um seinen Kopf im Scheinwerferlicht. Als er Robert entdeckte, war sein Seufzen bis hierher zu vernehmen. Langsam kam er näher und nickte dem Polizisten zu. »Lassen Sie ihn und seine Begleiterin durch, das geht in Ordnung.«
Der Polizist verzog keine Miene, als er das Absperrband hob und das Paar hindurchschlüpfte.
»Musstest du das über die ganze Stadt brüllen?«, empfing Hans-Peter Dauß den Autor. »Ist ja peinlich.«
Robert grinste breit und schlug dem älteren Mann auf die Schulter. »Ach was, es erinnert sich doch niemand mehr daran.«
»Dann bist du … Batman?«, fragte Anne stirnrunzelnd ihren Gefährten.
»Der? Nein, das ist Jimmy Olsen, als er noch Praktikant war«, versetzte der Mann.
Robert grinste fröhlich.
»Muss ich das verstehen?«
»Nicht unbedingt. Ich bin nicht mal sicher, ob ich es je verstanden habe.« Er hielt Anne die Hand hin. »Hans-Peter Dauß, Pressereferent des Hauptkommissariats. Sehr erfreut.«
»Das wird sich noch herausstellen«, erwiderte sie augenzwinkernd. »Anne Lanschie. Ich bin Roberts Frau.«
Robert platzte fast vor Stolz. So hatte sie sich anderen nie vorgestellt. Das war doch all die Strapazen und Kämpfe im Reich des Priesterkönigs wert. Seine Frau. Genau!
Dauß blickte Robert verblüfft an, dann nickte er anerkennend. »Alle Achtung«, sagte er. »Ich wähnte dich längst im Rinnstein.«
»Da hat sie mich auch rausgezogen«, bekannte Robert vergnügt.
Anne hüstelte. »Ihr seid Freunde.« Sie ordnete den Sitz ihrer Jacke. »Dann will ich euch zur Wiedersehensfreude allein lassen. Darf ich mich ein wenig umsehen, Herr Dauß? Selbstverständlich, ohne irgendetwas anzurühren.«
»Sie sammelt Informationen für mich, aber sie ist sehr diskret«, erklärte Robert schnell. »Komm schon, Comissioner Gordon, in Erinnerung an alte Zeiten, und weil du wirklich so klischeebehaftet dastehst wie in einem amerikanischen Krimi, selbst der Coffee-to-go …«
»Schlimme Unsitte, ich weiß, aber er hält warm. Immerhin rauche ich nicht mehr.«
»Und ich wollte dir gerade eine anbieten.«
»Gehen Sie nur, Frau Lanschie«, sagte Dauß zu der Muse. »Ich vertraue auf Roberts Wort.«
Sie lächelte ihn an, woraufhin er verwirrt blinzelte und verlegen grinste, und machte sich mit schwingenden Hüften davon.
Dauß schüttelte den Kopf. »Das wirst du mir eines Tages erklären müssen, Olsen.«
»Das werde ich, versprochen. Aber jetzt interessiert mich, was hier vor sich geht.«
»Stehst du denn in Diensten?«
»Derzeit nicht, aber ich bin trotzdem noch Journalist. Und vielleicht sind es Recherchen für mein nä… für mein Buch.«
»Also willst du deinen Traum endlich wahrmachen?«
»Ja, stell dir vor, und Anne hilft mir dabei.«
Dauß trank den Kaffee aus. »Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich dir helfen kann. Und es muss alles unter uns bleiben.«
»Das weißt du.« Robert fühlte sich genau wie damals, während seiner Tätigkeit als Enthüllungsreporter. Durch die Arbeit hatte er Dauß kennengelernt, und sie waren Freunde geworden. Der Pressereferent hatte zunächst verschiedene Positionen im Kommissariat bekleidet, bevor er den Polizeidienst quittierte und diesen Job annahm. Er war ein Profi, dem man nicht so leicht etwas vormachen konnte. Noch heute zog es ihn an Tatorte, noch heute zog er Schlussfolgerungen, doch von anderer Sichtweise aus. Und so hatte er einst seine Ehe gerettet, die, dem Ring nach zu urteilen, wohl nach wie vor bestand.
Dauß drückte einem vorbeieilenden Polizisten den leeren Becher in die Hand, nahm Robert am Arm und zog ihn mit sich. »Kam es gerade in den Nachrichten?«
»Ja.«
»Verdammt, dabei wollte ich es verhindern. Nun sieh dir den Rummelplatz hier an! Wie soll man da noch Spuren sichern? Das Problem ist, wir können den Platz unmöglich auf Dauer sperren. Die ganzen Abendgeschäfte feilen schon an Schadenersatzklagen. Vor allem – wo genau sollen wir die Sperre errichten? Wir müssten auch den U-Bahnhof schließen und so weiter. Da steigt uns der Bürgermeister aufs Dach.«
Sie kamen in die Nähe einer Treppe hinab zur U-Bahn, ein anderer Aufgang als der, den Anne und Robert benutzt hatten. Der Zugang war durch ein gelbes Band gesperrt.
Dauß fuhr fort: »Alles, was wir tun können, ist Präsenz zu halten. Aber wie lange? Ich habe nicht genug Leute, und sie leisten schon Überstunden über die normale Belastung hinaus.«
»Was genau passiert denn?«, erkundigte sich Robert.
»Bisher haben wir fünf Leichen und ein gutes Dutzend angeschlagene Leute, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Leider können sie sich an nichts erinnern, was mich äußerst misstrauisch macht. Unsere Psychologen sind im Einsatz, aber bisher ohne Ergebnis.« Dauß schüttelte sich. »Ob lebend oder tot, es ist entsetzlich, was diesen Leuten widerfährt, Robert. Sie sind in einem unbeschreiblichen Zustand, als hätten sie schwere Folter erleiden müssen. Als würde ihnen die Substanz entzogen, so kommt es mir vor. In meiner ganzen Dienstzeit habe ich so etwas noch nie erlebt.«
»Habt ihr irgendwelche Anhaltspunkte, wer …«
»Nichts. Es gibt kein Motiv. Die meisten der Opfer sind Obdachlose, aber es sind auch ein paar Normalbürger dabei, die allein zu später Stunde unterwegs waren. Du kannst dir vorstellen, wie der Bürgermeister uns deswegen im Nacken sitzt. Obdachlose wären ihm ziemlich egal, aber Steuerzahler? Und dann auch noch an einem so hochfrequentierten Platz? Weihnachtszeit, Adventsmarkt, haufenweise Touristen …«
Robert rieb sich grübelnd das Kinn. »Denkst du, ein einzelner Täter kommt in Frage?«
»Ich wünschte, es wäre nur eine Bestie, die wir jagen müssen. Aber es gibt Hinweise, dass mehrere daran beteiligt sind. Was wir eben den wenigen Zeugenaussagen entnehmen konnten, Kumpel wie Passanten, die irgendwelche unheimlichen Gestalten gesehen und schaurige Schreie gehört haben wollten. Normalerweise würde ich das als Hysterie abtun, aber die Aussagen kamen unabhängig voneinander, sind ziemlich übereinstimmend, und die Leute kennen einander nicht.« Dauß sah auf einmal sehr müde aus. »Robert, du und ich – wir beide haben schon eine Menge bizarre Scheiße erlebt. Aber das hier jagt mir Angst ein. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, warum es angefangen hat, und wann es aufhört. Wie wir das in den Griff bekommen wollen, bevor wir fünfzig Leichen haben.«
Robert starrte in die Finsternis neben dem Scheinwerferlicht. Mit seinen Vampiraugen konnte er mühelos die sich darin bewegenden Silhouetten der Menschen erkennen. »Ich werde sehen, was wir tun können«, sagte er dann. »Anne und ich … haben einiges an Erfahrung gesammelt, was mit solcherlei Geschehnissen zusammenhängt. Ich denke, wir müssen uns da auf metaphysischer Ebene umtun.«
Dauß blieb stehen und musterte ihn misstrauisch. »Seid ihr etwa Esoteriker?«
»Nein, eher … nun, es ist so etwas ähnliches wie das Profiling, verstehst du? Wir haben uns viel damit beschäftigt und Kurse gemacht. Wegen meines Buches, weißt du. Ich denke, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sich einer anderen Sphäre zugehörig fühlt. Der wiederum esoterisch ist, wenn du so willst.«
»Ein Satanist«, stöhnte Dauß. »Das passt doch in diese Zeit. Glaube und Aberglaube, weil sonst die Verzweiflung droht.«
Robert klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. »Wir kriegen das schon raus, Hans. Es kann eine Weile dauern, bis ich mich bei dir melde, aber wir sind dran. Und ich werde dich sofort informieren, wenn wir etwas herausgefunden haben.«
»Na schön, sehen wir, welche Methoden schneller greifen – die konventionellen oder Spinnerei.« Dauß konnte nicht lächeln, obwohl er sich Mühe gab. Er nestelte eine Visitenkarte hervor und reichte sie Robert, der ihm wiederum seine Handynummer gab.
»Einen Festanschluss habe ich nicht, da ich umgezogen bin. Ich wohne nicht weit von hier, am Radlsteg.«
»In Ordnung. Wir bleiben in Verbindung.«
Robert schlenderte zu Anne, die am Rand eines Scheinwerferkegels stand. Dichtes Schneetreiben hatte eingesetzt, und die Polizisten gerieten in Hektik, um der Spurensicherung nachzukommen.
»Was haben wir, Watson?«, fragte Robert im Nuschelton, als würde eine Pfeife im Mundwinkel stecken.
»Nicht viel, Mrs. Hudson«, antwortete Anne, während sie leicht gebückt eine Absperrung abschritt.
Robert grinste. Touché, dachte er. Sie richtete sich auf und sah zu ihm. »Sie kommen von unten«, ihr Zeigefinger deutete auf den Boden, »überall in der Luft hängen Reste ihrer magischen Energie, doch ich kann sie nicht recht deuten.«
»Was meinst du damit?«
»Ich weiß nicht, um wen es sich handelt. Damit meine ich keine bestimmte Person, sondern die Zugehörigkeit.«
»Dann sind es Elfen?«
»Ich glaube nicht.«
Robert war ratlos. »Keine Elfen …«
»Keine Götter, keine Geisterwesen …«
»Untote?«
»Mhm. Wenn, dann ungewöhnlicher Art. Aber diese Vermutung trifft es am ehesten. Doch da ist noch etwas anderes, das ich nicht zuordnen kann …« Anne hob die Schultern. »Wenn ich dazu fähig wäre, würde es mich schaudern.«
»Ich sollte dazu nicht mehr in der Lage sein, aber wenn du so etwas sagst …« Robert schüttelte es durch und durch. »Was tun wir jetzt?«
»Gehen wir hinunter und sehen uns um.« Anne war schon auf dem Weg zum abgesperrten Treppenabgang.
Robert vergewisserte sich, dass niemand hersah, und folgte ihr. Hoffentlich entdeckte sie keiner. Aber es schneite inzwischen so dicht, dass außerhalb des Bereichs der Scheinwerfer nichts mehr zu erkennen war, und die Flocken innerhalb reflektierten das Licht. Ringsum herrschte geschäftiges Treiben und Stimmen schwirrten über den Platz. Die meisten Schaulustigen hatten sich entfernt, es war nach Mitternacht, und Aufregendes war nicht mehr zu erwarten. Robert gab Anne ein Zeichen, und sie huschten die Treppe hinunter. Der Bahnhof unten war weitgehend leer, die letzte U-Bahn durchgefahren, und die Polizei kontrollierte nur noch sporadisch. Robert stieß Anne leicht an und wies auf die Kameras, die überall installiert waren. Sie schmunzelte und winkte ab.
»Wir sind nicht mehr als huschende Schemen in der Aufzeichnung«, wisperte sie ihm zu.
»Ist das ein Elfentrick?«
»Ein Vampirtrick.«
»So was wie der Spiegeltrick? Der funktioniert bei mir aber nicht, ich kann mich immer noch sehen.«
»Besser als der Spiegeltrick.«
»Cool. Und ich kann den auch?«
»Sicher. Ich zeige dir, wie du dich bewegen musst.«
Nach kurzer Zeit hatte Robert es heraus und lachte in sich hinein, als er Anne zum Bahnsteig folgte. Sie widmete ihre Aufmerksamkeit vor allem den Schächten, in denen die Züge verschwanden. Ihre Nasenflügel waren weit gebläht und sie schien zu wittern.
Robert versuchte, die magische Strömung auszumachen, die Anne bemerkt hatte, aber er war zu ungeübt darin. Deshalb konnte er auch immer noch nicht den »Elfenkanal« benutzen. Anne sagte, das würde seine Zeit brauchen, dann käme es von ganz allein. Dennoch näherte er sich dem Tunnel, in dem es nur ein paar Meter weit schummrige Beleuchtung gab, hinter der tiefe Finsternis lag. Seine Vampiraugen bohrten sich in die Schwärze, und nach einiger Konzentration konnte er undeutliche Konturen ausmachen.
Das ist so geil, dachte Robert. Ein nie gekanntes Gefühl von Macht durchströmte ihn. Als würde er jetzt erst begreifen, was er seit seiner Wiederauferstehung geleistet hatte. Er hatte sich mit mächtigen Dämonen und Elfen angelegt und sie besiegt – nun ja, bei Catan konnte man sich darum streiten, aber er hatte den Panther zumindest außer Gefecht gesetzt, bevor er abgehauen war –, sein Körper war schnell und stark, und schaurige Geschöpfe der Nacht respektierten ihn allein aus der Tatsache, dass er ein Vampir war, und zwar ein besonderer. Das konnten sie spüren.
Gewiss, er hatte auch getötet. Aber das war im Elfenreich gang und gäbe, die Unsterblichen dachten nicht weiter darüber nach und hatten weitaus weniger Skrupel als normale Menschen. Daran würde er sich wohl oder übel gewöhnen müssen – aber nur, solange es Elfen waren. Mochte das wie eine zweifelhafte Moral klingen, aber Robert wollte keinen Menschen gefährden. Das war einfach eine andere Sache. Eine andere Welt.
Doch jetzt hier zu stehen, von den Kameras nicht erfasst werden zu können und einer Finsternis ihre Geheimnisse zu entreißen – das hatte was. Und war erst der Beginn. Robert kannte bei weitem noch nicht alle seine Fähigkeiten, und er war gespannt darauf, was alles in ihm lauerte, abgesehen von den übermenschlichen Kräften.
Moment … hatte sich da etwas bewegt? Er hatte wieder einmal nicht aufgepasst, war in seinen Gedanken abgeschweift, ganz wie früher. Zu sehr versunken in sich selbst. Als Jäger hatte er noch nicht sonderlich viel Erfahrung und wahrscheinlich auch kein ausgeprägtes Talent.
Robert ging ein Stück näher und konzentrierte sich. Um nicht zu sehr auf sich aufmerksam zu machen, hörte er einfach auf zu atmen. Solange er sich nicht bewegte, war das kein Problem, sein Körper verfiel dann in eine Art Leichenstarre. Auch einer der Tricks, die er durch Zufall herausfand.
Die Geduld machte sich bezahlt. Dort hinten war etwas!
Robert sprang in den Gleisgraben und rannte los. Er brauchte keine Sorge zu haben, keine U-Bahn fuhr derzeit. Anne rief ihm hinterher, doch er achtete nicht auf sie. Er wollte wissen, was sich da bewegt hatte; er war sicher, dass es etwas Nichtmenschliches gewesen war.
Anne stieß einen Fluch aus, dann tauchte Robert in die Dunkelheit ein, und alle Geräusche hinter ihm erstarben. Trittsicher fanden seine Füße den Weg, ohne an die tückischen Stromleitungen zu geraten oder über Unebenheiten zu stolpern. Ihm war so, als würde er genau wie Anne den Boden nicht mehr richtig berühren.
Vor ihm erklang ein erstickter Laut, und dann huschte etwas davon, tiefer in den Schacht hinein. Eine andere Fluchtmöglichkeit gab es nicht, was die Jagd erleichterte.
»Bleib stehen!«, rief Robert. »Lass uns reden!«
Das Wesen dachte nicht daran, und Robert konnte es ihm nicht verübeln. Wenn es bereits wusste, dass ein Vampir hinter ihm her war, konnte es solchen Worten wohl kaum Vertrauen schenken.
Also Gas geben. Mal sehen, wie schnell er hier unten werden konnte. Robert beschleunigte und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Er spürte, wie seine Fangzähne ausfuhren, und wie etwas anderes, Wildes an die Oberfläche drängte und übernehmen wollte. Robert zwang es zurück, doch es gelang ihm nicht ganz. Der Jagdtrieb trieb ihn nun voran, er brauchte gar nicht mehr viel dazu zu tun.
Die Beute … das Wesen war sehr viel kleiner und dadurch flinker im Hakenschlagen. Robert kam ihm trotzdem näher, doch es wechselte schnell die Seiten, sodass er es nicht packen konnte. Seine hochkonzentrierten Sinne empfingen plötzlich Luftströmungen, was bedeutete, dass es irgendwo dort vorn eine Abzweigung gab. Vermutlich auch Verstecke. Dann hatte er so gut wie keine Chance mehr, die Beute – nein, das Wesen zu erwischen.
Er war fast dran. Für einen kurzen Moment überließ Robert die Kontrolle dem Raubtier in sich und empfand sich plötzlich als Beobachter. In einer rasendschnellen Berechnung erkannte das Tier in ihm, welchen Haken die Beu… das Wesen als nächstes schlagen würde. Im selben Moment stieß Robert sich ab, hechtete quer über das Gleis in einem gewaltigen Satz nach vorn und brach wie ein Sturm über den Verfolgten herein.
Roberts Finger packten raues Fell, während sie beide stürzten, er rollte sich sofort ab und kam wieder auf die Beine. Sein Opfer wand sich heftig, doch er hielt es unerbittlich fest.
»Halt endlich still!«, rief er. »Ich will dir ja nichts tun, nur mit dir reden.«
»Lügner!«, schrillte das Wesen. »Ihr Untoten seid alle gleich!«
»Ich bin kein Untoter, jedenfalls nicht so richtig«, erwiderte Robert.
»Was denn sonst, du Vampir? So rotglühende Augen hat doch kein Mensch, und ein Elf bist du auch nicht! Da bleiben nicht viele Möglichkeiten übrig!«
Rotglühende Augen, dachte Robert. Erneut fuhr er sich mit der Zunge über die spitzen Reißzähne, entblößte sie dabei, und sein Gefangener stieß einen weiteren panischen Schrei aus.
»Ich tu alles, was du willst, nur beiß mich nicht!«, bettelte er.
»Du bist mir viel zu haarig«, erwiderte Robert und setzte den Kleinen ab, hielt ihn nur noch im Genick fest. Das Raubtier in ihm zog sich langsam, enttäuscht zurück. Keine lohnenswerte Beute. Robert war froh darüber. »Was bist du überhaupt für einer?«
»Pickwick Chadwick Sloterbick, oder auch kurz Chad, wenn’s genehm ist«, antwortete der Kleine. Er mochte etwa so groß wie Grog sein und aus einer ähnlichen Sippe stammen, da er ebenfalls eine ziemlich große Nase besaß. Sein Körper war von dichtem braunem Fell bedeckt, das nach Steinpilz roch, und hellgrüne Augen funkelten in der Dunkelheit. Seine haarigen Ohren waren sehr lang. »Ich bin nur auf der Durchreise und hatte nicht vor, lange zu verweilen.«
»Auf der Durchreise von wo?«
»London, Mann. Da ist’s derzeit ziemlich ungemütlich, deshalb suche ich nach einem ruhigeren Plätzchen, hatte aber bisher kein Glück.«
»Also, Chad – ich bin Robert. Bis vor kurzem war ich ein Mensch, jetzt ein Vampir, aber ich bin nicht an deinem Blut interessiert. Kommen wir zur Sache. Was weißt du über die Vorgänge hier, welche die Polizei auf den Plan bringen?«
»Komische Frage! Menschen sterben wie die Fliegen, ein Vampir ist in der Nähe – da kann man doch wohl eins und eins zusammenzählen, oder?«
Robert schüttelte Chad leicht, dessen Fell sich daraufhin sträubte. »Wenn ich dir diese Frage stelle, liegt die Vermutung nahe, dass ich nicht der Mörder bin, meinst du nicht? Andernfalls wärst du gar nicht mehr am Leben.«
»Möglich«, brummelte Chad, er klang nicht vollends überzeugt. »Lass mich endlich los, das ist demütigend!«
Robert kam der Aufforderung nach, die gebückte Haltung war ohnehin mehr als unbequem, und er stellte sich aufrecht hin, die Arme vor der Brust verschränkt. »Also, was geht hier vor sich?«
»Woher soll ich das wissen?« Chad schüttelte sich und strich das Fell glatt. »Ich bin neutral, ich halte mich aus allem raus. Halte mich fern von den Menschen und den meisten Elfen. Ich wäre schon längst fort, wenn das Tor funktionieren würde, aber irgendwas blockiert den Durchgang!«
»Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen«, überlegte Robert. »Wieso hast du London verlassen?«
»Sagte ich bereits. Seit die Grenzen fallen und die Zeit überall einbricht, dreht alles durch. In London ist ein Machtkampf ausgebrochen.«
»Zwischen wem?«
»Das willst du nicht wissen. Nicht mal ein Vampir will was mit denen zu tun haben.«
»London gehört doch zum Königreich Crain, nicht wahr?«
»Ja, aber es hat einen eigenen Machtbereich, sehr alt. Fanmór musste Unabhängigkeit zugestehen, er hat nur die oberste Gerichtsbarkeit. Und jetzt ist dort Krieg ausgebrochen zwischen zwei Mächtigen, da bin ich abgehauen. Wie viele andere übrigens.«
Robert rieb sich das vom Dreitagebart bedeckte Kinn. »Ganz schön leichtsinnig, allein zu reisen, wenn man so klein ist.«
Chad grinste plötzlich, und das beunruhigte Robert umgehend. »Bin ja nicht allein«, sagte der Kobold, und dann bekam Robert auch schon gewaltig eins über den Schädel gebraten.