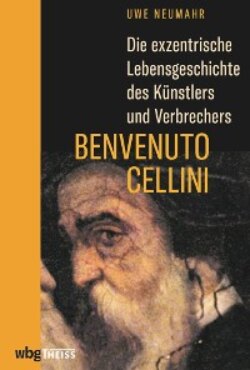Читать книгу Die exzentrische Lebensgeschichte des Künstlers und Verbrechers Benvenuto Cellini - Uwe Neumahr - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwischen Notenblatt und Goldschmiedearbeit
ОглавлениеDer regelmäßige Wechsel von der Bühne zur Werkbank, von der Schalmei zum Hammer bestimmte die ersten siebenundzwanzig Jahre im Leben Cellinis. Um 1513 durfte er auf eigenen Wunsch als Lehrling in die Goldschmiedewerkstatt des Michelangelo Brandini eintreten, wo er auch dessen Sohn, seinem späteren Erzfeind Baccio Bandinelli, begegnete. Giovanni Cellini änderte aber bald seine Meinung und holte ihn rasch wieder zurück. Zum Unwillen des Vaters ging Cellini dann 1515 bei dem Goldschmied Antonio di Sandro Giamberti, genannt Marcone, in die Lehre.
Während er sich der Feinarbeit des Metallhandwerks widmete, schuf die Malergeneration um Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto in Florenz eine neue Monumentalität der menschlichen Figur innerhalb des Raums. Cellini sollte sich später wie Andrea del Sarto, der auch als Goldschmied begonnen hatte, der großen Form zugehörig fühlen, der Großplastik. Doch zunächst musste er eine vierjährige Goldschmiedelehre absolvieren.
Auch wenn Cellini in seinen Schriften nur wenige Informationen über seine Ausbildung erteilt, kann man sich aus einem zeitgenössischen Gemälde des Malers Alessandro Fei, das eine Goldschmiedewerkstatt zeigt, ein ungefähres Bild seines Arbeitsplatzes machen: Werkbänke, auf denen Handwerker mit Feilen, Zangen, Blechscheren und Hämmerchen hantieren. Im Vordergrund wird eine goldene Kanne von einem bebrillten Meister inspiziert, die ein Lehrling hält. Im Hintergrund arbeiten zwei Handwerker gemeinsam an einem Objekt, kleine Modelle dienen als Vorlage; an einem Mauervorsprung sind Musterzeichnungen für Ornamente befestigt. Gesellen feuern die Esse an. Überall sieht man umtriebige Arbeit an Pokalen, Schüsseln, sogar an einer Krone. Obwohl das Gemälde im Palazzo Vecchio zweifellos stilisiert ist, um einen besonderen Status des Goldschmiedehandwerks hervorzukehren– wohl kaum dürften die Handwerker wie Edelleute gekleidet gewesen sein –, gibt es doch einen guten Überblick über die Arbeitsschritte, die Aufteilung und die Hierarchie innerhalb der Werkstatt. Es muss dort laut, heiß und staubig gewesen sein. Der Ton, der gegenüber den Lehrlingen angeschlagen wurde, war autoritär, durften sie doch mit wertvollen Edelmetallen und Edelsteinen arbeiten, deren Diebstahl der Meister fürchtete.
Die Goldschmiedekunst umfasste acht Haupttechniken. Der in diesem Metier Tätige war zugleich Goldschmied, Silberschmied, Edelsteinfasser, Graveur, Ziseleur, Emailleur, Vergolder und Metallgießer. Cellini war später stolz darauf, im Gegensatz zu den spezialisierten Kollegen in allen Bereichen Herausragendes geleistet zu haben. Wer die Lehre absolvierte, hatte nicht zwangsläufig das Berufsziel „Goldschmied“. Weder die Bildhauer Donatello und Verrocchio noch der als Architekt berühmt gewordene Brunelleschi, die allesamt eine solche Ausbildung durchliefen, arbeiteten später als Goldschmiede. Die umfassende Unterweisung, die auch Zeichnen und dekorative Gestaltung enthielt, wurde jedoch als vorbereitende Schule sehr geschätzt. Verschiedene große Künstler empfingen „Anregungen aus unserem Handwerk“, schrieb Cellini später in seinem Traktat über die Goldschmiedekunst.21 Der Goldschmied galt als universeller Handwerker. Er beherrschte den Umgang mit Erden, Metallen und Steinen, das Modellieren in Wachs, Gips und Ton, ja selbst den Bau von Schmelzöfen. Nur der Goldschmied konnte von sich behaupten, Umgang mit den vier Elementen zu haben. Was den Berufsstand darüber hinaus attraktiv machte, war der beständige Verkehr mit den Auftraggebern, den Großen und Reichen. Kunstvoll gestaltete Schmuckstücke bildeten einen wesentlichen Bestandteil des herrschaftlichen Kleiderluxus. Kleinodien zierten die Gewänder der Damen wie der Herren, ganz zu schweigen von Ketten, Broschen, Ringen oder Armbändern. Dies versetzte den Goldschmied unter seinen Kunsthandwerkerkollegen in eine höhere Sphäre.
Alessandro Fei, Goldschmiedewerkstatt, Gemälde, Florenz, Palazzo Vecchio
Cellini muss schon in jungen Jahren eine starke und unabhängige Persönlichkeit gewesen sein. Er wusste, dass er durch die Familie keine Förderung erwarten durfte. Von Jugend an löste er seine Probleme eigenständig. Seine Neugier war groß, ebenso sein Lernwille und seine Bereitschaft zu experimentieren. So eignete er sich autodidaktisch die Niellotechnik an, das Gravieren von Metall, das damals im Verfall war.22 Seine Detailversessenheit und sein Perfektionismus gingen später so weit, dass er für das Schwert des Perseus eine echte Stahlklinge schmiedete. Er gab sich nicht mit einer Attrappe aus minderwertigem Metall zufrieden. Anregungen nahm er dankbar und ohne kulturelle Scheuklappen auf. Cellini äußerte sich anerkennend über die arabesken Verzierungen osmanischer Dolche und eiferte auch muslimischen Goldschmieden nach.
Cellini war mit großer Leidenschaft Goldschmied und verteidigte das Handwerk ein Leben lang als hohe Kunst, die für ihn auf derselben Stufe mit Bildhauerei, Malerei und der Architektur stand. Letztere nannte Cellini gleichberechtigt die „leiblichen Schwestern“ der Goldschmiedekunst. Auch wenn er sich in späteren Jahren vornehmlich als Bildhauer großplastischer Werke hervortat – nicht zuletzt, weil er mit diesen öffentlichen Arbeiten Ruhm erlangen konnte –, bezeichnete er sich in der ersten Fassung des Titels seiner Vita stolz als „Goldschmied und Bildhauer“. Cellinis spätere Gegnerschaft zum Hofkünstler Giorgio Vasari gründete auch auf dem Umstand, dass Vasari in der ersten Ausgabe seiner Lebensbeschreibungen der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten (1550) die Goldschmiedekunst noch als wichtigen Bestandteil des künstlerischen Diskurses betrachtete, in der zweiten Ausgabe (1568) aber eine Abwertung zugunsten der Zeichenkunst vornahm und sie so auf den Rang des Sekundären degradierte.
Cellini legte stets großen Wert auf eine gute Berufsausbildung, wobei er Quereinsteigern gegenüber kritisch eingestellt war. So führte er das Fehlen „gewisser edler Vorzüge“ in den Werken Antonio da Sangallos auf die Tatsache zurück, dass dieser weder Maler noch Bildhauer gewesen sei, sondern „nur Tischlermeister“.23