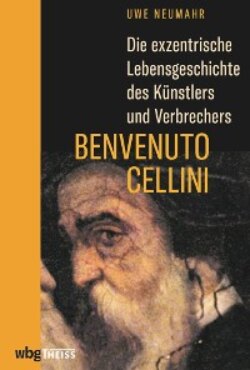Читать книгу Die exzentrische Lebensgeschichte des Künstlers und Verbrechers Benvenuto Cellini - Uwe Neumahr - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein ehrgeiziger Vater
ОглавлениеEs ist der Wunsch der meisten Väter: Der Sohn möge einmal ein zufriedenstellendes Auskommen haben, das ihm ein sorgenfreies Leben ermöglicht. Auch Giovanni Cellini hegte diesen Wunsch für seinen Sohn Benvenuto und betrieb dessen Realisierung nachdrücklich. Benvenuto sollte als Musiker in Giovanni Cellinis Fußstapfen treten, der als Stadtpfeifer für die Signoria tätig war. Bereits mit elf Jahren bekam Benvenuto durch Fürsprache des Vaters ein Engagement als Bläser in Diensten der Parte Guelfa, der politischen Gesellschaft der Guelfen-Fraktion, die eine kleine Musikkapelle unterhielt. Zahlungen sind überliefert, aus denen hervorgeht, dass dem Elfjährigen am 15. Dezember 1511 von den Kapitänen der Guelfen-Partei ein Honorar von 4 Lire für die Monate September bis Dezember ausbezahlt wurde.5 Giovanni Cellinis Wunsch erscheint umso verständlicher, wenn man die Begabung Benvenutos – er fand später immerhin Aufnahme in die Kapelle des Papstes6 – und die Privilegien des Pfeiferamtes in Betracht zieht. Die Stelle sicherte ein Grundeinkommen und erlaubte es Nebentätigkeiten nachzugehen. So war Giovanni Cellini auch als Instrumentenbauer, Kunsthandwerker, Ingenieur und Baumeister tätig und genoss Vergünstigungen wie gestellter Kleidung, Gratisessen und eine Pension, die ihm zustanden. Da das Amt üblicherweise durch Erbfolge vergeben wurde, war es das Sprungbrett für die nächste Generation. Doch zum Leidwesen Giovanni Cellinis, der ein leidenschaftlicher Musiker war, war der Beruf des Pfeifers auf Dauer nicht gut genug für Benvenuto, auch nicht als Brotberuf und Standbein, das ihm Zeit für andere Betätigungen ließ. Klagen über die „zu niedere Kunst“ durchziehen die ersten Kapitel seiner Lebensbeschreibung, ja ein regelrechter Widerwille gegen die Musik. Giovanni Cellini, überzeugt von der musikalischen Begabung des Sohnes, war ehrgeizig und muss ihn emotional unter Druck gesetzt haben. In klagendem Ton bedrängte er ihn. „Der größte Wunsch, den er – was mich betrifft – auf der Welt hatte, war, dass aus mir ein bedeutender Musiker werden sollte.“ Immer wieder liest man, dass es zu Konflikten mit dem Vater kam. Das subalterne Arbeitsverhältnis des piffero aber empfand Benvenuto Cellini als Fron. Er wollte mehr sein als ein Tuttist, der bei offiziellen Empfängen, bei Prozessionen, Turnieren oder Festen als einer unter vielen musizierte. Er war zu sehr Individualist, und der Wunsch, sich seiner Leidenschaft, dem Kunsthandwerk, zu widmen, wurde früh offensichtlich.
Benedetto da Maiano, Drei Pfeifer (links), Skulpturengruppe Incoronazione di Ferdinando d’Aragona, Marmor, Florenz, Museo Nazionale del Bargello
Dass der Beruf des piffero aber durchaus attraktiv war, beweist der Lebensweg des Vaters. Geboren im Jahr 1451, war Giovanni Cellini nicht nur ein erfolgreicher Musiker – mehrfach wird er in den überlieferten Dokumenten als musikalischer Leiter (maestro) der pifferi bezeichnet7 – sondern auch ein Universaltalent und Überlebenskünstler, der sich mit den verschiedenen Herrschern arrangierte. Es gelang ihm in den Wirren der Florentiner Innenpolitik, die sich durch stete Spannungen zwischen Medici-Anhängern und Medici-Gegnern auszeichnete, seine Stelle zu behaupten, ja sogar von den verschiedenen Machthabern geschätzt zu werden. Giovanni Cellinis Interesse galt ursprünglich der Architektur. Musik betrieb er nur als Nebenbeschäftigung. Einer Forderung des römischen Architekturtheoretikers Vitruv entsprechend musste ein guter Baumeister auch musikalische Kenntnisse haben, da sich die Harmoniegesetze der Musik, so glaubte man, in der Architektur spiegelten. Giovanni Cellini begann Viola und Flöte zu spielen. Bald entwickelte er eine Leidenschaft für die Instrumentalmusik, und seine Begabung blieb den pifferi nicht verborgen. 1480, unter der Regentschaft von Lorenzo de’ Medici, dem sogenannten Prächtigen, wurde er bei den Stadtpfeifern aufgenommen. Dennoch war er weiterhin auch als Baumeister gefragt. Luca Landucci berichtet, dass er am 4. Juli 1509 nach dem Tod des Architekten Simone del Pollaiuolo Giovanni Cellini eine Zeichnung gab, nach der gegenüber der Kirche San Lorenzo ein Gotteshaus für den Evangelisten Johannes gebaut werden sollte.
Als Giovanni Cellini 1480 seinen Dienst bei den pifferi antrat, befand sich Florenz in einer kulturellen Blüte. Es war jene Zeit innerhalb der Florentiner Hochkultur, in der die vom Kulturwissenschaftler Aby Warburg konstatierte Erneuerung der heidnischen Antike stattfand. Während der Herrschaft Lorenzos des Prächtigen war der christliche Schöpfergott aus der Mode gekommen. Man huldigte unverhohlen den alten Göttern der Römer und Griechen. Sie bevölkerten den Himmel der Astrologen, die Verse der Poeten und die Gemälde der Maler. So hat eines der berühmtesten Gemälde Botticellis keine christliche Legende, sondern einen antiken Mythos zum Gegenstand – die Geburt der Venus. Sinnlichkeit wurde in dieser neuheidnischen Welt geradezu als göttlich angesehen, und Musik galt als ein wesentlicher Bestandteil des irdischen Frohsinns. Benvenuto Cellini schrieb später, dass das Volk von Florenz sich in Sommernächten auf Straßen und Plätzen häufig versammelte, um improvisierten Gesängen beizuwohnen. Erotisch-blasphemische Karnevalsgesänge, deren Sprachcodes auch Cellini später in seine Gedichte übernahm,8 erfreuten sich großer Beliebtheit.
Das Musikleben in Florenz wurde maßgeblich von Lorenzo de’ Medici geprägt. Er musizierte selbst und gab Kompositionen in Auftrag. Sein Biograf Niccolò Valori, ein Zeitgenosse, schreibt, dass er sich ein Leben lang an der Musik ergötzt habe und er über außerordentliche musikalische Kenntnisse verfügt habe, sodass er es mit jedem anderen auf diesem Gebiet aufnehmen konnte.9 Es war dann aber gerade der Prächtige, bemerkt Cellini, der Giovanni Cellini 1491 zu dessen Unglück bei den pifferi entließ und durch einen deutschen Musiker ersetzte, allerdings nur, weil Lorenzo de’ Medici überzeugt war, Giovanni Cellini solle seine anderen Begabungen – Baukunst, Kunsthandwerk und Instrumentenbau – bevorzugt pflegen. Die Liebe zur Musik muss allerdings derart ausgeprägt gewesen sein, dass er 1495 nach der Vertreibung der Medici unter dem kunstkritischen Regiment Savonarolas zu den Stadtpfeifern zurückkehrte, um die Contralto- und Controbasso-Partien zu übernehmen, zunächst als Aushilfe ohne Honorar. Mit 50 Florin, die er einem gewissen Adamo Adami für dessen Ausscheiden bezahlte, kaufte sich Giovanni Cellini 1497 in das Ensemble ein und blieb bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1514. Wie wichtig ihm die Stelle war, zeigt, dass er sogar einen Rechtsbruch beging, da Ensemblestellen nicht veräußert werden durften. Giovanni Cellini wurde bei der Obrigkeit denunziert, ging jedoch straffrei aus und konnte die Stelle behalten.10 Auch nach seinem Ausscheiden blieb er der Ensemblemusik treu. Gemeinsam mit seinem Sohn trat er hin und wieder mit den Pfeifern der Parte Guelfa auf.
Machiavelli begriff seine Heimatstadt in seiner Geschichte von Florenz als ein lebendiges Wesen und die Entwicklung ihrer Regierungsformen als naturgemäß. Im Lauf von wenigen Generationen hatten die Florentiner die unterschiedlichsten Herrschaftsformen und hegemonialen Ansprüche kennengelernt: Adelsherrschaft, Kämpfe des Mittelstands mit den Arbeitern, Tyrannis, republikanische Verfassung und Scheindemokratie, Primat einer Familie und Theokratie. Auch Giovanni Cellini sah Herrscher kommen und gehen. Dabei war es ihm wie einem Chamäleon gelungen, sich stets anzupassen: Nach Lorenzo de’ Medici und der Vertreibung seines Sohnes Piero im Jahr 1494 diente er Savonarolas Volksregierung, nach dessen Hinrichtung 1498 dem Gonfaloniere auf Lebenszeit Piero Soderini; und nach dessen Flucht 1512 wurde er Zeuge der Rückkehr der Medici unter Kardinal Giovanni de’ Medici. Er muss eine angesehene Persönlichkeit gewesen sein, insbesondere Piero Soderini schätzte seine Fähigkeiten. Am 26. Juli 1503 zahlte die Signoria Giovanni Cellini 56 Lire und 13 Soldi, damit er als Begleiter von Leonardo da Vinci in das Lager bei Pisa fahren konnte, wo – der politischen Spannungen zwischen Florenz und Pisa wegen – Beratungen über die Umleitung des Arno stattfanden. Leonardo da Vinci plante unter Mithilfe Giovanni Cellinis, den Fluss zum Vorteil von Florenz zu verlegen. Die Pisaner sollten vom Wasserweg abgeschnitten werden. Doch ausgetrocknet waren am Ende nur die Finanzen der Stadt Florenz, da das Unternehmen scheiterte. Im Januar 1504 wurde Giovanni Cellini eine Ehre zuteil, die für sein hohes gesellschaftliches Renommee spricht. Er wurde als einziger Musiker Stimmberechtigter in einer Jury, die darüber zu bestimmen hatte, an welchem Ort in Florenz Michelangelos David aufgestellt werden sollte. Die Namen der anderen Experten lesen sich wie das Who‘s who der damals in Florenz ansässigen Künstler: Wahlberechtigt waren unter anderem Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Andrea della Robbia, Giuliano da Sangallo Perugino, Filippino Lippi, Lorenzo di Credi, Francesco Granacci und Piero di Cosimo.
Hatte der David ursprünglich eine kirchliche Bestimmung, sah man in ihm bald ein Symbol des republikanischen Sieges gegen die Medici. Wie der Hirtenjunge David gegen den Riesen Goliath triumphierte, so hatte sich die Stadt gegen die mächtige Familie behauptet. Die Entscheidung, wo er positioniert werden sollte, war damit ein Politikum höchsten Ranges. Es wurden Standorte in der Nähe der kirchlichen und der politischen Schaltzentralen vorgeschlagen, am Dom (Botticelli) oder nahe dem Palazzo della Signoria. Giovanni Cellini, der im Abstimmungsprotokoll als Regierungsbeamter aufgeführt wird,11 plädierte für die Loggia della Signoria oder alternativ für den Innenhof des Palazzo. Er entsprach damit der Erwartungshaltung seines Dienstherrn, denn der Fingerzeig war mit seinem Juryurteil garantiert. Giovanni Cellini sorgte dafür, dass Michelangelos David zu einem Zeichen republikanischer Identität wurde. Es gehört allerdings zur Ironie der Cellini, dass es später sein Sohn Benvenuto war, der über seine Perseus-Statue in unmittelbarer Nähe des David die Alleinherrschaft eines Medici-Fürsten pries.
Seinen Talenten entsprechend breit einsetzbar, erhielt Giovanni Cellini im Februar 1505 Haushaltsmittel, um das Gerüst zu bauen, mithilfe dessen Leonardo da Vinci in der Sala del Consiglio des Regierungspalastes die Schlacht von Anghiari malte. Er besorgte Leonardo auch die Farben für das Monumentalgemälde. Dass sein Sohn Benvenuto später während seines Aufenthalts in Frankreich von König Franz I. ähnlich großzügig behandelt wurde wie Leonardo, erfüllte Benvenuto Cellini mit Stolz, zeigte es doch seinen sozialen Aufstieg.
Sowohl Giovanni als auch Benvenuto Cellini waren Musiker, die mehrere Instrumente beherrschten und sich auf vielen Gebieten der Musik auskannten. Das Repertoire der Stadtpfeifer umfasste neben Unterhaltungsmusik – sie spielten unter anderem der Signoria zu Tisch auf – auch Instrumentalfassungen von Vokalmotetten und Improvisationen, da sie bei unterschiedlichen Gelegenheiten und auf Abruf auftreten mussten. Da traditionell immer auch Deutsche und Flamen zu den Ensemblemitgliedern zählten, dürfte das Repertoire nicht nur auf italienische Kompositionen beschränkt gewesen sein. Die Stadtpfeifer setzten sich aus vier Bläsern, drei Schalmeispielern und einem Trompeter zusammen, gelegentlich wurde das Ensemble durch Aushilfen erweitert. Giovanni Cellini spielte neben der Schalmei die Viola und die Flöte, darüber hinaus muss er Grundkenntnisse im Orgel-, Clavicembalo-, Lauten- und Harfenspiel gehabt haben, da er diese Instrumente baute. Seinen Sohn Benvenuto lehrte er Flöte, Trompete, Horn und Schalmei spielen, Gesang und Komposition. Cellini berichtet, wie er in noch zartem Alter, auf den Schultern eines Magistratsbeamten sitzend, zusammen mit dem Vater und den anderen Musikern vor der Signoria auftrat und dabei den Part der Sopranflöte übernahm. Jener frühen Förderung war es auch zu verdanken, dass Benvenuto mit nur elf Jahren eine Stelle in der Kapelle der Parte Guelfa bekam.
Von Giovanni Cellini sind keine schriftlichen Stellungnahmen überliefert. Sein Leben lässt sich nur aus Amtsurkunden und Rechnungsbüchern, beiläufigen Bemerkungen Dritter und dem Bericht des Sohnes rekonstruieren. Benvenuto Cellini zeichnet in seiner Lebensbeschreibung ein liebevolles, aber auch kritisches Bild des Vaters. Vieles, was er später mit großem Selbstbewusstsein für sich selbst beanspruchen wird, legt er bereits im Vater an: die dichterische und prophetische Ader, Akribie, Durchsetzungsvermögen, Autorität, Mut, den lockeren Umgang mit den Gesetzen, die Regelüberschreitung – eine Liebesheirat, wie sie Giovanni gegen den Willen seines Vaters eingehen sollte, war ungewöhnlich – sowie die Perfektion und Innovation im Kunsthandwerk. Mit großer Faszination berichtet Benvenuto, wie sein Vater einen Spiegel aus Knochen und Elfenbein in Form eines Glücksrads baute, den er kunstvoll mit Intarsien und einem lateinischen Vers versah. Selbst die körperliche Robustheit und Vitalität war beiden Männern gemeinsam und ließ sie ein hohes Alter erreichen. Giovanni Cellini starb erst 1527 mit sechsundsiebzig Jahren an der Pest. Doch war er in den Augen des Sohnes auch ein Opfer seiner Leidenschaft für die „niedere Kunst“ der Musik und seines Sicherheitsdenkens. Selbst das Zureden Lorenzos des Prächtigen habe nicht bewirkt, dass der Vater von seiner Neigung dauerhaft abließ. Unterschwellig klingt der Vorwurf des Provinzialismus an, denn im Gegensatz zu Benvenuto, der den Instinkt des Zugvogels besaß, blieb Giovanni Cellinis Wirkungskreis stets auf Florenz beschränkt. Er hätte, so die implizite Aussage des Sohnes, mehr aus seinen Begabungen in Kunsthandwerk und Ingenieurwesen machen können. Der Kampf mit dem Vater trug aber zu Cellinis Identitätsfindung als bildender Künstler bei. Nur über die Auseinandersetzung mit dem autoritären Familienoberhaupt, das den Beruf des Musikers exemplarisch verkörperte, fand Cellini seine Berufung zur bildenden Kunst.
Von der Existenz der Mutter, Elisabetta Granacci, weiß die Nachwelt bis auf einen Geburtseintrag in einem Steuerverzeichnis nur über die Lebensbeschreibung des Sohnes. Sie wurde 1464 geboren und war dreizehn Jahre jünger als ihr Mann. Ihre Eltern lebten in unmittelbarer Nachbarschaft der Cellini. Elisabetta Granacci hatte mehrere Geschwister und muss „außergewöhnlich schön“ gewesen sein. Als feststand, dass die beiden Nachbarskinder heiraten wollten und die Väter um die Mitgift der Braut feilschten – Elisabetta entstammte keiner wohlhabenden Familie –, war Giovanni bereits derart verliebt in sie, dass er sich trotz des Widerstands seines Vaters entschloss, auf die Aussteuer zu verzichten. Der Liebesheirat entsprangen dann sechs Kinder, von denen zwei Söhne, Benvenuto und der jüngere Giovan Francesco (Cecchino), sowie zwei Töchter, Benvenutos ältere Schwester Nicolosa (Cosa) und Liperata, das Kindesalter überlebten.12
Wie der Historiker Anthony Grafton bemerkt, waren die Florentiner des 15. Jahrhunderts „alles andere als Feministen“.13 Durch Auswertung unzähliger Dokumente in Florentiner Archiven haben Sozialgeschichtsforscher herausgefunden, dass die Stellung der Frau in der Florentiner Renaissance durch die herrschenden Normen von Herkommen und Recht besonders schwach war.14 Die Gesellschaft war durch und durch patriarchalisch. Das von Humanisten entworfene Frauenbild trug dazu bei. Leon Battista Alberti (1404–1472) entwarf in seinem Dialog Vom Hauswesen, in dessen drittem Buch eine mustergültige Florentiner Ehe skizziert wird, das Ideal einer bescheidenen Hausfrau, die dem Mann untertan still im Hintergrund wirkt. Schweigen außerhalb des Hauses, ordnende Tätigkeit im Inneren, so lauteten die wichtigsten Gebote für eine verheiratete Florentinerin. Dementsprechend ist anzunehmen, dass auch Elisabetta Granacci, kaum war der Brautkranz verwelkt, die Sorge für Haushalt und Familie weitgehend alleine trug und ein zurückgezogenes Leben führte. Selbst ihrem Sohn Benvenuto, der zu misogynen Ausfällen neigte – Frauen sind laut Cellini oft materialistisch, geschwätzig oder intrigant –, schien ihre Existenz nicht weiter erwähnenswert. Er widmet ihr außer dem Hinweis, dass sich die Eltern einer „heiligen Liebe“ erfreuten, kaum ein Wort.