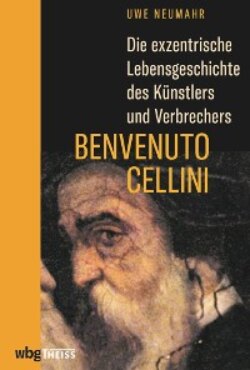Читать книгу Die exzentrische Lebensgeschichte des Künstlers und Verbrechers Benvenuto Cellini - Uwe Neumahr - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bildungsweg in unruhigen Zeiten
ОглавлениеNach Savonarolas Hinrichtung schwelte der Konflikt zwischen den Befürwortern einer Volksregierung und einer Oligarchie in Florenz weiter. Die kurze Amtsdauer von zwei Monaten, die einer Signoria und dem Gonfaloniere, ihrem Präsidenten, zur Verfügung standen, verhinderte eine ruhige und ordnungsgemäße Führung der Amtsgeschäfte. 1502 versuchte der Rat, diesem Problem wenigstens teilweise Herr zu werden, indem ein Gonfaloniere auf Lebenszeit gewählt wurde. Die Wahl fiel auf Piero Soderini, einen dem Volk freundlich gesinnten Patrioten, der sich weigerte, zum Werkzeug der großen Familien zu werden. Sein Ehrgeiz war allerdings nicht so ausgeprägt, dass die Florentiner diktatorische Gelüste befürchten mussten. Machiavelli, der zu seinen Ratgebern zählte, bemängelte seine Entscheidungsschwäche. Als verhängnisvoll sollte sich Soderinis Außenpolitik erweisen, denn Florenz hatte sich in die Abhängigkeit Frankreichs begeben. Nachdem es der Heiligen Liga unter der Führung von Papst Julius II. 1512 gelungen war, die Franzosen aus Italien zu vertreiben, wurde auf einem Landtag in Mantua beschlossen, den franzosenfreundlichen Soderini abzustrafen und die exilierten Medici wieder in Florenz einzusetzen. Spanische Truppen wurden zur Eroberung der Stadt entsandt. Florenz leistete Widerstand, und Machiavelli unternahm alles, um seine Verteidigung sicherzustellen. Doch nachdem Prato, ein Außenposten, eingenommen worden war und dort auf grauenvolle Weise gebrandschatzt wurde, trat Soderini von seinem Amt zurück, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Am 1. September 1512, nach achtzehnjähriger Verbannung, zogen die Medici unter dem Schutz des spanischen Vizekönigs wieder in Florenz ein. Machiavelli, der schärfste politische Beobachter seiner Zeit, schrieb, dass der Staat auf Befehl des spanischen Vizekönigs wieder so gestaltet werden sollte „wie zur Zeit Lorenzos des Prächtigen“.24 Es wurde eine Art oligarchische Staatsform errichtet, deren Ziel die Sicherung der Macht der Medici war. So traten bald die beiden Söhne des Prächtigen in Erscheinung: Kardinal Giovanni de’ Medici und sein Bruder Giuliano, Herzog von Nemours. Ihr Neffe Lorenzo begleitete sie. Giuliano, Erbe des Hauses Medici, wurde an die Spitze der Republik gesetzt, aber in Wirklichkeit behielt der Kardinal die Zügel in der Hand. Die palle, die Kugeln des Medici-Wappens, von den Gegnern der Medici systematisch ausgemerzt, wurden überall wieder angebracht als Symbol der neugewonnenen Souveränität. Die Medici verstanden es, Mäßigung zu üben, und ein Großteil der führenden Familien, der ständigen Unruhen überdrüssig, unterstützte die neuen Herren willig, empfand man die Herrschaft der Medici doch als Gewähr für Ordnung und Sicherheit. Bald bestieg Kardinal Giovanni unter dem Namen Leo X. den päpstlichen Stuhl. Die Florentiner feierten dieses Ereignis mit unbändiger Freude. Giuliano de’ Medici, ein friedfertiger und musisch veranlagter junger Mann, regierte Florenz jedoch nur ein knappes Jahr. Dann wich er seinem Neffen Lorenzo. Dieser ehrgeizige junge Herrscher, der nichts anderes als eine Marionette des Papstes war, starb nach sechs Jahren rücksichtslosen Regierens an der Syphilis. In der Folge gab Kardinal Giulio de’ Medici, ein illegitimer Sohn des Giuliano, den Leo X. zum Erzbischof von Florenz ernannt hatte, seiner Heimatstadt eine gute Verwaltung. Als er 1523 selbst Papst wurde und den Namen Clemens VII. annahm, regierte er die Stadt von Rom aus über einen Mittelsmann.
Die Wahl gleich zweier Medici zu Päpsten innerhalb kurzer Zeit war auch für die Cellinis vorteilhaft. Wechselhaft wie die meisten ihrer Mitbürger dienten sie sich den neuen Herren an. Giovanni Cellini hatte die Wahl Kardinal Giovannis zum Papst in einer öffentlich einsehbaren Inschrift unter deren Familienwappen vorhergesagt. Der geschmeichelte Papst, der das prophetische Epigramm zugeschickt bekam, rief ihn nach Rom, doch Giovanni weigerte sich zu kommen, womit sein Unglück laut Benvenuto Cellini begann. Republikanischer Gesinnung verdächtig, wurde Giovanni Cellini noch 1514 vom amtierenden Gonfaloniere seines Amtes bei den pifferi enthoben. Der väterliche Fehler – um einen solchen handelte es sich nach Benvenutos Ansicht – bedeutete für den Sohn eine willkommene Legitimierung. Denn mit Giovanni Cellinis Entlassung wurde klar, dass der Beruf des Stadtpfeifers keineswegs sicher war. Deshalb, aus existenziellen Gründen, „widmete ich mich der Goldschmiedekunst, […]“, bemerkt Cellini, um seine innere Abwendung von der Musik zu rechtfertigen, auch wenn die Jahre später verfasste Begründung vorgeschoben war. Denn Giovanni Cellinis Entlassung hatte tatsächlich andere Gründe.25
Über die Bildung, die Cellini in diesen Jahren zuteilwurde, ist nichts bekannt. Später kokettierte er mit seinem mangelnden Wissen, indem er sich in Gedichten selbstironisch Il Boschereccio nannte, einen ungeschliffenen, groben Klotz. Grundlegende Schulkenntnisse hatte er erworben. Florenz verfügte damals über ein dreistufiges Schulsystem. Neben der Elementarschule, in der Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren in Lesen und Schreiben in der Volkssprache unterrichtet wurden, gab es die weiterführende Abakusschule. Dort wurden die zehn- bis dreizehnjährigen Jungen auf kaufmännische Berufe vorbereitet. Auf das Universitätsstudium bereitete schließlich die Lateinschule vor, in der lateinische Grammatik und Logik unterrichtet wurden. Der jeweilige Unterricht blieb ausschließlich den Kindern von zahlungskräftigen Bürgern vorbehalten, da diese für die Ausbildung ihrer Sprösslinge bezahlen mussten. Cellini besuchte, wie viele Kunsthandwerker, wohl zumindest die Elementarschule. Alles Berufsrelevante übernahm dann der Goldschmiedemeister. Buchführung und Rechnungstellung waren wichtige Tätigkeitsfelder eines Goldschmieds, weshalb der Meister auch Grundkenntnisse in diesen Bereichen vermittelte. Laut Eigenaussage konnte Cellini kein Latein. Über die Liturgie und die Bibel dürfte er ein wenig verstanden haben.26 Der Vater, der ein gebildeter Mann war und lateinische Epigramme schrieb, legte offensichtlich nur bei Cecchino Wert auf Kenntnisse der alten Sprachen, da er ihn ursprünglich zum Juristen auserkoren hatte. Cellini verfügte jedenfalls nicht wie etwa Leon Battista Alberti über eine universitäre Ausbildung, die für den intellektuellen Diskurs in der Florentiner Renaissance bestimmend war. Er hatte auch keinen Privatlehrer wie Giorgio Vasari, der laut Eigenaussage von einem Humanisten unterrichtet wurde. Cellini war jedoch sein Leben lang bildungshungrig und betrieb ein ausgiebiges Selbststudium. Ein Inventar der Besitztümer, das nach seinem Tod erstellt wurde, verzeichnet achtzehn gedruckte Bücher verschiedenen Inhalts und ein Dante-Manuskript. Er besaß eine Abschrift von Leonardos Notizen zur Bildhauerei, Malerei und Architektur und er kannte die Architekturbücher von Leon Battista Alberti und Sebastiano Serlio sowie Daniele Barbaros Vitruv-Kommentar. Cellinis Bildungshorizont erweiterte sich stets und reichte weit über das durchschnittliche Wissen eines Goldschmieds hinaus. Später verkehrte er mit Gelehrten wie Luigi Alamanni oder Benedetto Varchi, die seine Schriften verbesserten und von deren Wissen er profitierte, unter anderem für die der antiken Mythologie entnommenen Bildprogramme seiner Werke. Als bildender Künstler war Cellini bestrebt, wie er es selbst formuliert, Werke von „tieferer Bedeutung“ zu schaffen, die auch über eine interpretatorische Ebene verfügen. Sein Meisterwerk in dieser Hinsicht wurde das ingeniös gestaltete Salzfass, das den Betrachter zum Entziffern einlädt und Cellini als Gelehrten ausweist. Gerne polemisierte er gegen Kollegen, die ausschließlich gefällige Werke ohne Bedeutungsebene schufen.
Obwohl er über keinerlei Ausbildung auf dem Gebiet der Literatur verfügte, war Cellini ein origineller Autor und durchaus belesen. Hinter der vermeintlich naiven Diktion seiner Lebensbeschreibung verbergen sich zahlreiche literarische Reminiszenzen. Er amalgamierte Texte Dantes, Petrarcas und Boccaccios, vermengte Gattungen wie Abenteuerroman und Pícaro-Erzählung sowie Künstler- und Heiligenvita und kannte, zumindest rudimentär, den philosophischen und medizinischen Diskurs seiner Zeit. Einen ausgezeichneten medizinischen Ratgeber hatte Cellini in Guido Guidi, dem Leibarzt von König Franz I., der mit Cellini mehrere Jahre in Paris unter einem Dach lebte. Wie Guido Guidi in seinem Traktat Chirurgia schreibt, arbeitete Cellini aktiv mit Chirurgen zusammen, etwa mit Giacomo Rastelli, dem Arzt von Papst Clemens VII., für den Cellini chirurgische Instrumente fertigte.27 Neuplatonische Gedanken, die die Präsenz des Göttlichen in den irdischen Elementen betonen, kommen in Cellinis Schriften als Vulgata der Thesen Marsilio Ficinos vor. In Cellinis Lebensbeschreibung finden sich zudem alchemistische Anklänge.28 Als Dichter war er kreativ, indem er neue Worte erfand, etwa das Verb ducare,29 zudem entwickelte er eigene Erzählstrategien. Dass Cellini so bunt und lebendig zu erzählen wusste, ist auch auf die vielen direkten Reden zurückzuführen, die er in seine Lebensbeschreibung einfügte. In keinem zeitgenössischen Lebensbericht kommen sie so häufig vor wie in Cellinis Vita.30 Weil er unter anderem einen kurzen Essay über die führenden Praktiker und Theoretiker der Architektur schrieb und sich sogar mit der Pädagogik des Zeichnens befasste, nannten ihn einige Forscher einen uomo universale, was zweifellos übertrieben ist.
Cellini hatte keinen universellen Bildungsanspruch. Systematisches Denken oder gar Theoretisieren waren ihm fremd. Er empfand auch keine Leidenschaft für die Empirie wie Leonardo da Vinci. Seine Äußerungen im Rangstreit der Künste deuten darauf hin, dass er eher spontan argumentierte. Seine Aussagen sind manchmal widersprüchlich. So schreibt er in einem Brief an Benedetto Varchi, ein Werk der Bildhauerei müsse acht Ansichten haben, während er in seiner Abhandlung anlässlich Michelangelos Totenfeier behauptet, ein solches Werk solle über „hundert Ansichten oder mehr“ verfügen. In seinem Traktat über die Zeichenkunst reduziert Cellini die Ansichten schließlich wieder auf „vierzig oder mehr“. Cellini pflegte jedoch mit vorgeschobenem Understatement seine Rolle als intellektueller Außenseiter und suchte nach Bestätigung, etwa wenn er von seinem „beschränkten Geist“ (basso ingegno) oder seiner „Wald- und Wiesenphilosophie“ (boschereccia filosofia) spricht. Der beständige Verweis auf seinen Durchschnittsintellekt, insbesondere in seinen Gedichten zum Rangstreit der Künste, war natürlich auch ein schlauer Kunstgriff. Er gewährte Cellini in der Auseinandersetzung mit humanistisch gebildeten Gegnern Narrenfreiheit. Indem sich Cellini als ungebildet bezeichnete, hatte er die Freiheit zu sagen was er wollte. Bezeichnend für sein wechselhaftes Temperament ist aber auch, dass er sich mitunter ganz anders gab. In seiner Lebensbeschreibung stilisiert er sich immer wieder als gelehrter Künstler, der – welch Triumph für den Emporkömmling aus der Florentiner Mittelschicht – sogar den französischen König belehrt, indem er ihm die allegorischen Bedeutungen seiner Figuren erklärt.