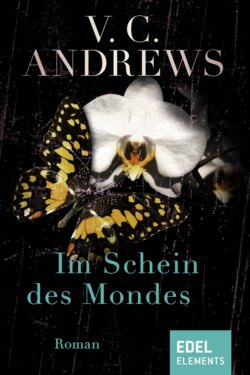Читать книгу Im Schein des Mondes - V.C. Andrews - Страница 6
ОглавлениеPROLOG
An meinem sechzehnten Geburtstag trübte kein einziges Wölkchen den Himmel. Ein tiefblaues Meer erstreckte sich von einem Horizont zum anderen. Der warme Wind, der nach Hyazinthen, Flieder und Narzissen duftete, wehte so sanft wie der Flügelschlag eines Sperlings.
Es war wie ein Zauber.
Am Tag zuvor hatte ich Mommy bei Einbruch der Dämmerung die Rampe hinuntergeschoben und sie Richtung See gefahren.
»Da ist eine!«, rief Mommy, sobald sie die erste Spottdrossel erblickte, die aus einem Baum aufgeflogen war und jetzt über das Wasser glitt.
Da hielten wir uns wie so oft an den Händen, schlossen die Augen und wünschten uns etwas. Das war unser ganz spezielles geheimes Ritual, etwas, das wir begonnen hatten, als ich vier Jahre alt war. Sie glaubte an die Macht des Sees und seiner Umgebung.
»Ich fing damit an, sobald ich hierher kam, um bei deiner Urgroßmutter Hudson zu leben«, erzählte sie mir.»Bis dahin war die einzige größere Wassermenge, in deren Nähe ich je gekommen war, die in meiner Badewanne. Ein Ort wie dieser passte vollkommen zu meinen Träumen und tut es immer noch. Ich weiß, er wird auch für deine Träume vollkommen sein, Summer.«
Wir hatten uns beide einen wunderschönen nächsten Tag gewünscht. Ich stellte mir einen Tag vor, an dem das Lächeln vom Himmel herabschwebte und sich auf den Gesichtern all meiner Verwandten und Freunde festsetzte, so dass sie jeden traurigen oder quälenden Gedanken, jeden unglücklichen Augenblick vergaßen. So würden wir alle in Harmonie mein neues Lebensjahr einläuten. Mommy glaubte, wir brauchten hier und da ein bisschen Magie, um uns zu beschützen, uns besonders.
Ich widersprach ihr nicht, denn mittlerweile war ich nicht mehr in einem Alter, in dem man all die Tragödien und Fehler, die die Geschichte unserer Familie kennzeichneten, von mir fern hielt. Mommy gestand, dass sie manchmal – vielleicht eher häufiger als nur manchmal – wirklich glaubte, ein Fluch laste auf jedem ihrer Schritte, jedem Atemzug, selbst auf jedem Gedanken.
»Jeder andere wäre vermutlich an einen Punkt gekommen, wo er unfähig wäre, noch eine einzige Entscheidung zu treffen, Summer. Meine Hände zitterten auf dem Lenkrad meines speziell ausgerüsteten Transporters, selbst wenn ich mich einer ganz normalen Kreuzung näherte und mich bloß zu entscheiden hatte, ob ich rechts oder links fahren wollte. Bestimmt würde etwas Schreckliches passieren, wenn ich die falsche Entscheidung traf. Der einzige Grund, warum ich nicht vor Furcht erstarrte, war, dass ich ständig die Stimme meiner Adoptivmutter hörte, die mich vorwärts drängte und mit mir schimpfte, weil ich Angst hatte«, sagte Mommy. »Diese Frau wäre selbst mit einem Armageddon fertig geworden.«
Ich konnte Mommys Angst verstehen und fragte mich oft, ob solch ein Fluch an mich weitergereicht werden könnte. Das war auch Mommys schlimmste Sorge.
»Wenn nun das Größte, Stärkste, das ich dir mitgegeben habe, mein eigenes Pech wäre?«, sagte Mommy plötzlich, als hätte sie meine Gedanken gelesen.
»Das ist doch albern, Mommy«, widersprach ich ihr, obwohl ich mir nicht sicher war. »So etwas wie zu Pech verurteilt zu sein gibt es nicht. Das ist doch nur Zufall, und niemand hat Schuld daran. Du kannst doch nicht die Ursache von irgendjemandes Schwierigkeiten sein«, beharrte ich, und zwar mit solchem Nachdruck, dass sie lachen musste und mir versprach, nicht wieder über so finstere Gedanken mit mir zu sprechen.
Aber sie tat es. Sie konnte nicht anders. Sie schleppte einen Sack voller Schuldgefühle mit sich herum.
Besonders verfolgten sie die Erinnerungen an ihre Stiefschwester Beneatha, die in Washington – wo Mommy früher gelebt hatte – von Mitgliedern einer Straßengang ermordet worden war. Quälend war auch der Autounfall, bei dem ihr Halbbruder – mein Onkel Brody, den ich nie kennen gelernt hatte – getötet worden war. Als ich mir sein Foto anschaute, sah ich, wie gut er ausgesehen hatte und wie vielversprechend die Zukunft für ihn gewesen sein musste. Er starb, als er nach einem Besuch bei Mommy, die eine Weile ganz allein hier gelebt hatte, nach Hause raste. Großmutter Megan, Mommys leibliche Mutter, erlitt einen schrecklichen Nervenzusammenbruch nach Onkel Brodys Tod und versuchte Selbstmord zu begehen.
Tante Alison, Brodys Schwester, hegte immer noch einen Groll auf Mommy, obwohl sie das in der letzten Zeit gut kaschierte und zumindest höflich war, wenn sie uns besuchte, was allerdings nicht oft der Fall war. Vor kurzem hatte sie eine hässliche Scheidung hinter sich gebracht, bei der ihr Mann sie des Ehebruchs beschuldigte – und nicht nur mit einem Geliebten! Das erzählte man mir allerdings nicht. Das schnappte ich zufällig auf.
In unserem Haus bleiben Geheimnisse nie lange verborgen.
Jeder würde denken, dass Tante Alison Mitleid mit Mommy hätte. Nicht lange nach Brodys Tod erlitt Mommy durch einen Sturz vom Pferd eine Querschnittslähmung. Danach hatte sie Schreckliches unter Tante Victoria, Großmutter Megans merkwürdiger, verrückter Schwester, zu erdulden. Eine Weile hielt sie Mommy wie eine Gefangene in diesem Haus. Mommy hasste es, darüber zu reden. Sie sagte, es würde ihre Alpträume wieder zum Leben erwecken. Aber Mommy glaubte, sie sei dafür bestraft worden, dass sie all dieses Unglück brächte. Sie glaubte tatsächlich, es verdient zu haben, und wenn mein Vater Austin nicht gewesen wäre, der damals ihr Physiotherapeut war, wäre es ihr vielleicht gelungen, sich in eben diesem See, der jetzt so heiter und ruhig vor uns lag, das Leben zu nehmen.
Wir hatten diesen See mit genug Tränen gefüllt, schien mir. Jetzt war Zeit für Heiterkeit, Lachen und Sonnenschein, und wenn meine Geburt und meine Geburtstage nötig waren, um diese Gefühle immer stärker werden zu lassen, war ich froh darüber.
Von dem Punkt aus, an dem wir den See überblickten, um unsere Wünsche auszusprechen, sahen wir Onkel Roy, Mommys Stiefbruder, der eine Fensterlade seines Hauses reparierte. Nachdem er die Armee verlassen hatte, hatte Mommy ihn gebeten, für das Bauunternehmen zu arbeiten, das ihr und Großmutter Megan gehörte. Er wurde Vorarbeiter und begann sich mit meinem Kindermädchen Glenda Robinson zu verabreden, einer unverheirateten Mutter mit einem Kind, das nur ein Jahr älter war als ich, einem Jungen namens Harley. Als Onkel Roy ihr einen Antrag machte und sie zustimmte, ihn zu heiraten, entschied Mommy, dass sie sich auf unserem Grund und Boden ein Haus bauen sollten.
»Ich besitze doch all dieses Land, Roy«, sagte sie, »aber ich habe keine Verwendung dafür. Ich werde weder Baumwolle noch Tabak anpflanzen. Das ist nicht Tara«, scherzte sie.
Nach dem, was sie mir erzählte, war Onkel Roy alles andere als erpicht darauf, das zu tun. Sie musste meinen Vater dazu bringen, ihn dazu zu überreden. Onkel Roy hatte seine Gründe, die laut Mommy seinem halsstarrigen Stolz entsprangen. Später erfuhr ich, dass es noch andere Gründe gab, vielleicht noch wichtigere oder tieferliegende Gründe, die im Grunde deines Herzens wurzelten und sich fast täglich Gehör verschafften.
Mommy beschrieb mir gerne die dramatischen Szenen aus ihrer Vergangenheit, wobei ihre Stimme tiefer wurde, um Onkel Roy nachzumachen. Manchmal lachte ich, manchmal hörte ich staunend zu, völlig fasziniert von ihrer Fähigkeit, alles direkt vor mir erstehen zu lassen. Schließlich hatte Mommy eine renommierte Londoner Schauspielschule besucht und wäre fast Schauspielerin geworden.
»Roy wollte trotzdem kein Haus hier bauen«, erzählte sie mir. »Ich warf ihm vor, er hätte Angst, eine weiße Frau zu heiraten und mit einem weißen Mann, der eine Afroamerikanerin geheiratet hat, auf dem gleichen Anwesen zu leben.
›Du bist doch halb weiß‹, erinnerte Roy mich.
›Vor hundertfünfzig Jahren‹, entgegnete ich, ›wäre ich trotzdem eine Sklavin, Roy Arnold. Versuch mir nicht das Gefühl zu geben, ich wäre schlechter oder besser als du. Wenn Mama Latisha so ein Gerede hörte, würde sie dir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen‹, sagte ich ihm und drohte ihm mit dem Finger. Er musste den Kopf schütteln und lachen. Darauf gab er nach und baute das Haus«, erzählte sie mir.
Ein Jahr später heiratete er Glenda. Sie bekamen ein Mädchen, das sie nach Onkel Roys Mutter und Mommys Adoptivmutter Latisha nannten. Sie war ein hübsches Kind, aber kurz nach ihrem dritten Geburtstag bekam sie Leukämie. Sie verfiel so schnell, dass den Ärzten kaum Zeit blieb, ihnen zu sagen, wie wenig Hoffnung bestand.
Es brachte Tante Glenda fast um. Beinahe verlor sie ihren Glauben. Aber dann wurde sie, statt Gott zu hassen, sehr religiös. Harley erzählte mir einmal, dass seine Mutter glaubte, Kinder würden für die Sünden ihrer Eltern bestraft. Nach dem Tod der kleinen Latisha glaubte Tante Glenda, wenn sie nicht rechtschaffen würde, müsste ihre Tochter im Jenseits noch mehr leiden. Sie ging ganz in dieser Vorstellung auf und so, wie er es sagte, wusste ich, dass auch er trauerte, aber nicht nur um seine Schwester. Er trauerte ebenso darum, dass er seine Mutter an diese Tragödie verloren hatte, die danach seine Erziehung mehr oder weniger meinem Onkel Roy überließ.
»Man würde gar nicht merken, dass ich jetzt ein Einzelkind bin«, sagte er mir. »Meine Mutter benimmt sich so, als wäre Latisha noch bei uns, schliefe nur dort draußen unter den Sternen. Manchmal benimmt sie sich so, als könnte sie sie hören. Sie lässt all ihre Sachen draußen, wäscht und bügelt sogar ihre Kleidung. Das macht Roy und mich verrückt.«
Die schlimmste Art von Geschwisterrivalität war, gezwungen zu sein, mit einer toten Schwester um die Aufmerksamkeit der Mutter zu kämpfen.
Sie begruben Latisha auf dem Anwesen in der Nähe ihres Hauses. Onkel Roy errichtete einen hübschen Zaun und ein Tor um ihr Grab und den Grabstein. Tante Glenda hatte es in ein Heiligtum verwandelt, und es verging kein Tag, an dem sie nicht dort war und am Grabstein ihrer kleinen Tochter betete.
Wenn ich nachts aus dem Fenster schaute, sah ich oft eine brennende Kerze. Glendas Silhouette zeichnete sich unter den Sternen oder unter einem bewölkten Himmel ab. Einmal sah ich sie sogar in einem Gewitter dort draußen, wie sie ihren Schirm umklammert hielt und sich nicht um die Blitze kümmerte, die um sie herum zuckten.
»Eine Mutter kann nie loslassen«, sagte Mommy mir, als wir über die Dinge sprachen, die Harley mir erzählt hatte, »selbst wenn sie die Hand ins Feuer strecken muss.«
Bei Latishas Tod war ich noch zu jung, aber Jahre später hörte ich, wie Mommy zu sich selbst murmelte, dass sie wieder einmal jemandem Unglück gebracht hatte.
»Ich hätte Roy weit von mir entfernt leben lassen sollen, wie er es gewollt hat«, stöhnte sie.
Niemand wurde wütender auf sie, wenn sie solche Dinge sagte, als Onkel Roy. Seine Augen funkelten wie ein Glutofen, er plusterte sich auf, wodurch er noch größer und breiter wirkte, und dann senkte er die Stimme, um mit ihr zu schimpfen und ihr zu verbieten, so etwas zu sagen.
»Du bist diejenige, die Mama dafür verprügeln würde«, versicherte er ihr und sein langer, dicker, rechter Zeigefinger deutete wie ein Pfeil auf sie.
Niemand war gern in der Nähe, wenn Onkel Roy wütend wurde – am wenigsten sein Stiefsohn Harley. In dieser Zeit steckte Harley so häufig in der Schule und bei seinen Freunden in Schwierigkeiten, dass Onkel Roys Stirn vom finsteren Gucken erstarrt war zu tiefen Falten und dicken Runzeln.
»Der Herr hat mir eine seltsame Bürde aufgehalst«, hörte ich Onkel Roy Mommy mehr als einmal erzählen. »Er raubte mir die Chance, ein Daddy zu sein, als er Latisha von mir nahm, aber er überließ mir die Verantwortung für einen Jungen, dessen Vater ich gar nicht bin. Du redest davon, dass du mit einem Fluch beladen bist. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas getan habe, um diese Bürde zu verdienen, aber ich muss sie tragen.«
»Mama sagte immer, es ist nicht an uns zu entscheiden, ob das, was der Herr tut, richtig oder falsch ist, Roy.«
»Ja. Das erscheint mir auch nicht richtig.«
Es machte mich traurig, so etwas zu hören. Ich musste an Harley denken. Es ist schwer, dachte ich, ungewollt zu sein. Ich wusste, dass das auch Mommy traurig machte.
Niemand wusste besser als sie, was das bedeutete.
Und ich hoffte und betete, dass es etwas war, was ich nie erfahren würde.