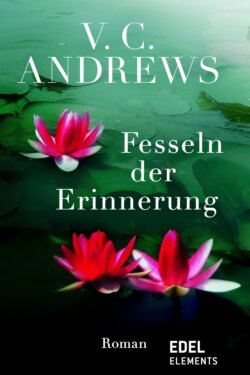Читать книгу Fesseln der Erinnerung - V.C. Andrews - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
Unerledigte Geschäfte
ОглавлениеNachdem Pearl von ihrem Mittagsschlaf aufgewacht war, gab ich ihr ein Fläschchen und nahm sie wieder mit nach draußen, setzte mich an den Straßenrand und hielt nach spätnachmittäglichen Kunden Ausschau. Etwa eine Stunde lang herrschte reges Treiben, und dann wurde es auf der Straße ruhig und leer. Das schwindende Sonnenlicht warf seine langen Schatten auf das Kopfsteinpflaster und verkündete das Ende des Tages.
Mein Herz war schwer. Mr. Tates Besuch hatte eine dichte dunkle Decke über alles geworfen. Ich hatte das Gefühl, Pearl und ich hätten kein Zuhause. Wir gehörten nicht hierher, und wir gehörten nicht nach New Orleans; aber ich glaubte, es würde noch schlimmer sein, hier zu leben, wenn ich Paul erst einmal abgewiesen hatte. Eine Wolke von Traurigkeit würde über unseren Köpfen hängen, jedesmal, wenn er zu Besuch käme; falls er das überhaupt jemals wieder wollte.
Vielleicht hatte Mr. Tate recht. Vielleicht würde Paul tatsächlich endlich jemand anderen finden, nachdem ich ihn abgewiesen hatte; aber ich wußte, daß eine wesentlich größere Chance dafür bestand, wenn Pearl und ich ganz von hier fortgingen und aus seinem Leben verschwanden. Wenn er erst einmal einsah, daß er mich unmöglich heiraten und mit mir zusammenleben konnte, dann würde er sein Glück vielleicht woanders suchen.
Aber wohin hätten wir schon gehen können? Was konnten wir schon tun? fragte ich mich. Ich hatte keine anderen Verwandten, zu denen ich flüchten konnte. Ich brachte Pearl ins Haus und trug die Sachen hinein, die noch draußen lagen. Dabei versuchte ich verzweifelt, mir etwas einfallen zu lassen, was eine Zukunft für uns in sich barg. Endlich hatte ich eine Idee. Ich beschloß, meinen Stolz zu schlucken, mich an den Tisch zu setzen und einen Brief an Daphne zu schreiben.
Liebe Daphne,
ich habe Dir in all der Zeit nicht geschrieben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, daß Du gern von mir hören würdest. Ich werde nicht bestreiten, daß es Dich zu Recht aus der Fassung gebracht hat, von meiner Schwangerschaft und Beaus Kind zu erfahren. Ich bin alt genug, um zu begreifen, daß ich für mein Handeln selbst verantwortlich bin, aber die Abtreibung, die Du arrangiert hattest, konnte ich beim besten Willen nicht vornehmen lassen. Jetzt, wo ich meine Tochter Pearl habe, bin ich froh über meine Entscheidung, obgleich ich weiß, daß wir beide ein schweres Leben haben werden. Ich hatte geglaubt, wenn ich ins Bayou zurückginge, in die Welt, in der ich aufgewachsen bin und glücklich war, dann würde alles wieder gut und ich bräuchte niemandem Probleme zu machen, am allerwenigsten Dir. Wir sind nie miteinander ausgekommen, als mein Vater noch am Leben war, und ich rechne auch nicht damit, daß sich das jemals ändert. Hier liegen die Dinge allerdings nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, und ich bin zu dem Schluß gekommen, daß ich hier nicht bleiben kann. Aber hab keine Angst, ich werde Dich nicht bitten, mich wieder bei Dir aufzunehmen. Ich bitte Dich lediglich darum, mir einen Teil meiner Erbschaft jetzt schon auszuzahlen, damit ich mir und meiner Tochter irgendwo anders ein Leben aufbauen kann... nicht in New Orleans und nicht im Bayou. Damit gibst Du mir nichts, was mir nicht ohnehin zufallen würde; Du gibst es mir nur früher. Ich bin sicher, Du wirst mir zustimmen, daß das ganz und gar im Sinne meines Vaters wäre.
Denk bitte darüber nach, und gib mir so bald wie möglich Bescheid. Ich versichere Dir, daß wir, sobald Du meine Bitte erfüllt hast, wenig oder keinen Kontakt zueinander haben werden.
Hochachtungsvoll Ruby
Während ich den Brief adressierte, hörte ich einen Wagen vor dem Haus vorfahren. Ich unterbrach mich augenblicklich und verbarg den Brief eilig in der Tasche meines Kleides.
»Hallo«, sagte Paul, als er eintrat. »Tut mir leid, daß ich nicht eher gekommen bin. Ich hatte Geschäfte zu erledigen, die mich nach Breaux Bridge geführt haben. Wie hast du deinen Tag verbracht? War viel los?«
»Halbwegs«, sagte ich und senkte den Blick, doch es war schon zu spät.
»Mit dir stimmt etwas nicht«, sagte er. »Was ist passiert?«
»Paul«, sagte ich, nachdem ich tief Atem geholt hatte, »wir können es nicht tun. Wir können nicht heiraten und auf Cypress Woods leben. Ich habe mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht, und ich weißt jetzt, daß es so nicht geht.«
»Weshalb hast du es dir anders überlegt?« fragte er und verzog vor Erstaunen und Enttäuschung das Gesicht. »Du bist gestern im Haus so fröhlich gewesen. Es war, als sei eine dunkle Wolke von deinem Gesicht gezogen worden.«
»Du hast recht gehabt, als du mir von Cypress Woods erzählt hast. Das Haus und das Gelände üben einen Zauber aus. Es war, als seien wir in eine Scheinwelt eingetreten, und eine Zeitlang habe ich mich in ihren Bann ziehen lassen. Dort fällt es einem so leicht, sich etwas vorzumachen und die Wirklichkeit zu vergessen.«
»Na und? Es ist unsere Welt. Ich kann sie so wunderbar gestalten wie jede Phantasiewelt. Und solange wir niemandem damit schaden...«
»Aber wir schaden anderen damit, Paul. Wir schaden einander«, hob ich gequält hervor.
»Nein«, setzte er an, aber ich wußte, daß ich schnell und entschlossen weiterreden mußte, da ich sonst in Tränen ausgebrochen wäre.
»Oh, doch, das tun wir. Wir können uns etwas vormachen. Wir können einander Versprechen abgeben. Wir können unsere speziellen Abmachungen treffen, aber das Ergebnis ist dasselbe ... wir verurteilen einander damit zu einem unnatürlichen Leben.«
»Unnatürlich... mit jemandem zusammenzusein, den man liebt und beschützen will und...«
»Und den man niemals leidenschaftlich umarmen wird, von dem man niemals Kinder haben wird, und wir beide würden niemals die Wahrheit enthüllen... Wir könnten nicht einmal Pearl die Wahrheit sagen, weil wir fürchten müßten, ihr damit zu schaden. Ich kann es nicht tun.«
»Natürlich werden wir es ihr sagen können, wenn sie alt genug ist, um es zu verstehen«, verbesserte er mich. »Und sie wird es verstehen. Sieh mal, Ruby...«
»Nein, Paul. Ich ... ich glaube nicht, daß ich die Opfer bringen kann, die du dir zutraust«, schloß ich.
Er starrte mich einen Moment lang an, und seine Augen waren klein und argwöhnisch. »Ich glaube dir nicht. Es ist etwas Konkretes vorgefallen. Jemand hat mit dir gesprochen. Wer war es? Eine der Freundinnen deiner Grandmère Catherine? Der Geistliche? Wer?«
»Nein«, sagte ich. »Niemand hat mit mir gesprochen, es sei denn, du rechnest meine eigene Vernunft und mein Gewissen dazu.« Ich mußte mich abwenden. Es war mir unerträglich, den Schmerz in seinen Augen zu sehen.
»Aber... ich habe gestern abend mit meinem Vater geredet, und nachdem ich ihm alles erklärt hatte, hat er eingewilligt und mir seine Zustimmung erteilt. Meine Schwestern wissen nichts über die Vergangenheit, und daher waren sie überglücklich, als sie erfahren haben, daß du meine Frau und ihnen eine neue Schwester sein wirst. Und sogar meine Mutter...«
»Was ist mit deiner Mutter, Paul?« fragte ich mit scharfer Stimme. Er schloß die Augen und öffnete sie dann wieder.
»Sie wird es mit der Zeit akzeptieren«, versprach er.
»Akzeptieren heißt noch lange nicht billigen.« Ich schüttelte den Kopf und feuerte meine Worte wie Kanonenkugeln auf ihn ab. »Wenn sie es akzeptiert, dann nur, weil sie dich nicht verlieren will«, sagte ich. »Und überhaupt liegt die Entscheidung nicht bei dir. Sie liegt bei mir«, fügte ich hinzu, und es kam etwas strenger heraus, als ich es beabsichtigt hatte.
Pauls Gesicht wurde weiß.
»Ruby... das Haus... alles, was ich besitze... es ist nur für dich da. Es geht mir dabei überhaupt nicht um mich ... nur um dich und um Pearl.«
»Du mußt etwas für dich selbst tun, Paul. Das solltest du wirklich lernen. Es wäre unrecht von mir, wenn ich so selbstsüchtig wäre zuzulassen, daß du dir eine normale Ehe und eine normale Familie versagst.«
»Aber diese Entscheidung liegt bei mir«, gab er zurück. »Du bist zu... zu verwirrt, um die richtige Entscheidung zu treffen«, sagte ich und wandte den Blick ab.
»Sag, daß du es dir noch einmal überlegen wirst«, flehte er und nickte, um sich selbst davon zu überzeugen, daß immer noch Hoffnung bestand. »Ich komme morgen wieder vorbei, und dann reden wir noch einmal darüber.«
»Nein, Paul. Ich habe meinen Entschluß gefaßt. Es ist zwecklos, weiter darüber zu reden. Ich kann es nicht über mich bringen. Ich kann es einfach nicht«, schluchzte ich und wandte mich von ihm ab. Pearl, die wahrnahm, wie unglücklich wir beide waren, fing jetzt auch an zu weinen. »Du solltest besser gehen«, sagte ich. »Das Baby ist schon ganz verstört.«
»Ruby ...«
»Bitte, Paul. Mach es nicht noch schwerer, als es ohnehin schon ist.«
Er ging zur Tür, blieb dort jedoch still stehen und schaute hinaus.
»Den ganzen Tag über«, sagte er liebevoll, »war ich wie jemand, der auf einer Wolke schwebt. Nichts konnte mich unglücklich machen.«
Obwohl mir inzwischen wirklich elend zumute war, gelang es mir doch irgendwie, meine Stimme zu finden. »So wird es dir eines Tages wieder gehen, Paul. Ich bin ganz sicher.«
»Nein, ganz bestimmt nicht«, sagte er und wandte sich wieder zu mir um. In seinen Augen standen Schmerz und Wut. Seine Wangen waren so stark gerötet, daß er wie ein Tourist aus dem Norden aussah, der sich einen Sonnenbrand geholt hat. »Ich schwöre dir, daß ich niemals eine andere Frau ansehen werde. Ich werde niemals eine andere Frau küssen. Ich werde niemals eine andere Frau in den Armen halten.« Er hob die rechte Faust, schaute zur Decke auf und schüttelte die erhobene Faust. »Ich werde dieselben Keuschheitsgelübde ablegen, wie sie unser Geistlicher abgelegt hat, und ich werde dieses prachtvolle Haus in einen Schrein verwandeln. Ich werde bis ans Ende der Zeit alleine dort leben, und ich werde sterben, ohne einen anderen Menschen an meiner Seite zu haben, und mir wird nichts weiter bleiben als die Erinnerung an dich«, fügte er hinzu, und dann stieß er die Tür auf und rannte über die Veranda und die Stufen hinunter.
»Paul!« rief ich ihm nach. Es war mir unerträglich, ihn derart zornig und verletzt zu sehen. Doch er kam nicht zurück. Ich hörte, wie er den Motor seines Wagens anließ und wie die Räder den Kies aufwirbelten, als er davonbrauste, sein Herz in Scherben zerbrochen.
Es schien ganz so, als brächte ich es fertig, jedem weh zu tun, mit dem ich in Berührung kam. War ich dazu geboren worden, denen, die mich liebten, Leid zuzufügen? Ich hielt meine Tränen zurück, damit Pearl nicht noch unruhiger wurde, doch ich fühlte mich wie eine Insel, um die herum das Meer brandet. Jetzt hatte ich wahrhaft niemanden mehr auf Erden.
Als mein Herz aufgehört hatte, wie ein Specht zu klopfen, begann ich, uns etwas zum Abendbrot herzurichten. Mein Baby nahm mein Unglück wahr, obwohl ich mich bemühte, es mit meiner Geschäftigkeit zu überdecken. Wenn ich etwas sagte, hörte Pearl das Unglück aus meiner Stimme heraus, und wenn ich sie anschaute, sah sie die Finsternis in meinen Augen.
Während das Roux köchelte, setzte ich mich mit Pearl auf Grandmère Catherines Schaukelstuhl und starrte das Gemälde an. In beiden Gesichtern drückten sich Traurigkeit und Mitgefühl aus, in Grandmère Catherines und in dem meiner Mutter. Die lebhafte Erinnerung an Pauls niedergeschmettertes Gesicht hing wie ein drohendes Unwetter in der Luft. Jedesmal, wenn ich zur Tür schaute, sah ich ihn dort stehen, wie er sich finster zu mir umdrehte, seine Gelübde ablegte und Drohungen ausstieß. Warum bereitete ich dem einzigen Menschen Schmerzen, der mein Kind und mich lieben und behüten wollte? Wo würde ich eine solche Zuneigung jemals wiederfinden?
»Tue ich das Richtige, Grandmère?« flüsterte ich. Ich hörte nur Schweigen, und dann schmatzte Pearl.
Ich fütterte sie, doch ihr Appetit war so mäßig wie mein eigener. Im Grunde genommen saugte sie kaum an ihrer Flasche, und dabei fielen ihr ständig die Augen zu. Es war, als sei sie emotional ebenso erschöpft wie ich, als würde jedes Gefühl und jede Empfindung durch die unsichtbaren Drähte, die eine Mutter mit ihrem Kind verbinden, auf sie übertragen. Ich beschloß, sie nach oben zu bringen und ins Bett zu legen, und ich war gerade aufgestanden, um das zu tun, als ich hörte, wie sich ein Wagen näherte. Das Licht der Scheinwerfer fiel auf das Haus, der Wagen kam zum Stehen, und ich hörte, wie die Tür geöffnet und zugeschlagen wurde. War Paul mit neuen Argumenten zurückgekommen? Selbst wenn es so war, dachte ich, konnte er meine Entschlossenheit nicht mindern.
Die schweren Schritte, die über die Veranda kamen, sagten mir jedoch, daß es sich um jemand anderen handeln mußte. Ein lautes Klopfen war an der Tür zu vernehmen, und die ganze Hütte wackelte auf ihren Pfählen. Ich verließ zögernd die Küche, und mein Herz begann, fast so laut zu schlagen wie das Pochen an der Tür.
»Wer ist da?« fragte ich. Pearl schaute ebenfalls neugierig auf die Tür. Anstelle einer Antwort riß der Besucher die Tür so heftig auf, daß er sie fast aus den Angeln gehoben hätte. Ich sah, wie ein gewaltiger Brocken von einem Mann eintrat. Das schmutzige, zerzauste braune Haar fiel ihm lang und strähnig bis in den Nacken. Seine Hände waren riesig, die Finger mit Schmutz und Schmiere verkrustet. Als er ins Licht der Butangaslampe trat, schnappte ich nach Luft.
Ich war ihm zwar nur ein einziges Mal persönlich begegnet und hatte ihn vorher nur wenige Male flüchtig gesehen, doch Buster Trahaws Gesicht nahm in meiner Erinnerung einen Platz neben meinen schlimmsten Alpträumen ein. Er war jetzt noch häßlicher als an dem Tag, an dem er mit Grandpère Jack ins Haus gekommen war, um die Abmachung zu besiegeln, daß ich ihn heiraten würde, wenn er Grandpère Jack volle tausend Dollar zahlte. Noch schlimmer war, daß Grandpère vorhatte, ihn vorher mit mir schlafen zu lassen, damit er mich ausprobieren konnte, als sei ich eine Art von Ware.
Ich hatte ihn als großen, kräftigen Mann Mitte Dreißig in Erinnerung, um dessen Bauch sich ein Fettwulst spannte, der sich wie ein Schwimmreifen unter dem Hemd wölbte. Seitdem war sein Schmerbauch noch größer geworden, und seine Gesichtszüge, durch sein enormes Körpergewicht verzerrt, waren jetzt derart aufgeschwemmt, daß er aussah wie eine Kreuzung aus einem Mann und einem Schwein. Zudem hatte er jetzt einen dünnen ausgefransten Bart, der ungepflegt von seinem Kinn hing und in die Haare, die sich in seinem Nacken wellten, überging. Dadurch entstand der Eindruck, als sei auch noch ein Affe mit im Spiel.
Als er lächelte, verschwanden seine dicken Lippen so gut wie ganz unter dem Schnurrbart und den Haaren auf dem Kinn, und es stellte sich heraus, daß er die meisten Vorderzähne verloren hatte. Die wenigen, die ihm noch geblieben waren, wiesen Tabakflecken auf, was seinem Mund Ähnlichkeit mit einem geräumigen verkohlten Ofen verlieh. Dort, wo auf seinen Bakken keine Haare wuchsen, war die Haut schuppig und schälte sich, was mich an eine Schlange erinnerte, die sich häutet. Aus seinen gewaltigen Nasenlöchern wuchsen lange drahtige Haare, und seine Augenbrauen waren zusammengewachsen und bildeten einen dicken dunklen Strich über seinen hervortretenden, stumpfen braunen Augen.
»Es ist also wahr«, sagte er. »Du bist zurückgekommen. Die Slaters haben es mir erzählt, als ich meinen Wagen zur Reparatur hingebracht habe.«
Er beugte sich zurück, öffnete die Tür einen Spaltweit und spuckte einen Klumpen Kautabak aus. Dann fiel sein Blick wieder auf mich, und er grinste über das ganze Gesicht.
»Was wollen Sie hier?« fragte ich. Pearl klammerte sich ängstlich wimmernd eng an mich.
Sein Lächeln verflog schnell wieder. »Was ich hier will? Weißt du etwa nicht, wer ich bin? Ich bin Buster Trahaw, und ich will, was mir zusteht, und nichts anderes«, sagte er und trat vor. Ich wich ebenso viele Schritte zurück. »Ist das da dein kleines Baby? Goldig, die Kleine, das muß ich schon sagen. Du hast wohl Babies ohne mich gemacht, was?« sagte er lachend. »Also, damit ist jetzt Schluß.«
Ich spürte, wie das Blut in meine Füße sank, als seine Absichten deutlich wurden.
»Was reden Sie da? Verschwinden Sie. Ich habe Sie nicht in mein Haus gebeten. Gehen Sie, oder...«
»Aber, aber, hottehü, mein Pferdchen. Du hast wohl ganz vergessen, was mir zusteht?«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
»Ich rede von dem Handel, den ich mit deinem Grandpère Jack geschlossen habe, von dem Geld, das ich ihm in der Nacht gegeben habe, ehe du fortgelaufen bist. Ich habe es ihm gelassen, weil er gesagt hat, daß du wieder zurückkommst. Ich wußte natürlich, daß er ein alter Lügner ist, aber ich habe mir ausgerechnet, daß dieses Geld gut angelegt ist. Ich habe mir gesagt: Buster, deine Chance wird schon noch kommen, und jetzt ist sie da, oder etwa nicht?«
»Nein«, sagte ich. »Ich habe keine Abmachungen mit Ihnen getroffen. Und jetzt verschwinden Sie.«
»Ich gehe nicht, solange ich nicht bekommen habe, was mir zusteht. Was macht das für dich schon für einen Unterschied? Schließlich machst du Babies, ohne einen Ehemann zu haben, oder etwa nicht?« Er sah mich wieder mit diesem zahnlosen Grinsen an.
»Verschwinden Sie!« kreischte ich. Pearl fing an zu weinen. Ich wollte mich abwenden, aber Buster machte einen Satz und umfaßte mein Handgelenk.
»Paß bloß auf, daß du das Baby nicht fallen läßt«, sagte er, und seine Stimme klang bedrohlich. Ich bemühte mich, mein Gesicht von ihm abzuwenden. Sein Atem und der Gestank seiner Kleidung in Verbindung mit seinem Körpergeruch reichten aus, damit sich mir der Magen umdrehte. Er wollte mir Pearl aus den Armen reißen.
»Nein!« schrie ich, aber ich wollte nicht, daß dem Baby etwas zustieß. Die Kleine schrie hysterisch, als er seine großen schmutzigen Hände um ihre Taille legte.
»Laß sie mich einen Moment lang halten, ja? Ich habe selbst Babies. Ich weiß, wie man mit ihnen umgeht.«
Wenn wir nicht Tauziehen spielen wollten, mußte ich sie loslassen.
»Tun Sie ihr nicht weh«, flehte ich ihn an. Sie weinte und streckte mir ihre Ärmchen entgegen.
»Aber, aber, he... ich bin doch dein... Onkel Buster«, sagte er. »Ein hübsches Dingelchen. Ich wette, die wird auch jemandem das Herz brechen.«
»Bitte, geben Sie sie mir wieder«, flehte ich.
»Klar. Buster Trahaw tut keinem Baby weh. Buster Trahaw macht Babies«, sagte er und lachte über seinen eigenen Witz.
Ich nahm ihm Pearl wieder ab und wich einen Schritt zurück.
»Bring sie ins Bett«, ordnete er an. »Wir haben geschäftliche Angelegenheiten miteinander zu erledigen.«
»Bitte, lassen Sie uns in Ruhe... bitte...
»Ich gehe nicht, ehe ich gekriegt habe, was ich haben will«, sagte er. »Also, was ist? Wirst du es mir schwermachen, oder machst du es mir leicht? Ich kann dich auf beide Arten nehmen. Die Sache ist die«, sagte er und lächelte wieder, »daß ich es irgendwie lieber habe, wenn man es mir nicht zu leichtmacht. Das ist, als ließe man sich auf einen Ringkampf mit einem Alligator ein.« Er kam auf mich zu, und ich schnappte nach Luft. »Steck sie ins Bett, wenn du nicht willst, daß sie frühzeitig Anschauungsunterricht bekommt, hast du gehört?«
Ich schluckte schwer. Das Atmen bereitete mir Mühe, wenn ich nicht in dem Strudel versinken und untergehen wollte. Alles geschah viel zu schnell.
»Leg sie auf dieses Sofa dort«, ordnete er an. »Sie wird sich schon von allein in den Schlaf weinen, wie es die meisten Babies tun. Los, mach schon.«
Ich blickte vom Sofa zur Tür, aber trotz seiner Dummheit besaß er genügend Verstand, um meinen nächsten Schritt vorherzuahnen. Er trat zurück, um mir den Fluchtweg abzuschneiden. Widerstrebend brachte ich Pearl zum Sofa und legte sie hin. Sie schrie unaufhörlich weiter.
Buster packte mein Handgelenk und riß mich an sich. Ich versuchte, mich zu widersetzen, doch das war, als wollte man der Flut Einhalt gebieten. Er schlang seine riesigen Arme um mich, preßte mich an seinen Bauch und seine Brust und nahm dann mein Kinn in seine kräftigen Finger. Er zwang mich, zu ihm aufzublicken, damit er diese schwammigen Lippen auf meinen Mund senken konnte. Ich erstickte unter diesem feuchten Druck, hielt den Atem an und tat mein Bestes, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Mir graute davor, daß er mir dann einfach die Kleider vom Leib reißen und sich an mir gütlich tun würde.
Seine rechte Hand glitt über meine Taille hinunter, bis sie auf meinem Hinterteil lag und er mich hochhob und mich auf seiner Hand wippen ließ, als wöge ich kaum mehr als Pearl.
»Also, wirklich, wenn wir es hier nicht mit einem kostbaren Stück zu tun haben. Dein Grandpère Jack hat recht gehabt. Jawohl. «
»Bitte«, flehte ich, »nicht, wenn das Baby dabei ist. Bitte.«
»Klar, Süße. Ich will dich ohnehin in einem richtigen Bett haben. Du gehst mir jetzt nach oben voraus.«
Er drehte mich derb um und versetzte mir einen Stoß in Richtung Küche und Treppe. Ich warf einen Blick zurück auf Pearl. Sie schluchzte heftig, und ihr kleiner Körper bebte von Kopf bis Fuß.
»Geh schon«, befahl mir Buster.
Ich setzte mich in Bewegung und suchte nach Fluchtwegen. Mein Blick fiel auf das Roux, das noch auf dem Ofen köchelte. Es war noch heiß.
»Warten Sie«, sagte ich. »Ich habe Essen auf dem Herd stehen und muß ihn abschalten.«
»Das nenne ich eine brave Cajun-Frau«, sagte Buster. »Denkt immer ans Kochen. Hinterher könnte ich durchaus dein Gumbo kosten wollen. Von der Liebe bekomme ich meistens einen Bärenhunger.«
Er trat hinter mich. Ich wußte, daß ich nur ein paar Sekunden Zeit hatte, und wenn ich nicht das Beste daraus machte, würde ich dazu verdammt sein, diese Treppe hochzusteigen. Wenn wir erst einmal oben angekommen waren, saß ich in der Falle und war ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Selbst dann, wenn ich aus einem Fenster hätte springen können, hätte ich es nicht getan, da das bedeutet hätte, ihn mit Pearl allein zu lassen. Ich schloß die Augen, betete und umschloß den Griff des Topfes fest mit meinen Fingern. Dann wirbelte ich zu ihm herum, so schnell ich konnte, und schleuderte Buster den kochendheißen Inhalt des Topfes ins Gesicht.
Er schrie, und ich duckte mich unter seinem Arm hindurch und sprang aus der Küche. Ich riß Pearl an mich und eilte zur Tür der Hütte hinaus, rannte über die Veranda und die Stufen hinunter. Ich rannte in die Nacht hinaus, ohne mich auch nur noch einmal umzusehen. Ich hörte Busters Schreie und Flüche, und ich hörte auch, wie er sich im Haus wild gebärdete, Stühle umwarf, Geschirr zerbrach und in seiner Wut eine Fensterscheibe einschlug. Doch ich blieb nicht stehen. Ich eilte in die Dunkelheit.
Pearl war derart schockiert über mein Tun, daß sie aufhörte zu weinen. Sie zitterte jedoch vor Furcht, da sie das Beben meines Körpers spürte. Ich hatte Angst, Buster würde uns nachlaufen, doch als er das nicht tat, fürchtete ich, er würde in seinen Wagen springen und die Verfolgung aufnehmen. Daher hielt ich mich geduckt im Straßengraben, jederzeit bereit, in dem Moment, wo ich die Scheinwerfer eines Wagens sah, ins Gebüsch zu springen und mich zu verstecken.
Ich weiß nicht, wie ich es fertigbrachte, nicht zu stolpern und mit Pearl in meinen Armen hinzufallen, aber ich hatte das Glück, daß der Mond zwischendurch immer wieder zwischen den Wolken herauslugte. Sein Schein genügte, um mir den Weg zu weisen. Zum Glück folgte mir sein Wagen nicht. Ich erreichte das Haus von Mrs. Thibodeaux und klopfte an die Tür.
»Ruby!« rief sie aus, als sie Pearl und mich erblickte. »Was ist passiert?«
»O Mrs. Thibodeaux, bitte, helfen Sie uns. Buster Trahaw hat gerade versucht, mich in meinem eigenen Haus zu vergewaltigen«, rief ich aus. Sie öffnete die Tür, scheuchte uns ins Haus und schloß die Tür hinter uns ab.
»Ihr setzt euch jetzt einfach hier ins Wohnzimmer«, sagte sie, und ihr Gesicht war vor Schock weiß geworden. »Ich hole dir ein Glas Wasser, und dann werde ich die Polizei anrufen. Gott sei Dank habe ich mir letztes Jahr eine Telefonleitung legen lassen.«
Sie brachte mir ein Glas Wasser aus der Küche und nahm Pearl in die Arme. Ich schluckte die kühle Flüssigkeit und lehnte mich mit geschlossenen Augen zurück. Mein Herz pochte immer noch gewaltig. Ich glaubte, Mrs. Thibodeaux könnte es daran sehen, wie meine Bluse sich hob und senkte.
»Das arme Baby. Mein armes Kind. Meine Güte, meine Güte... Buster Trahaw, sagst du. Meine Güte...«
Pearl hörte auf zu weinen. Sie wimmerte noch eine Zeitlang, und dann schloß sie die Augen und schlief ein. Ich nahm sie wieder in meine Arme, als Mrs. Thibodeaux noch einmal in die Küche ging, um die Polizei anzurufen. Kurze Zeit später traf ein Streifenwagen ein, und als die beiden Polizisten ins Haus kamen, berichtete ich ihnen, was mir zugestoßen war.
»Mit diesem Tunichtgut hatten wir schon mehr als einmal zu schaffen«, sagte einer der Beamten. »Du bleibst einfach hier, bis wir zurückkommen.«
Ich hatte nicht die Absicht, mich auch nur einen Zentimeter von der Stelle zu rühren. Etwa eine Stunde später kehrten die Polizisten zurück und berichteten, er sei noch in meiner Hütte gewesen, und sie hätten ihn dort gefunden. Er hatte einigen Schaden angerichtet und dann eine Flasche schwarzgebrannten Whiskey aus seinem Wagen geholt, um sich hinzusetzen und meine Rückkehr zu erwarten. Nach dem, was sie berichteten, hatten sie zwei weitere Polizisten hinzurufen müssen, damit sie ihnen halfen, Buster zu bändigen.
»Jetzt sitzt er hinter Gittern, wo er hingehört«, sagte der Polizist zu mir. »Aber du wirst mit uns ins Polizeirevier kommen und Anklage gegen ihn erheben müssen. Das kannst du jetzt tun, aber auch morgen früh, wenn es dir lieber ist.«
»Sie ist erschöpft«, sagte Mrs. Thibodeaux.
»Morgen früh reicht es auch noch«, sagte der Polizist zu uns. »Im Moment wirst du ohnehin nicht nach Hause zurückgehen wollen«, fügte er hinzu und warf einen Blick auf Mrs. Thibodeaux. »Dort steht dir einiges an Arbeit bevor.«
»O Mrs. Thibodeaux«, klagte ich. »Er hat das einzige Zuhause verwüstet, das ich habe.«
»Aber, aber, Kind. Du weißt doch, daß wir alle für dich da sind und dir dabei helfen werden, es wieder herzurichten. Mach dir darüber bloß keine Sorgen. Sieh zu, daß du schlafen kannst, damit Pearl dich morgen früh strahlend und heiter vorfindet.«
Ich nickte. Sie brachte mir eine Decke, und ich schlief mit Pearl in den Armen auf ihrem Sofa. Ich hätte nicht geglaubt, daß ich schlafen könnte, doch in dem Moment, in dem ich die Augen schloß, packte mich die Erschöpfung, und das nächste, was ich wußte, war, daß das Morgenlicht mein Gesicht wärmte. Pearl stöhnte, als ich mich rührte. Ihre kleinen Augenlider schlugen sich flatternd auf, und sie sah mir ins Gesicht. Die Erkenntnis, daß sie geborgen in meinen Armen lag, ließ ein Lächeln auf ihre Lippen treten. Ich gab ihr einen Kuß und dankte Gott dafür, daß wir entkommen waren.
Nachdem Mrs. Thibodeaux uns etwas zum Frühstück gemacht hatte, ließ ich Pearl bei ihr und lief zu Fuß in die Stadt, um ins Polizeirevier zu gehen. Netter hätte man mich dort gar nicht behandeln können. Man besorgte mir augenblicklich einen Stuhl und sorgte dafür, daß ich es bequem hatte. Eine Sekretärin brachte mir Kaffee.
»Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen, daß du einen Beweis erbringen mußt«, sagte der Polizist, der hinter seinem Schreibtisch saß, zu mir. »Buster streitet nichts ab. Er klagt nur immer noch darüber, daß er nicht bekommen hat, was ihm für sein Geld zusteht. Was hat das alles zu bedeuten?«
Ich mußte ihm erzählen, was Grandpère Jack damals ausgeheckt hatte. Ich schämte mich seiner, aber es blieb mir gar nichts anderes übrig. Sämtliche Polizisten, die die Geschichte hörten, nickten mitfühlend und angewidert. Leider war Grandpère Jack einigen von ihnen noch lebhaft in Erinnerung.
»Er und Buster sind aus demselben Holz geschnitzt«, sagte der diensttuende Polizist zu mir. Dann nahm er meine Aussage schriftlich auf und sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Buster Trahaw würde mich nicht noch einmal belästigen. Sie würden dafür sorgen, daß er hinter Gitter käme und der Schlüssel verlorenginge. Ich bedankte mich bei ihnen und machte mich auf den Rückweg zu Mrs. Thibodeaux.
Ich glaube, der Grund, warum manche Leute im Bayou immer noch kein Telefon und keine Fernsehgeräte in ihren Hütten hatten, war der, daß sich Neuigkeiten hier ohne diese Mittel fast genauso schnell ausbreiteten. Als ich Pearl abholte und mich mit ihr auf den Heimweg machte, arbeitete bereits etwa ein Dutzend unserer Nachbarn an meinem Haus. In seiner Wut hatte Buster die Haustür aus den Angeln gerissen und fast alle Fensterscheiben eingeschlagen.
Wie durch ein Wunder hatte Grandmère Catherines alter Schaukelstuhl die Attacke überlebt, obwohl er den Anschein erweckte, als hätte Buster ihn mehrfach quer durch die ganze Hütte getreten. Um zwei der Küchenstühle stand es schlechter. Beide hatten Beinbrüche erlitten. Zum Glück hatte er begonnen zu trinken, ehe er sich entschloß, nach oben zu gehen, und daher war dort alles unberührt. Einen großen Teil meiner Küche hatte er jedoch zertrümmert. Sowie sich herausgestellt hatte, woran es mir jetzt fehlte, stellten mir meine Nachbarn Ersatz zur Verfügung.
Als ich auf das Haus zukam, sah ich, wie Mr. Rodriguez die Haustür reparierte. Ich erinnerte mich noch daran, wie Grandmère Catherine eines Nachts in sein Haus gerufen worden war, um einen Couchemal zu vertreiben, einen bösen Geist, der auf der Lauer liegt, wenn ein ungetauftes Baby stirbt. Er war ihr sehr dankbar und konnte von jener Nacht an gar nicht genug für uns tun.
Im Innern des Hauses räumten Mrs. Rodriguez und die anderen Frauen auf und putzten. Sie hatten bereits Spenden gesammelt, um das zerbrochene Geschirr und die Gläser zu ersetzen. Schon am frühen Nachmittag entstand der Eindruck, hier würde die Fertigstellung eines Rohbaus gefeiert, eine Versammlung von Nachbarn, die gekommen waren, um das Dach zu decken, und anschließend würde man ein großes Fest feiern, zu dem jeder Essen und Getränke beisteuerte. Die Güte meiner Nachbarn ließ Tränen in meine Augen treten.
»Fang uns jetzt bloß nicht an zu weinen, Ruby«, sagte Mrs. Livaudis. »Die Leute hier erinnern sich noch an die guten Taten deiner Grandmère Catherine, die ihnen so oft geholfen hat, und sie sind froh darüber, jetzt etwas für dich tun zu können.«
»Ich danke Ihnen, Mrs. Livaudis.«, sagte ich. Sie umarmte mich, wie alle anderen Frauen auch, ehe sie gingen.
»Ich lasse euch gar nicht gern allein hier zurück«, sagte Mrs. Thibodeaux. »Ihr könnt gern mit mir kommen und bei mir bleiben.«
»Nein, wir werden jetzt schon zurechtkommen, Mrs. Thibodeaux. Noch einmal vielen Dank für Ihre Hilfe«, sagte ich.
»Die Cajuns tun einander nichts«, betonte Mrs. Thibodeaux. »Dieser Buster, der war schon vom Tage seiner Empfängnis an ein faules Ei.«
»Das weiß ich, Mrs. Thibodeaux.«
»Trotzdem, meine Liebe, ist es nicht richtig, daß eine junge Frau wie du allein hier draußen im Sumpf einen Säugling großzieht.« Sie schüttelte den Kopf und schürzte die Lippen. »Derjenige, der das Vergnügen hatte, das Kind mit dir zu machen, sollte jetzt auch die Verantwortung mit dir teilen«, fügte sie hinzu.
»Ich komme gut allein zurecht, Mrs. Thibodeaux. Wirklich.«
»Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich sage, was ich denke, Ruby, aber ich weiß, daß deine Grandmère sich wünschen würde, daß ich mir Sorgen um dich mache. Und ich bin besorgt um dich.«
Ich nickte.
»Nun, das ist alles. Ich habe mein Sprüchlein aufgesagt. Jetzt liegt alles Weitere bei euch jungen Leuten. Die Zeiten haben sich geändert«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Die Zeiten und die Menschen. Gute Nacht, meine Liebe.« Wir umarmten einander, und sie ging.
Am frühen Abend waren alle gegangen, und die Lage hatte sich wieder beruhigt. Ich legte Pearl schlafen, summte ihr noch eine Zeitlang etwas vor und ging dann nach unten, um Kaffee zu trinken und auf meiner Veranda zu sitzen. Mrs. Thibodeaux’ Worte gingen mir noch einmal durch den Kopf. Ich wußte, daß sie nicht nur das ausgedrückt hatte, was die anderen Nachbarn dachten, sondern auch das, was hinter meinem Rücken geredet wurde. Der Zwischenfall mit Buster Trahaw würde nur dazu führen, daß dieses Thema offener besprochen wurde.
Als ich mich umgezogen hatte, fand ich den Brief, den ich an Daphne geschrieben hatte, in meiner Tasche. Jetzt hatte ich mehr denn je das Gefühl, ich sollte ihn abschicken. Ich ging ins Haus zurück, schrieb die Adresse darauf und steckte den Brief dann in den Briefkasten, damit der Briefträger ihn am nächsten Morgen mitnahm. Dann setzte ich mich wieder auf die Veranda und spürte, daß ich mich endlich entspannte.
Doch schon im nächsten Moment stellten sich meine Nackenhaare prickelnd auf, und ich wußte, daß jemand in der Nähe war und mich beobachtete. Mein Herz schnürte sich zusammen. Ich hielt den Atem an, und als ich mich umdrehte, sah ich eine Silhouette im Dunkeln. Ich schnappte nach Luft, doch die Person trat schnell vor. Es war Paul. Er war mit dem Boot gekommen und kam jetzt vom Anlegesteg herauf.
»Ich wollte dich nicht .erschrecken«, sagte er. »Ich wollte warten, bis alle anderen fort sind. Bist du in Ordnung?«
»Ja. Jetzt wieder.«
»Nachdem ich gestern abend gegangen bin«, sagte er und kam näher, bis er im Schein der Lampe auf der Veranda stand, »wieviel später ist Buster gekommen und über dich hergefallen?«
»Oh, es war eine ganze Weile später«, sagte ich zu ihm. »Schon kurz vor der Abendessenszeit.«
»Wenn ich dagewesen wäre...«
»Er hätte dich verletzen können, Paul. Es war reines Glück, daß ich entkommen konnte.«
»Vielleicht hätte nicht er mich zusammengeschlagen, sondern ich ihn«, sagte Paul stolz. »Oder... er wäre vielleicht gar nicht erst ins Haus gekommen.« Er setzte sich auf die Verandatreppe und lehnte sich an den Pfosten. Nach einem Moment sagte er: »Eine junge Frau und ein Baby sollte man nicht allein lassen.« Es war, als hätte er Mrs. Thibodeaux’ Worte gehört.
»Paul...«
»Nein, Ruby«, sagte er und drehte sich zu mir um. Selbst in dem schwachen Licht konnte ich glühende Entschlossenheit in seinen Augen lodern sehen. »Ich möchte dich und Pearl beschützen. In dieser Welt, die du für eine reine Scheinwelt hältst, bräuchtest du dich nicht mit einem Buster Trahaw auseinanderzusetzen. Das kann ich dir versprechen. Und auch Pearl könnte nichts passieren«, hob er hervor.
»Aber, Paul, das ist nicht fair dir gegenüber«, sagte ich mit einer matten, verzagten Stimme. Sämtlicher Widerstand wich aus mir.
Er richtete einen Moment lang den Blick auf mich und nickte dann bedächtig. »Mein Vater hat dir einen Besuch abgestattet, stimmt’s? Du brauchst mir keine Antwort zu geben. Ich weiß, daß er hier war. Ich habe es ihm gestern abend beim Essen an den Augen angesehen. Er macht sich nur Sorgen um die Last, die auf sein eigenes Gewissen drückt. Weshalb sollte ich für seine Sünden büßen müssen?« rief er aus und erwartete eine Antwort von mir.
»Aber genau das will er dir ersparen, Paul. Wenn du mich heiratest...«
»Dann werde ich mit dir glücklich werden. Habe ich denn kein Wort mitzureden, wenn es um meine eigene Zukunft geht?« fragte er schroff. »Und erzähl mir bloß nicht, es sei unser Los oder das Schicksal hätte es uns so vorbestimmt, Ruby. Man gelangt zu einer Weggabelung und entscheidet sich für die eine oder die andere Abzweigung. Erst nachdem man diese Wahl getroffen hat, nimmt das Schicksal alles Weitere in die Hand, und vielleicht selbst dann nicht. Ich möchte diese erste Entscheidung treffen, und ich fürchte den Wasserlauf nicht, durch den ich unsere Piragua staken werde, solange ihr an meiner Seite seid, du und Pearl.«
Ich seufzte und lehnte den Kopf auf die Stuhllehne zurück.
»Kannst du denn nicht glücklich mit mir werden, Ruby? Selbst unter den Bedingungen, die wir besprochen haben? Kannst du es nicht? Ich habe geglaubt, du könntest es. Ich weiß, daß du es einmal konntest. Warum läßt du es mich nicht versuchen? Vergiß dich, vergiß mich. Laß es uns einfach nur für Pearl tun«, sagte er.
Ich lächelte ihn an und schüttelte den Kopf. »Du bist ein hinterhältiger Kerl, Paul Marcus Tate.«
»In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt«, sagte er und lächelte mich ebenfalls an.
Ich holte tief Atem. Aus der Dunkelheit konnten sämtliche Dämonen unserer kindlichen Ängste hervorkommen. Jeden Abend, wenn wir den Kopf auf das Kissen legten, fragten wir uns, was in den Schatten um unsere Hütten herum wohl lauern mochte. Diese Befürchtungen ließen uns stärker werden, aber sie verfolgten uns dennoch weiterhin wie ein Spuk. Ich war nicht so naiv zu glauben, es würde keinen zweiten Buster Trahaw geben, der mir in zukünftigen Tagen auflauerte und mich erwartete, und das war der Grund, aus dem ich den Brief an Daphne in meinen Briefkasten gesteckt hatte.
Aber wie sah die Welt aus, in der ich Pearl aufwachsen lassen wollte – war es die Welt der reichen Kreolen oder die Sumpfwelt der Cajuns... oder war es die verzauberte Welt, die Paul für uns gestaltete? Die Vorstellung, in diesem Schloß von einem Haus zu leben, in dem ich meine Zeit damit zubringen konnte, in dem riesigen Dachbodenatelier zu malen, während ich das Gefühl hatte, über alles erhaben zu sein, was sich hart, schmutzig und kompliziert unter mir erstreckte, ja, tatsächlich darüber erhaben zu sein, erschien mir wie eine uralte segenbringende Verheißung, die endlich wahr wurde. Sollte ich in mein persönliches Wunderland entkommen? Vielleicht hatte Paul recht. Vielleicht bereitete seinem Vater wirklich nur die Last seines eigenen Gewissens Sorgen. Vielleicht war es an der Zeit, endlich einmal an uns selbst und an Pearl zu denken.
»Einverstanden«, sagte ich leise.
»Was? Was hast du gerade gesagt?«
»Ich habe gesagt, ich bin einverstanden. Ich werde dich heiraten, und wir werden in unserem eigenen privaten Paradies leben, jenseits des Morastes aus Sorgen und innerem Aufruhr, den wir in der Vergangenheit durchschritten haben. Wir werden uns an unser eigenes Abkommen halten und unsere eigenen Gelübde ablegen. Wir werden gemeinsam durch den Fluß rudern.«
»O Ruby, ich bin ja so glücklich«, sagte er. Er stand auf, kam auf mich zu und nahm meine Hände in seine. »Du hast recht«, sagte er plötzlich, und seine Augen funkelten vor Aufregung. »Wir müssen vor allem anderen unser eigenes privates Zeremoniell vollziehen. Steh auf«, sagte er.
»Was?«
»Komm schon. Es gibt keine bessere Kirche als die Veranda vor Catherine Landrys Haus«, verkündete er.
»Und was sollen wir jetzt tun?« fragte ich lachend.
»Nimm meine Hand.« Er packte meine Hand und zog mich auf die Füße. »Ja, so ist es richtig. Und jetzt sieh... diese Mondsichel dort oben an. Mach schon. Bist du soweit? Wiederhole meine Worte. Ich, Ruby Dumas. Mach schon, tu es«, sagte er.
»Ich, Ruby Dumas ...«
»Gelobe hiermit, Paul Marcus Tate der beste Freund und Gefährte zu sein, den er sich jemals wünschen könnte.«
Ich wiederholte seine Worte und schüttelte den Kopf. »Und ich verspreche, mich meiner Kunst zu verschreiben und soviel Ruhm wie möglich zu erlangen.«
Das ging mir leicht über die Lippen.
»Das ist alles, was ich von dir verlange, Ruby«, flüsterte er. »Aber von mir selbst muß ich mehr verlangen«, fügte er hinzu, und dann schaute er zu der Mondsichel auf. »Ich, Paul Marcus Tate, gelobe hiermit, Ruby und Pearl Dumas zu lieben und zu beschützen, sie in meine selbsterschaffene Welt zu holen und sie so glücklich zu machen, wie es auf diesem Planeten nur irgend möglich ist. Ich gelobe, härter zu arbeiten und alles, was häßlich und unerfreulich ist, von unserer Schwelle fernzuhalten, und ich gelobe, ehrlich und aufrecht zu sein und für alle Bedürfnisse Rubys Verständnis aufzubringen, ganz gleich, was ich auch empfinden mag.«
Er drückte mir einen schnellen Kuß auf die Wange.
»Willkommen im Land der Magie«, sagte er. Wir lachten beide, doch mein Herz pochte heftig, als hätte ich tatsächlich an einem geweihten und bedeutungsschwangeren Zeremoniell teilgehabt. »Wir sollten jetzt auf unser Glück anstoßen.«
»Ich habe in einem Krug ganz unten in einem Schrank ein wenig von Grandmère Catherines Brombeerschnaps gefunden«, sagte ich. Wir gingen ins Haus, und ich goß die wenigen kostbaren Tropfen in zwei Gläser. Lachend stießen wir miteinander an und tranken den Schnaps in einem Zug. Es schien angemessen zu sein, daß wir unser Gelübde mit etwas krönten, was meine Grandmère hergestellt hatte.
»Kein Zeremoniell und nichts, was irgendein Geistlicher oder ein Friedensrichter sagen könnte, wird dieses Ritual übertreffen«, verkündete Paul, »denn was wir hier tun, das kommt aus der Tiefe unserer Herzen.«
Ich lächelte. Ich hätte nicht geglaubt, daß ich mich schon so bald nach meinem abscheulichen Erlebnis mit Buster Trahaw so wohl fühlen könnte.
»Wie sollte unsere Hochzeit vonstatten gehen?« fragte ich mich laut und dachte dabei wieder an seine Eltern.
»Ein schlichtes Zeremoniell«, laß uns einfach ausreißen«, entschied er. »Ich komme morgen vorbei, und wir fahren rauf nach Breaux Bridge. Dort gibt es einen Geistlichen, der sich zur Ruhe gesetzt hat und uns trauen wird, rechtskräftig und mit allem, was dazu gehört. Er ist ein alter Freund der Familie.«
»Aber er wird wissen wollen, warum deine Eltern nicht mitgekommen sind, Paul, oder nicht?«
»Überlaß das nur mir«, sagte er. »Ich werde von dem Moment an anfangen, für euch zu sorgen, in dem ihr morgen früh aufwacht, und bis zum Tage meines Todes werde ich für euch dasein«, sagte er. »Oder andernfalls so lange, wie ihr es mir erlaubt«, räumte er ein. »Sei um sieben bereit. Überleg dir das nur einmal«, sagte er, »daß all die alten Klatschweiber, die über uns getuschelt haben, endlich den Mund halten werden.«
Paul blieb bei mir, und wir redeten über das Haus und all die Dinge, die wir nach unserem Einzug noch erledigen und besorgen mußten. Er war so aufgeregt, daß ich kaum auch nur ein Wort einwerfen konnte. Er redete, bis ich so müde war, daß meine Augen gegen meinen Willen zufielen.
»Ich sollte jetzt besser gehen und dich schlafen lassen. Morgen steht uns ein großer Tag bevor.« Er küßte mich auf die Wange, und dann sah ich ihm nach, als er zum Wasser ging, um mit seinem Boot heimzufahren.
Ehe ich wieder ins Haus zurückging, lief ich zum Briefkasten und holte den Brief an Daphne heraus. Ich würde ihn nicht abschicken, doch ich konnte mich auch nicht dazu durchringen, ihn zu zerreißen. Wenn ich in meinem kurzen Leben irgend etwas gelernt hatte, dann war es, daß nichts ewig währte und daß auf nichts Verlaß war. Ich konnte nicht sämtliche Türen hinter mir zufallen lassen. Noch nicht.
Aber wenigstens, dachte ich mir, würde ich heute abend unbeschwert einschlafen und von dem großen Dachboden und meinem wunderbaren Atelier träumen, von all den aufregenden Gemälden, die ich in künftigen Zeiten dort malen würde. Was für ein wunderbarer Ort für Pearl, um dort aufzuwachsen, dachte ich, als ich noch einmal nach ihr sah. Ich rückte ihre Decke zurecht, küßte sie auf die Wange und freute mich schon auf meine Träume, als ich mich schlafen legte.