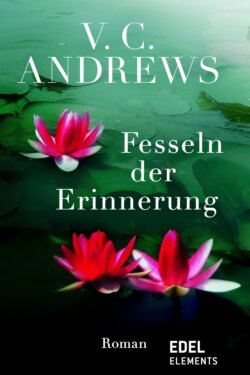Читать книгу Fesseln der Erinnerung - V.C. Andrews - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
Mein wahres Wunderland
ОглавлениеPearls Babygeplapper weckte mich. Es war ein stark bewölkter Tag, und daher fiel kein warmer Sonnenschein durch die Gardinen und streichelte meine geschlossenen Lider, bis sie sich flatternd öffneten. Sobald ich wach war, holte mich die Bedeutsamkeit dessen wieder ein, was ich vorhatte. Ich werde ausreißen, um heimlich zu heiraten, dachte ich. Fragen regneten aus allen Richtungen auf mich herab. Wann würden Pearl und ich tatsächlich in Cypress Woods einziehen? Wie würden wir unsere Heirat der Gemeinde bekanntgeben? Hatte Paul seine Familie inzwischen davon in Kenntnis gesetzt? Was, falls überhaupt etwas, wollte ich aus der Hütte mitnehmen? Wie würde diese Hochzeit aussehen, die uns bevorstand?
Ich stand auf, doch ich hatte das seltsame Gefühl, in einem Traum gefangen zu sein. Sogar in Pearls Augen stand ein still verträumter Blick, und sie war geduldiger als sonst, schrie nicht nach ihrem Frühstück und verlangte nicht lautstark, aus ihrem Kinderbettchen gehoben und in meine Arme genommen zu werden.
»Heute ist ein großer Tag für dich, mein süßer Liebling«, sagte ich zu ihr. »Heute schenke ich dir ein neues Leben, einen neuen Namen und eine vollkommen andere Zukunft, eine, von der ich mir erhoffe, daß sie voll von Verheißungen und Glück für dich sein wird. Wir müssen ein hübsches Kleidchen für dich aussuchen, das du heute tragen kannst. Laß dich zuerst einmal von mir füttern, und dann wirst du Mommy dabei helfen, ihr eigenes Brautkleid auszuwählen.
Mein Brautkleid«, murmelte ich, und plötzlich traten Tränen in meine Augen. In dieser Hütte, in ebendiesem Zimmer, hatten Grandmère Catherine und ich über meine zukünftige Hochzeit geredet.
»Ich habe mir immer erträumt«, hatte sie gesagt und war zu mir gekommen, um sich neben mich zu setzen und mir über das Haar zu streichen, »daß du die verzauberte Hochzeit erleben wirst, von der die Cajuns in der Spinnenlegende berichten. Erinnerst du dich noch? Der reiche Franzose hat diese Spinnen für die Hochzeit seiner Tochter aus Frankreich importiert und sie in den Eichen und den Kiefern ausgesetzt, wo sie ihren Baldachin aus Netzen gesponnen haben. Darüber hat er Gold- und Silberstaub gesprenkelt, und dann ist die Hochzeitsgesellschaft im Kerzenschein wie eine Prozession aufgezogen. Die Nacht um sie herum hat gefunkelt und ihnen ein Leben voller Liebe und Hoffnung versprochen.
Eines Tages wirst du einen gutaussehenden Mann heiraten, der ein Prinz sein könnte, und auch du wirst eine Hochzeit in den Sternen haben«, hatte mir Grandmère versichert.
Wie traurig sie jetzt doch für mich gewesen wäre. Und wie sehr ich mir selbst leid tat. Am Morgen ihres Hochzeitstages sollte das Herz einer jungen Frau mit soviel Aufregung erfüllt sein, daß sie fürchtet, sie könne schlichtweg bersten, sagte ich mir. Jede Farbe müsse ihr leuchtender erscheinen, jeder süße Klang noch süßer. Es muß aussehen, als ob sich jedes einzelne Geschöpf in ihrer Umgebung für sie freut. Um sie herum ertönen fröhliche und unglaublich aufgeregte Stimmen, und überall fällt ihr Blick auf Vorbereitungen, auf Tätigkeiten, die sich ausschließlich auf das wunderbare Zeremoniell beziehen, das sie mit dem Mann, den sie liebt, vollziehen wird.
Und Liebe... die Liebe wäre aufgekeimt und hätte sie überwältigt. Sie hätte einen Moment lang innegehalten und sich gefragt, ob sie jemals wieder so glücklich und zufrieden sein könnte wie jetzt, in diesem Augenblick. Konnte irgend etwas ihr jemals wieder so viel Freude bereiten? Dutzende von Freundinnen hätten sie umgeben, von denen jede einzelne gebannt und mit atemloser Faszination das Ereignis verfolgt hätte, und die ganze Horde hätte geschnattert. Keine von ihnen hätte jemand Bestimmtem zugehört, sondern alle hätten auf alle gelauscht; eine Kakophonie von Gelächter, schrillen Schreien und lautem Rufen.
Aus der Küche wären die Geräusche von klappernden Töpfen gekommen, verursacht von nervösen Köchinnen; aber auch die Gerüche von köstlichen Fisch- und Geflügelgerichten, von Kuchen und Torten. Anweisungen wären quer durch Räume gehallt; Wagen wären eingetroffen und los gefahren, deren Fahrern man die verschiedensten Erledigungen aufgetragen hätte. Ein Teil der prickelnden Spannung hätte sich auf die kleinen Kinder übertragen, die Unfug angestellt hätten und von einer Ecke in die andere gescheucht worden wären. Die älteren Frauen hätten so getan, als seien sie verärgert und besorgt, doch bisweilen hätten sie innegehalten, um sich an diesen ganz besonderen Tag in ihrem eigenen Leben zu erinnern, an ihre eigene Aufregung, und es hätte sie mit der allergrößten Freude erfüllt, diese Aufregung mit der jungen Braut noch einmal erleben zu dürfen. Sie hätten sich daran gelabt wie eine Biene, die Pollen aus einer Blüte saugt, und diese Aufregung hätten sie in honigsüße Erinnerungen und Augenblicke aus ihrer eigenen Vergangenheit umgewandelt. Wenn sie dann endlich in ihrem Hochzeitskleid herausgetreten wäre, hätte sie jeder einzelnen der Frauen diese Aufregung im Gesicht ansehen können.
Ich malte mir weiterhin meine Traumhochzeit aus. Die Limousine würde draußen warten, und ihr Motor würde sich gebärden wie ein Pferd, das es kaum erwarten konnte, im Galopp loszulaufen. Die Tür würde aufgerissen werden. Alle würden jubeln und in die Hände klatschen, während ich die Verandatreppe hinunterschritt und in den Wagen stieg. Und dann würde die gesamte Schar von Freunden und Verwandten uns folgen, wenn ich die Stufen zur Kirche hinaufgeführt würde, in deren Innerem mein wunderbarer, liebender zukünftiger Ehemann nervös von einem Fuß auf den anderen trat und seine eigenen Eltern und Verwandten mit einem strahlenden Lächeln bedachte, in Wirklichkeit aber die Tür nicht aus den Augen ließe und auf Anzeichen meines Eintreffens wartete.
Und dann würde die Musik ertönen, und alle würden feierlich dasitzen und doch gespannte Blicke auf mich werfen, wenn ich durch den Gang zum Altar liefe, wo mich das heilige Sakrament erwartete. Meine Füße würden den Boden nicht berühren. Ich würde auf Luft laufen und langsam den Gelübden entgegenschweben.
Als ich die Augen schloß und an all das dachte, standen die Bilder so lebhaft vor meinen Augen wie meine Gemälde, aber ich versetzte mich selbst in Erstaunen, als ich mich in dieser Hochzeitsszene sah, die ich selbst heraufbeschworen hatte, denn als ich den Blick hob, sah ich nicht etwa Paul dastehen, der auf mich wartete, sondern Beau... meine große Liebe... Beau, endlich.
Ich seufzte tief. Es war nicht Beau, der mich demnächst abholen würde, rief ich mir ins Gedächtnis zurück. Ein weiterer schauerlicher Gedanke zuckte mir durch den Kopf: Wahrscheinlich dachte er heute noch nicht einmal an mich, an diesem Tag, an dem ich die Gelübde ablegen würde, die mich ihm für immer entreißen würden. Pearls Wimmern ließ mich jedoch wieder daran denken, daß ich es nicht für mich tat. Ich tat es für sie und für die vielversprechende Zukunft und die Geborgenheit, die dieser Schritt für sie mit sich bringen würde.
Ich entschied mich für ein schlichtes zartrosafarbenes Baumwollkleid mit einem quadratischen Kragen und einem Rock, der mir fast bis auf die Knöchel reichte. Ich trug immer noch das Medaillon, das Beau mir vor mehr als einem Jahr geschenkt hatte, direkt vor meinem Aufbruch in die Greenwood-Schule in Baton Rouge, doch es gehörte sich nicht, es jetzt zu tragen. Ich nahm es ab und begrub es tief unter meinen anderen Kostbarkeiten in Grandmère Catherines alter Eichentruhe.
Pearl kleidete ich in leuchtendes Rosa, ein Kleidchen mit einer weißen Schleife auf dem Kragen. Nachdem ich sie gefüttert und angezogen hatte, legte ich sie in die Wiege, kleidete mich selbst an und setzte mich hin, um mir das Haar zu bürsten. Ich beschloß, es einfach nur mit einer Schleife zusammenzubinden und es so weich wie möglich über meine Schultern und meinen Rücken fallen zu lassen. Ich hatte es wachsen lassen, und wenn ich es ausbürstete, reichte es bis auf meine Schulterblätter. Ich trug eine Spur Lippenstift auf und fand einen Hut, der früher einmal Grandmère Catherine gehört hatte. Das gab mir das Gefühl, sie bei mir zu haben, als ich mit Pearl auf die Veranda hinaustrat, um dort auf Paul zu warten.
Ich hörte ihn hupen, ehe er vor dem Haus vorfuhr. Sein Wagen war frisch gewaschen und glänzte, und er trug einen neuen blauen Anzug und hatte sich die Krawatte lose um den Kragen gebunden. Sein braunes Haar mit den blonden Strähnen schimmerte, als er aus dem Wagen stieg. Es war frisch gebürstet und noch feucht.
»Guten Morgen«, sagte er. Wir waren beide so nervös, als wäre es unser erstes Rendezvous. »Laß uns losfahren. Vater Antoine in Breaux Bridge erwartet uns schon.« Er hielt uns die Wagentür auf. »Du siehst sehr hübsch aus.«
»Danke, aber ich fühle mich nicht hübsch. Ich bin ganz... aufgeregt.«
»So sollte es auch sein«, sagte er. Er holte tief Atem, ließ den Motor an und fuhr los.
Ein leichter Nieselregen setzte ein, und die Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe, die sich von einer Seite auf die andere bewegten, ähnelten zwei langen Zeigefingern, die Warnungen von sich gaben und Schande vorhersagten. Ich konnte hören, wie sie es rhythmisch wiederholten... Schande, Schande, Schande.
»Also, das Haus steht für unseren Einzug bereit. Natürlich habe ich bisher nur die nötigsten Einrichtungsgegenstände. Ich dachte mir, in ein oder zwei Tagen würden wir beide einen Ausflug nach New Orleans unternehmen.«
»Nach New Orleans? Warum?«
»Damit du in den besten Geschäften einkaufen kannst und eine größere Auswahl hast. Ich will auch nicht, daß du dich wegen der Unkosten sorgst. Deine Aufgabe besteht darin, aus Cypress Woods etwas ganz Besonderes zu machen, ein Haus und ein Grundstück, um das uns selbst die reichsten Kreolen in New Orleans beneiden werden.
Du solltest dir dein Studio so bald wie möglich einrichten«, fuhr er mit einem Lächeln fort. »Sowie wir aus New Orleans zurückkommen, werden wir Einstellungsgespräche mit Kindermädchen führen, die dich mit Pearl entlasten, damit du die Zeit hast, die du für deine Arbeit brauchst.«
»Ein Kindermädchen? Ich glaube nicht, daß ich ein Kindermädchen brauche, Paul.«
»Natürlich brauchst du das. Die Herrin von Cypress Woods wird alle erdenklichen Hausangestellten haben. Unseren Butler habe ich bereits engagiert. Er ist ein Terzeron und heißt James Humble. Er ist etwa fünfzig Jahre alt und hat in den feinsten Häusern gearbeitet.«
»Ein Butler?« Es schien mir nicht so lange her, daß er und ich in seiner Piragua durch den Sumpf gestakt waren und uns in unserer Phantasie genau die Dinge ausgemalt hatten, die wir jetzt tun würden.
»Und unser Hausmädchen. Sie heißt Holly Mixon. Sie ist zur Hälfte Haitianerin, zur anderen Hälfte Choctaw-Indianerin und etwa Mitte Zwanzig. Ich habe sie ebenfalls von einer Agentur vermittelt bekommen. Ich weiß, daß du dich ganz besonders über unsere Köchin freuen wirst«, sagte er, und seine schelmischen Augen funkelten.
»Und weshalb das?«
»Sie heißt Letitia Brown, aber sie möchte gern Letty genannt werden. Sie wird dich an deine Nina Jackson erinnern. Sie will ihr genaues Alter nicht nennen, aber ich glaube, daß sie um die Sechzig ist. Sie praktiziert Voodoo«, sagte er und senkte dabei die Stimme, damit es unheimlich klang.
»All das hast du bereits getan?« fragte ich erstaunt. Er errötete, als hätte ich ihn nackt ertappt.
»Von dem Moment an, in dem du ins Bayou zurückgekehrt bist, habe ich diesen Tag geplant, Ruby. Ich wußte einfach, daß es dazu kommen würde.«
»Was ist mit deiner Familie, Paul? Hast du es deinen Eltern heute morgen gesagt?« fragte ich.
Er schwieg einen Moment lang. »Nein, noch nicht«, sagte er. »Ich habe es für das Beste gehalten, es ihnen hinterher zu sagen. Wenn es erst einmal eine unumstößliche Tatsache ist, dann werden sie es schneller akzeptieren. Es wird alles in Ordnung gehen. Alles wird gutgehen«, versicherte er mir, doch das konnte mein pochendes Herz nicht beruhigen.
Der Regen hatte sich zwar gänzlich gelegt, als wir in Breaux Bridge eintrafen, doch der Himmel blieb dunkel und unheilverkündend. Vater Antoine wohnte mit Miss Mulrooney, seiner Haushälterin, in dem Pfarrhaus neben der Kirche. Er war ein Mann von etwa fünfundsechzig Jahren mit dünnem grauem Haar, das so kurz geschnitten war, daß es an den Seiten wie Pinsel von seinem Kopf abstand, doch er hatte sanfte blaue Augen und die Art von liebevollem Lächeln, die bewirkte, daß man sich in seiner Gegenwart entspannte und wohl fühlte. Miss Mulrooney, eine große dünne Frau mit dunkelgrauem Haar, wirkte finster und mißbilligend. Ich wußte, warum.
Paul hatte Vater Antoine gesagt, Pearl sei sein Kind und er wolle mich heiraten, wie es sich gehöre, doch er wolle eine stille Hochzeit haben, abgeschieden von den mißbilligenden Blicken seiner Nachbarn und der Freunde seiner Familie. Vater Antoine war verständnisvoll und froh darüber, daß Paul sich entschlossen hatte, den Bund der Ehe einzugehen und seine moralische Verantwortung zu tragen.
Unser Trauungszeremoniell war so kurz, wie eine kirchliche Hochzeit es nur irgend sein kann. Als es soweit war, daß ich meine Gelübde ablegen mußte, tat ich etwas, was vielleicht sündig war: Ich beschwor Beau vor meinen Augen herauf und redete mir ein, daß er es war, dem ich mein Herz und meine Seele anvertraute.
Die Trauung verlief viel einfacher und ging viel schneller vorüber, als ich es mir ausgemalt hatte. Ich fühlte mich anschließend vollkommen unverändert, aber das strahlende Lächeln, das jedesmal auf Pauls Gesicht stand, wenn er mich ansah, sagte mir, daß sich alles verändert hatte. Ob es nun zum Besseren oder zum Schlechteren war – wir hatten den Schritt unternommen, uns aneinander gebunden und unser Los miteinander verknüpft.
»Das hätten wir geschafft«, sagte er. »Wie fühlst du dich, Mrs. Tate?«
»Mir graut«, sagte ich, und er lachte.
»Es gibt jetzt keinen Grund mehr, aus dem dir vor irgend etwas grauen sollte. Nicht, solange ich in deiner Nähe bin«, gelobte er. »Was also möchtest du aus der Hütte holen, falls du überhaupt etwas mitnehmen willst?«
»Ich habe Pearls und meine Kleider dort, das Gemälde von Grandmère Catherine und ihren Schaukelstuhl«, sagte ich. »Vielleicht auch noch ihre alte Truhe und den Schrank, den ihr Vater für sie hat anfertigen lassen. Sie war so stolz auf ihn.«
»Gut. Ich werde heute nachmittag ein paar von meinen Männern mit einem Lastwagen rüberschicken und die Möbelstücke holen lassen. Es sieht ganz so aus, als hätte es für eine Weile aufgehört zu regnen. Du kannst in deinem eigenen Wagen hinterherfahren«, fügte er beiläufig hinzu.
»In meinem Wagen? Was für einem Wagen?«
»Ach, habe ich dir das etwa noch nicht erzählt? Ich habe eine kleine Cabriolimousine für dich gekauft, damit du dich freier bewegen kannst... um Besorgungen zu erledigen und dergleichen«, fügte er hinzu. Aus seinem Verhalten konnte ich schließen, daß es nicht nur eine schlichte kleine Cabriolimousine war, und als wir vor Cypress Woods vorfuhren, sah ich dann auch tatsächlich einen bonbonroten Mercedes mit einer weißen Schleife um die Motorhaube, der in der Auffahrt geparkt war.
»Der gehört mir?« rief ich aus.
»Dein erstes Hochzeitsgeschenk. Hab deine Freude daran«, sagte er.
»O Paul, das geht einfach zu weit«, rief ich aus und brach in Freudentränen aus. Hier erwartete uns jetzt dieses prachtvolle Haus mit unseren Hausangestellten, unser wunderbares Grundstück mit unseren Ölfeldern im Hintergrund und mein Atelier. Hatten wir uns dem Schicksal widersetzt, der Vorbestimmung Rauch ins Gesicht geblasen? Würde Pauls neubegründeter Reichtum genügen, um die heulenden Winde und die kalten Schauer des Elends vor die Tür zu weisen? Zumindest für den Augenblick war ich gegen meinen Willen ebenso optimistisch und glücklich wie er.
Vielleicht war ich tatsächlich Alice im Wunderland, dachte ich. Vielleicht war es das, was mir von Anfang an vorbestimmt gewesen war, und in der Welt der reichen Kreolen von New Orleans hatte ich nie etwas zu suchen gehabt. Vielleicht waren mir dort nur deshalb all diese schrecklichen Dinge zugestoßen, Dinge, die mich zurück ins Bayou getrieben hatten, an den Ort, an den ich gehörte. Paul nahm Pearl in seine Arme.
»Anstelle von dir werde ich Pearl über die Schwelle tragen«, sagte er. »Schließlich wird sie hier die Prinzessin sein.«
Mir fiel das weiße Pulver auf, das auf die Stufen vor dem Haus gestreut worden war. Paul bemerkte es ebenfalls.
»Ich nehme an, das war Lettys Werk«, sagte er.
Die hohe, breite Tür wurde von unserem Butler James Humble geöffnet. Er war fast einen Meter neunzig groß, ein hagerer Mann mit braungelocktem Haar, karamelfarbener Haut und leuchtenden hellbraunen Augen. Mit seiner perfekten Haltung, in der er unsere Anweisungen erwartete, sah er aus wie ein Bilderbuchbutler.
»Das ist James«, sagte Paul. »James, Madame Tate.«
»Willkommen, Madame«, sagte er mit einer leichten Verbeugung. Er hatte eine tiefe Stimme und eine kultivierte französische Aussprache.
»Danke, James.«
Als ich die Eingangshalle betrat, fand ich dort Holly Mixon vor, die uns erwartete. Sie war eine grobknochige Frau mit kräftigen Armen und Schultern.
»Und das ist Holly«, sagte Paul. »Holly, Madame Tate.«
Sie machte einen Knicks.
»Hallo, Holly.«
»Guten Tag, Ma’am«, sagte sie.
»Wo ist Letty?« fragte Paul.
»Sie ist in der Küche, Monsieur, und bereitet das Abendessen zu. Sie duldet keinen von uns in der Küche, wenn sie bei der Arbeit ist«, fügte sie noch hinzu.
»Ich verstehe«, sagte Paul und zwinkerte mir zu. »Warum bringst du Pearl nicht gleich rauf ins Kinderzimmer, Ruby? Ich möchte zu meinen Eltern rüberfahren und ihnen persönlich die Neuigkeiten mitteilen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Das heißt, wenn du damit einverstanden bist.«
»Ja, Paul«, sagte ich. Der Gedanke an ihre Reaktion bewirkte, daß sich etwas Hartes, Schweres in meiner Brust einkeilte.
»Sowie ich zurückkomme, werden wir uns darum kümmern, daß deine Sachen hergebracht werden, einverstanden?«
»Ja«, sagte ich und nahm ihm Pearl ab.
Er beugte sich vor, küßte mich kurz auf die Wange und eilte aus dem Haus.
»Also, dann«, sagte ich und wandte mich an Holly. »Warum gehen Sie nicht voraus ins Kinderzimmer, und dort sehen wir uns an, was getan werden muß?«
»Ja, Ma’am«, sagte sie.
Wenn ich nicht im Hause der Dumas gelebt hätte und dort von Dienstboten umgeben gewesen wäre, wäre mir unbehaglich dabei zumute gewesen, einen Butler, ein Dienstmädchen und eine Köchin zu haben. Ich gehörte wohl kaum zu der Sorte, die sich Allüren zulegte und sich wie eine große Dame benahm, aber Paul hatte eine enorme Villa hingestellt, die Haushaltshilfen erforderlich machte. Ich mußte jetzt nur noch meinen Platz einnehmen und die Herrin von Cypress Woods werden.
Letty erinnerte mich tatsächlich an Nina Jackson. Sie trug wie Nina ein rotes Kopftuch mit sieben Knoten, die alle nach oben ragten, ein Tignon. Aber sie war wesentlich größer und wesentlich dünner, erstaunlich dünn für eine Köchin, und sie hatte lange Hände, auf deren schokoladenbrauner Haut sich die Adern abzeichneten. Sie hatte ein schmales Gesicht mit dünnen Lippen und einer dünnen Nase. Sie sagte mir, ihre Augen stünden zu dicht zusammen, weil ihre Mutter an dem Tag, an dem sie schwanger geworden war, von einer Klapperschlange überrascht worden war. Ich sah, daß sie Kampfer um den Hals trug, und ich wußte, daß das dazu diente, Bakterien fernzuhalten.
Letty war eine echte Köchin, die ihr Handwerk bei guten Köchen erlernt hatte. Die erste Mahlzeit, die sie für uns zubereitete, stellte das unter Beweis. Als Appetitanreger gab es Austern Bienville, gefolgt von Schildkrötensuppe. Filet de Boeuf aux Champignons mit gelben Kürbissen und Erbsen bildete das Hauptgericht. Zum Nachtisch hatte sie eine flambierte Orangencreme zubereitet.
»Mir ist aufgefallen, daß Sie weißes Pulver auf die Stufen vor dem Haus gestreut haben«, sagte ich zu ihr, nachdem wir einander vorgestellt worden waren und eine Zeitlang miteinander geredet hatten. Ihre kleinen dunklen Augen wurden noch kleiner.
»Ohne das arbeite ich in keinem Haus«, erwiderte sie entschlossen.
»Ich habe nichts dagegen einzuwenden, Letty. Meine Grandmère Catherine war Traiteur. Sie war eine Wunderheilerin«, sagte ich, und sie war beeindruckt und strahlte über das ganze Gesicht.
»Dann sind Sie ein Feenkind.«
»Nein, ich bin nur ihre Enkelin«, verbesserte ich sie. An mir ist nichts Feenhaftes, dachte ich.
Ich hörte Paul zurückkehren und lief ihm entgegen. Er lächelte, doch ich sah den Schmerz in seinen Augen.
»Sie waren außer sich, stimmt’s?« fragte ich.
»Ja«, gestand er ein. »Meine Mutter hat geweint, und Daddy hat geschmollt, aber nach einer Weile werden sie sich an den Gedanken gewöhnen und es akzeptieren, wie ich es dir vorausgesagt habe«, versprach er mir. »Meine Schwestern sind natürlich ganz begeistert«, fügte er eilig hinzu. »Sie werden morgen abend alle zum Essen herkommen. Ich fand, wir sollten den ersten Abend ganz für uns allein haben. Zwei meiner Männer warten draußen mit dem Lastwagen. Sie werden zu deiner Hütte fahren, um deine Sachen zu holen.«
»Pearl schläft noch«, sagte ich. Pauls Bericht hatte meine Aufregung und mein Glück schnell erlöschen lassen.
»Geh schon, fahr ihnen in deinem neuen Wagen voraus. Ich werde für sie dasein, wenn sie aufwacht. Geh schon. Holly kann mir schließlich helfen«, versicherte er mir.
»Sie wird sich fürchten, wenn sie an einem fremden Ort erwacht.«
»Aber sie wird keinen Fremden an ihrer Seite vorfinden«, erwiderte er zuversichtlich. »Sie hat doch mich.« Ich sah, wie sehr es ihm am Herzen lag, sich so schnell wie möglich einen Platz als ihr Vater zu erobern.
»Einverstanden. Ich werde nicht lange fort sein«, sagte ich. In der Hütte zeigte ich den Männern, welche Möbelstücke ich haben wollte. Ich sagte ihnen, das Gemälde würde ich selbst mitnehmen. Nachdem ich es sicher im Wagen verstaut hatte, ging ich wieder ins Haus, stellte mich ins Wohnzimmer und sah mich noch einmal gründlich um. Wie leer und trostlos doch alles ohne diese wenigen Möbelstücke wirkte. Es war, als verlöre ich Grandmère Catherine noch einmal und schnitte jegliche spirituelle Verbindung zu ihr ab, die noch zwischen uns bestand. Ihr Geist würde nicht mit mir gehen. Er gehörte hierher, in diese Schatten und dunklen Winkel, in die kleine Hütte auf den dünnen Pfählen, die so lange ihr herrschaftliches Haus gewesen war, ihr Palast, ihr Zuhause und auch meines. Wir hatten hier keineswegs nur glückliche Zeiten zugebracht, aber es waren auch nicht nur traurige gewesen.
Hier hatte sie mich getröstet, wenn ich mich gefürchtet und geängstigt hatte. Hier hatte sie ihre Geschichten gewoben und meine Hoffnungen heraufbeschworen. Hier hatten wir Seite an Seite daran gearbeitet, uns unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir hatten gelacht und geweint und waren vor Erschöpfung nebeneinander auf dem alten Sofa zusammengebrochen, das Grandpère Jack während seiner trunkenen Tobsuchtsanfälle regelrecht erschlagen hatte. Diese Wände hatten das Gelächter und das Leid ins sich aufgesogen und die wunderbaren Düfte von Grandmères Gerichten inhaliert. Durch diese Fenster hatte ich nachts zum Mond und zu den Sternen aufgeblickt, von Prinzen und Prinzessinnen geträumt und meine eigenen Märchen gesponnen.
Auf Wiedersehen, dachte ich. Endlich verabschiede ich mich von der Kindheit und von all den kostbaren Erinnerungen, die mich mit Blindheit geschlagen haben und mich glauben ließen, es gäbe keine Grausamkeit auf dieser Welt. Ich glaubte, in Cypress Woods in ein Wunderland eingezogen zu sein. So vieles dort erschien mir zu wunderbar, um wahr zu sein. Hier hatte ich einen ganz speziellen Zauber wahrgenommen, und hier hatte ich einige meiner besten Werke geschaffen.
Tränen liefen über meine Wangen. Ich wischte sie eilig fort, holte tief Atem und eilte aus dem Haus und die Stufen der Veranda hinunter zu meinem Wagen. Ohne mich noch einmal umzusehen, ließ ich meine Vergangenheit zum zweiten und vielleicht letzten Mal hinter mir zurück.
Jetzt war es an Paul, die Traurigkeit in meinem Gesicht zu sehen, als ich zurückkehrte. Er ließ die Sachen von Holly und James in mein Zimmer und Pearls Kinderzimmer bringen; dann nahm er mich mit hinter das Haus, damit ich mir unseren Pool und die Badekabinen ansah. Er sprach von seinen Plänen zur Landschaftsgestaltung, von den Bäumen, den Blumen und den Gehwegen und Brunnen, die er sich hier vorstellte. Er redete über die Parties, die wir veranstalten würden, über die Musik und über das Essen. Ich wußte, daß er einfach nur unermüdlich drauflosredete, damit ich nicht dazu kam, an der Vergangenheit herumzugrübeln und traurig zu sein.
»Hier gibt es soviel zu tun«, schloß er. »Wir haben jetzt keine Zeit mehr für Selbstmitleid.«
»O Paul, ich hoffe nur, daß du recht hast.«
»Natürlich habe ich recht«, beharrte er. Wir hörten jemanden rufen, und als wir uns umdrehten, sahen wir, daß seine Schwestern eingetroffen waren.
Jeanne war mit mir in dieselbe Klasse gegangen, als ich früher im Bayou gelebt hatte. Wir waren schon damals gute Freundinnen gewesen. Sie war zwei bis drei Zentimeter größer als ich und hatte dunkelbraunes Haar und nahezu mandelförmige Augen. Sie sah ihrer Mutter ähnlicher und hatte deren kräftigen dunklen Teint, ihr spitzes Kinn und ihre nahezu perfekte Nase. Ich hatte sie als ein fröhliches und zufriedenes Kind in Erinnerung. Toby war zwei Jahre jünger, und wenn sie ihrer Mutter auch nicht ganz so ähnlich sah, dann besaß sie doch deren strenge, spröde Art. Sie war ein bißchen kleiner, hatte aber breitere Hüften und einen volleren Busen. Ihr dunkelbraunes Haar war kurz geschnitten. Ihre Augen waren auffallend wachsam, emsig und forschend. Sie hatte eine bestimmte Art, die Mundwinkel herunterzuziehen, wenn sie etwas, was jemand gesagt oder getan hatte, anzweifelte oder mißbilligte.
»Ich habe ihnen doch gesagt, daß sie bis morgen warten sollen«, sagte Paul erbost.
»Es ist schon in Ordnung. Ich freue mich darüber, daß sie gleich gekommen sind«, sagte ich und ging ihnen entgegen. Sie umarmten und küßten mich beide; dann folgten sie mir ins Kinderzimmer, und Jeanne plapperte vergnügt vor sich hin, während ich Pearl die Windeln wechselte.
»Natürlich kommt es für uns wie ein Schock«, sagte sie. Atemlos sprudelte sie die Worte heraus. »Das sieht unserem Paul so gar nicht ähnlich, der immer alles bis zur Perfektion plant.«
»Warum habt ihr es jetzt getan?« fragte Toby. »Warum nicht, sobald ihr wußtet, daß du schwanger warst?«
Ich sah sie nicht an, als ich ihr antwortete, da ich fürchtete, sie könne mir die Lüge im Gesicht ansehen.
»Paul wollte es«, sagte ich, »aber ich wollte sein Leben nicht ruinieren.«
»Was ist mit deinem eigenen Leben?« entgegnete Toby.
»Mir hat es an nichts gefehlt.«
»Obwohl du ganz allein mit einem kleinen Baby in dieser Hütte gewohnt hast?«
»O Toby, warum die Vergangenheit ans Licht zerren? Jetzt ist alles vorüber, und sieh dir nur an, wo die beiden heute sind«, rief Jeanne aus und breitete die Arme aus. »Alle sind maßlos neidisch auf dieses Haus und auf Pauls Glück.«
Toby stellte sich neben mich und schaute auf Pearl herunter. »Wann habt ihr beide... sie gemacht?« fragte sie.
»Toby!« rief Jeanne aus.
»Ich frage ja nur. Sie braucht es mir ja nicht zu sagen, wenn sie nicht will, aber schließlich sind wir jetzt alle Schwestern. Wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben, stimmt’s? Was ist, stimmt’s?« fragte sie mich.
»Nein, keine Geheimnisse, aber jede von uns trägt ganz persönliche Dinge in ihrem Herzen mit sich herum, Dinge, die am besten dort verschlossen bleiben sollten. Vielleicht bist du jetzt noch zu jung, Toby, aber eines Tages wirst du es verstehen«, sagte ich. Es war die schärfste Antwort, die ich ihr je gegeben hatte. Sie blinzelte und kniff einen Moment lang die Lippen zusammen, und dann nickte sie, nachdem sie meine Worte gründlich durchdacht hatte.
»Du hast recht. Es tut mir leid, Ruby.«
»Das ist schon in Ordnung«, sagte ich lächelnd. »Wir sollten jetzt in jeder Hinsicht wie Schwestern sein.«
»Und das werden wir auch!« behauptete Jeanne. »Wir werden dir mit dem Baby helfen, nicht wahr, Toby? Wir werden echte Tanten sein.«
»Klar«, sagte Toby. Sie schaute auf Pearl herunter. »Ich habe schon oft genug den Babysitter gespielt, um zu wissen, wie man mit Säuglingen umgeht.«
»Pearl wird mit mehr Liebe und Aufmerksamkeit überhäuft werden, als sie ertragen kann«, versprach Jeanne.
»Das ist alles, was ich mir wünsche«, sagte ich. »Und daß wir alle eine große Familie werden.«
»Mutter ist immer noch reichlich sprachlos. Stimmt’s, Toby?« sagte Jeanne.
»Daddy platzt auch nicht gerade vor Stolz und Glück«, antwortete sie.
»Vielleicht will Daddy der Tatsache nicht ins Gesicht sehen, daß er schon so früh Grandpère geworden ist«, spottete Jeanne. »Meinst du nicht auch, daß das der Grund dafür ist, Ruby?«
Ich starrte sie lange Zeit an und lächelte schließlich. »Ja, wahrscheinlich«, sagte ich. Mir war unwohl dabei zumute, mich bis zur Taille in Täuschungen und Halbwahrheiten zu vergraben, aber im Moment gab es nun mal keinen anderen Ausweg, dachte ich.
Jeanne bemühte sich, Paul eine Einladung zum Abendessen abzuschwatzen, doch er bestand darauf, daß sie aufbrachen und morgen gemeinsam mit ihren Eltern wiederkamen.
»Und dann werden wir ein echtes Fest feiern«, sagte er. »Ruby und ich sind heute viel zu müde. Wir haben es bitter nötig, allein miteinander zu sein und uns auszuruhen«, erklärte er.
Toby grinste hämisch, doch auf Jeannes Gesicht drückte sich Enttäuschung aus, bis sie schließlich strahlend lächelte und ausrief: »Natürlich braucht ihr das. Schließlich sind gerade erst eure Flitterwochen angebrochen!«
Paul warf schnell einen Blick auf mich und errötete.
»Jeanne ist, wie üblich, vorlaut«, sagte Toby. »Komm schon, meine liebe Schwester, laß uns nach Hause gehen.«
»Was habe ich denn gesagt?«
»Es ist schon gut, Jeanne«, sagte ich zu ihr. Wir alle umarmten einander, und dann gingen sie.
»Es tut mir leid«, sagte Paul und schaute den beiden finster nach. »Ich hätte dich vor meinen Schwestern warnen sollen. Sie sind verzogen worden, und sie glauben, daß sie kriegen können, was sie wollen. Laß dir ihre Ungezogenheiten nicht gefallen. Weise ihnen klar und deutlich ihren Platz zu, und dann wird alles gutgehen«, versicherte er mir. »In Ordnung?«
»Ja«, sagte ich, aber es war mehr ein Gebet als eine Antwort.
An jenem Abend wurde uns das wunderbare Abendessen aufgetischt. Paul redete von seinen Ölfeldern und einigen seiner anderen Geschäftsvorhaben. Er sagte mir, er hätte in New Orleans ein Hotelzimmer für uns reserviert und wir würden übermorgen hinfahren.
»So bald schon?«
»Es ist zwecklos, das aufzuschieben, was ohnehin hier doch getan werden muß. Und denk daran, ich wünsche mir vor allem, daß du dich deiner Kunst widmest«, sagte er.
Ja, dachte ich, es war an der Zeit, daß ich mich meiner zweitgrößten Liebe wieder zuwandte – der Malerei. Nach dem Abendessen schlenderten Paul und ich durch das riesige Haus und besprachen, was wir tun würden, um die Einrichtung und die Ausstattung abzurunden. Ich erkannte jetzt erst, wie groß diese Aufgabe war, und ich fragte mich laut, ob ich diesem Vorhaben wohl gewachsen war.
»Natürlich schaffst du das«, versicherte er mir. »Aber vielleicht kann ich Mutter dazu bringen, daß sie dir dabei hilft. Solche Dinge tut sie leidenschaftlich gern«, sagte er. »Du kannst eine ganze Menge von meiner Mutter lernen«, fügte er hinzu. »Sie ist kultiviert und hat einen guten Geschmack. Das soll nicht heißen, du hättest das nicht«, fügte er eilig hinzu. »Es ist nur so, daß sie schon länger kostspielige Gegenstände einkauft, als du es tust«, sagte er mit einem Lächeln.
»Wie reich sind wir, Paul?« fragte ich. Waren die Möglichkeiten denn wirklich unbegrenzt?
Er lächelte. »Da die Ölpreise steigen und die Quellen vier- bis fünfhundert Prozent des vorhergesagten Ertrages abwerfen... wir sind Multimillionäre, Ruby. Neben uns nehmen sich deine reiche Stiefmutter und deine Schwester ärmlich aus.«
»Sag ihnen das bloß nicht«, sagte ich. »Es würde ihnen das Herz brechen.«
Paul lachte. Ich bekannte mich zu meiner Müdigkeit. Erschöpfung wäre das treffendere Wort. In emotionaler Hinsicht war der Tag die reinste Achterbahnfahrt gewesen. Momente der Depression und der Traurigkeit hatten sich mit Augenblicken größten Glücks abgewechselt. Ich ging nach oben und machte mich für die erste Nacht in meinem wunderschönen neuen Zuhause zurecht. Wieder einmal versetzte Paul mich in Erstaunen. Ich fand ein hübsches Nachthemd, einen Morgenmantel und Hausschuhe vor, alles schon für mich bereitgelegt. Holly war in diese Überraschung eingeweiht gewesen. Als ich mich bei Paul dafür bedankte, tat er so, als wüßte er von nichts.
»Das muß deine gute Fee gewesen sein«, sagte er.
Ich sah noch einmal nach Pearl. Sie schlief ruhig und zufrieden in ihrem hübschen neuen Bettchen. Ich beugte mich vor und küßte sie auf die Stirn, ehe ich in mein eigenes Schlafzimmer zurückkehrte und mich in mein eigenes breites Bett mit den flauschigen Kissen und der weichen Matratze legte.
Die Bewölkung und der Regen waren nach Südosten weitergezogen; die Wolkendecke über uns war aufgerissen und ließ den Mondschein auf unser prachtvolles Haus fallen und durch meine Fenster blinzeln. Ich lag behaglich da, war aber immer noch von Sorge erfüllt, was den Morgen jedes einzelnen unserer Tage betraf. Da hörte ich ein zartes Klopfen an der Verbindungstür.
»Ja?«
Paul öffnete die Tür und schaute ins Zimmer. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Ja, Paul. Es geht mir gut.«
»Hast du es auch bequem genug?« fragte er und blieb als Silhouette in der Tür stehen.
»Ja, sehr bequem.«
»Darf ich dir einen Gutenachtkuß geben?« fragte er mit zaghafter Stimme.
Einen Moment lang schwieg ich. »Ja«, sagte ich dann.
Er kam näher, beugte sich vor und preßte die Lippen auf meine Wange. Ich glaubte, das sei alles, doch als sein Mund sich meinen Lippen näherte, wandte ich den Kopf ab. Ich konnte seine Enttäuschung deutlich spüren. Er zog den Kopf ein paar Zentimeter zurück und blieb über mich gebeugt dastehen, ehe er sich wieder aufrichtete.
»Gute Nacht, Ruby. Ich liebe dich«, sagte er. »So sehr, wie dich ein Mann nur irgend lieben könnte«, fügte er hinzu.
»Das weiß ich, Paul. Gute Nacht.«
»Gute Nacht«, sagte er mit einer zarten und zaghaften Stimme, die wie die eines kleinen Jungen klang.
Er schloß die Tür zwischen unseren Zimmern, und eine Wolke zog vor den Spalt, der dem Mondschein ein Fenster in meine neue Welt geöffnet hatte. Eine Zeitlang war das Dunkel wieder tief und undurchdringlich.
Man konnte jedoch die Ölpumpen hören, obwohl sie sich auf der anderen Seite des Hauses befanden und ein gutes Stück von uns entfernt waren. Sie tauchten in die Eingeweide der Erde ein, um die schwarze Flüssigkeit herauszusaugen, die unsere Zukunft sicherte, Wälle des Reichtums um uns herum errichtete und die Dämonen von uns fernhielt. Paul hatte einen Burggraben aus Öl zwischen uns und den Widrigkeiten ausgehoben, die einen so großen Teil der Welt jenseits dieses Grabens bedrohten und erschütterten.
Ich konnte mich in meine luxuriöse Steppdecke hüllen, die Augen schließen, meine eigenen Ängste beiseite schieben und nur noch an die wunderbaren Dinge denken, die hier zu tun waren. Ich konnte von Pearl träumen als einem kleinen Mädchen, das ein eigenes Pony besaß. Ich konnte von Gartenparties träumen, von Geburtstagsfeiern und von eleganten Dinnerparties. Ich konnte von meinem Atelier träumen, das in Licht getaucht war und das ich mit neuen Arbeiten anfüllen würde.
Was könnte ich mir sonst noch wünschen? dachte ich mir. Du könntest dir Liebe wünschen, flüsterte ein kleines Stimmchen. Liebe.