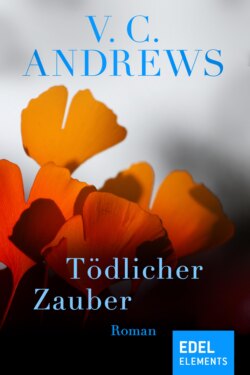Читать книгу Tödlicher Zauber - V.C. Andrews - Страница 6
1.
Die Zukunft lockt
ОглавлениеIch erwachte von lauten Rufen direkt unter meinem Fenster. Der zusätzliche Arbeitstrupp, den Daddy eigens engagiert hatte, um unser Haus und die Gärten für meine Schulabschlußfeier zu schmücken, war eingetroffen, und jetzt wurden den Arbeitern ihre Aufgaben zugeteilt. In der vergangenen Nacht hatte es geregnet, und der feuchte, süße Duft von grünem Bambus und blühenden Kamelien hüllte mich ein. Nachdem ich mir den Schlaf aus den Augen gerieben hatte, setzte ich mich auf und sah, daß die Sonne die restlichen Wolken auseinandertrieb und goldene Strahlen über den Pool und die Tennisplätze warf. Es war, als hätte jemand eine Decke gelüpft, unter der kostbare Juwelen zum Vorschein kamen. Unsere Gärten erstrahlten in ihrer vollen Pracht, und unsere blauen und zartvioletten spanischen Fliesen funkelten. Hätte einer der wichtigsten Tage meines Lebens schöner anfangen können? Innerhalb von Sekunden fielen sämtliche Netze der Verwirrung, alle Schatten der Finsternis und meine Kindheitsängste vollständig von mir ab.
Ich war siebzehn und hatte gerade die Highschool erfolgreich abgeschlossen. Und noch dazu als Klassenbeste, die die Abschlußrede hält! Ich seufzte zufrieden und ließ dann die Blicke durch mein Zimmer schweifen. Schon vor langer Zeit hatte Mommy es wieder in den Zustand zurückversetzt, in dem sie es vorgefunden hatte, als sie nach New Orleans gekommen war. Ich schlief in ihrem breiten Himmelbett aus dunklem Föhrenholz. Der Betthimmel war aus edler elfenbeinfarbener Seide angefertigt und von langen Fransen gesäumt. Meine Kissen waren so riesig und flauschig, daß ich jedesmal, wenn ich den Kopf darauf legte, das Gefühl hatte, einen halben Meter tiefer zu sinken. Das Laken, die Kissenhüllen und der Bettbezug waren aus zartestem blütenweißem Musselin. Über dem Kopfende meines Bettes hing ein Gemälde von einer wunderschönen jungen Frau, die in einem Garten steht und einen Papagei füttert. Ein niedlicher schwarzweißer Welpe zerrte am Saum ihres vollen Rockes.
Zu beiden Seiten meines Bettes standen Nachttische mit Lampen, deren Schirme glockenförmig waren, und abgesehen von einer passenden Kommode und einem Kleiderschrank war mein Zimmer außerdem noch mit einem Frisiertisch eingerichtet, über dem ein riesiger ovaler Spiegel in einem Rahmen aus Elfenbein hing, den handgemalte rote und gelbe Rosen zierten. Dort hatten Mommy und ich oft nebeneinander gesessen und uns im Spiegel betrachtet, während wir uns frisierten, uns schminkten und unsere Gespräche von Mädchen zu Mädchen führten, wie sie es so gern nannte. Sie sagte, von jetzt an würden wir von Frau zu Frau miteinander reden; doch schon bald würde es lange Pausen zwischen diesen Gesprächen geben, da ich das College besuchen würde. Ich war begierig darauf gewesen, endlich erwachsen zu werden, und ich hatte dem heutigen Tag mit großer Spannung entgegengesehen, doch jetzt, als es endlich soweit war, war mir unwillkürlich ein wenig melancholisch zumute.
Jetzt würde ich mich von meinen Lausbubenjahren verabschieden müssen, dachte ich. Es war auch Schluß damit, an den Wochenenden morgens lange zu schlafen; Schluß damit, in den Tag hineinzuleben und sich keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Vorbei waren die langen Nachmittage, an denen ich stundenlang draußen im Garten gesessen und geträumt hatte. Die Uhr ließ sich nicht zurückdrehen, und das Voranrücken ihrer Zeiger würde mich und meine Mitschüler abrupt in die wahre Welt hinausstoßen, die Welt der Arbeit und der ernsthaften Studien am College, eine Welt, in der einem nur noch das eigene Gewissen über die Schulter schaute.
Als ich meinen Blick vom Spiegel losriß, richtete ich ihn auf die Tür und stellte fest, daß sie einen Spalt weit offenstand. Ein genaueres Hinsehen zeigte mir, daß mein Bruder Jean auf allen vieren hockte und durch den Spalt in mein Zimmer lugte. Mein Bruder Pierre dagegen saß auf Jeans Rücken und schaute mich ebenfalls an. Die beiden identischen Gesichter mit den himmelblauen Augen unter goldenen Ponyfransen waren von Neugier und Spannung erfüllt. Was sie von mir erwarteten, wußte ich nicht, aber fest stand, daß sie damit rechneten, ich würde etwas ganz Besonderes tun, wenn ich am Morgen meiner Abschlußfeier erwachte. Jetzt warteten sie gespannt darauf, daß ich etwas sagen oder tun würde, womit sie mich später aufziehen konnten.
»Jean! Pierre! Was tut ihr beide da?« rief ich. Sie ließen sich zur Seite fallen, sprangen auf und huschten lachend und quietschend vor Vergnügen wieder in ihr Zimmer, das Zimmer, das früher einmal unserem Großonkel Jean gehört hatte, dem Bruder des Vaters meiner Mutter. Ich hörte, wie sie die Tür zuschlugen, und einen Moment lang herrschte Stille.
Die meiste Zeit über benahmen sich die Zwillinge wie zwei kleine Welpen, die überall herumschnupperten und wühlten, wo sie nichts zu suchen hatten. Damit handelten sie sich im allgemeinen Ärger ein, und Daddy mußte sie bestrafen, obwohl ihm das ganz offensichtlich widerstrebte. Er hing an seinen beiden kleinen Söhnen, die sein ganzer Stolz waren und in die er außerdem große Hoffnungen setzte.
Gemeinsam schienen sie ein Spiegelbild von Daddy zu sein. Jean besaß den athletischen Körperbau seines Vaters und hatte von ihm die Liebe zum Sport, zur Jagd und zum Fischen geerbt. Pierre dagegen hatte seine Neugier geerbt, seine Sensibilität und seine Liebe zu den Künsten, aber keiner von beiden sah auf den anderen herab. Man hätte eher sagen können, meine Zwillingsbrüder seien wie zwei Hälften eines einzigen Bruders, ein Zwitter namens Pierre-Jean. Was der eine nicht bewerkstelligen konnte, das nahm der andere ihm ab, und was sich der andere nicht gründlich genug überlegte, das dachte sich der eine an seiner Stelle. Sie waren bereits wie zwei Musketiere, die keinen dritten brauchten.
Womit die beiden jeden erstaunten, sogar den größten Skeptiker, das war, daß sie nahezu gleichzeitig dieselben Kinderkrankheiten bekamen. Wenn sich einer von beiden eine Erkältung zuzog, dann bekam sie der andere nur wenige Minuten später, und ich schwöre, daß jedesmal, wenn Jean sich den Kopf anstieß oder sich das Knie aufschrammte, Pierre vor Schmerz das Gesicht verzog, während umgekehrt Jean eine Grimasse schnitt, wenn Pierre sich weh tat.
Ihnen schmeckten dieselben Speisen, und fast immer aßen sie dieselbe Menge, doch Jean, der schneller wuchs, begann jetzt mehr zu essen.
»Was ist denn hier los?« hörte ich Mommy sagen. Sie lauschte einen Moment lang und kam dann an meine Tür. »Guten Morgen, Pearl, mein Schätzchen. Konntest du wieder einschlafen?«
»Ja, Mommy.«
»Sind deine Brüder hier gewesen und haben dich geweckt?« fragte sie mit finsterer Miene.
Ich wollte die beiden nicht verpetzen, doch Mommy war nicht auf meine Bestätigung angewiesen.
»Also, wirklich, ich schwöre es, derzeit sind die beiden wie zwei Bisamratten, die jedem unter den Füßen rumhuschen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich mit ihnen anstellen soll. Jeder von beiden beeidet, daß der andere unschuldig ist, und dabei sieht er einen mit diesem liebreizenden Unschuldsblick an.« Sie schüttelte den Kopf. Auch wenn sie sich beklagte, wußte ich, wie froh sie darüber war, daß sich die beiden so nahestanden. Zwischen ihr und ihrer eigenen Zwillingsschwester hatte es sich ganz anders verhalten. Immer, wenn sie von ihrer Schwester Gisselle sprach, seufzte sie tief und reumütig, denn sie warf sich immer noch vor, daß sie es nicht geschafft hatte, Gisselle zu der Schwester zu machen, die sie ihr hätte sein sollen.
»Ich sollte jetzt ohnehin besser aufstehen, Mommy. Es gibt noch soviel zu tun, und ich möchte gern mithelfen.«
»Ich weiß«, sagte Mommy, und ihre Augen waren klein und dunkel. Für uns beide war dies einer jener Tage, an denen man glücklich und traurig zugleich ist, aber vielleicht traf es Mommy noch mehr als mich. Sie hatte oft genug gesagt, wenn es in ihrer Macht gestanden hätte, mich ewig ein kleines Mädchen bleiben zu lassen, dann hätte sie es getan. »Es geht ohnehin alles so schnell vorüber«, hatte sie mich gewarnt. »Warum die Dinge noch beschleunigen?«
Mommy sagte immer wieder, sie wollte nicht, daß ich auch nur einen einzigen Tag meiner Kindheit einbüßte. Sie behauptete, ihre eigene Kindheit vollständig übersprungen zu haben. Sie schob es auf ihr hartes Leben, daß sie so schnell erwachsen geworden war.
»Ich will ganz sichergehen, daß du nicht kämpfen und leiden mußt wie ich«, hatte sie oft zu mir gesagt. »Und wenn das bedeutet, daß du etwas verwöhnter sein wirst, dann soll es mir recht sein!«
Ich wußte jedoch, daß es ihr nicht gelingen würde, mich ewig ein kleines Mädchen bleiben zu lassen, jedenfalls nicht, wenn ich auch ein Wörtchen mitzureden hatte. Obwohl es wunderschön gewesen war, hier aufzuwachsen, konnte ich es inzwischen kaum noch erwarten, von hier fortzugehen und die weite Welt zu erkunden.
»Vermutlich bin ich heute mindestens so aufgeregt wie du«, sagte sie, und ihre Augen strahlten. Trotz der frühen Morgenstunde sah sie strahlend schön aus. Mommy war nie eine der Frauen gewesen, die sich stark schminkte oder sich übertrieben schonte, wie es die Mütter einiger meiner Freundinnen taten. Es kam nur äußerst selten vor, daß sie einem Schönheitssalon einen Besuch abstattete, und sie neigte auch nicht dazu, jede neue Mode mitzumachen, und doch war sie immer schick und elegant gekleidet. Aber vielleicht lag es daran, daß Mommy zu den ganz wenigen und besonderen Menschen gehörte, die den neuesten Trend bestimmten. Andere Frauen zeigten reges Interesse daran, wie sie sich kleidete, welche Farben sie trug und nach welchen Moden sie sich richtete. In New Orleans war sie eine hochangesehene Künstlerin, und ihr Erscheinen in einer Galerie oder zu einer Ausstellungseröffnung erregte immer Aufmerksamkeit. Häufig erschienen ihr Name und ihr Foto in den Klatschkolumnen.
Nur selten ließ sich Mommy das wallende rubinrote Haar schneiden, dem sie ihren Namen zu verdanken hatte. Sie trug es lang, und wenn sie es nicht aufsteckte, war es gelockt oder zu einem losen Knoten geschlungen. Sie hatte mich gelehrt, daß Schlichtheit eines der grundlegenden Elemente war, wenn man attraktiv sein wollte.
»Frauen, die sich mit kostbarem Schmuck behängen und ein auffälliges Make-up tragen, mögen zwar Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber oft sind sie gar nicht attraktiv, Pearl«, belehrte sie mich. »Ein Paar Ohrringe und eine Halskette sollten dazu dienen, das Gesamtbild abzurunden, ohne zu sehr ins Auge zu stechen und von der übrigen Erscheinung abzulenken, und dasselbe gilt auch für Make-up. Ich weiß, daß Mädchen in deinem Alter es für modisch und für faszinierend halten, großzügig Eyeliner aufzutragen, aber der Trick besteht darin, das Positive zu betonen, und nicht etwa, es zu vertuschen.«
»Ich weiß nicht, was an mir positiv sein soll, Mommy«, sagte ich, und sie lachte.
Dann richtete sie ihre smaragdgrünen Augen auf mich und schüttelte den Kopf. »Wenn Gott zu mir gekommen wäre, als ich schwanger war, und mich aufgefordert hätte, das Gesicht zu malen, das ich mir für mein Kind wünsche, dann hätte ich meine Sache nicht besser machen können, und ich hätte mir auch keine schöneren Gesichtszüge als deine ausmalen können, Pearl.
Und außer deiner Schönheit hast du auch noch eine wunderbare Figur, eine Figur von der Sorte, die die meisten Frauen vor Neid grün werden läßt. Ich will nicht, daß deine Schönheit dir zu Kopf steigt. Sei bescheiden und dankbar, aber sei nicht das unsichere kleine Geschöpf, das ich früher einmal gewesen bin. Dann nutzen dich die Menschen nämlich aus«, warnte sie mich, und ihre Augen wurden kleiner und dunkler, ein sicheres Anzeichen dafür, daß sie sich an eines der traurigeren, unschöneren Ereignisse ihres Lebens erinnerte.
Natürlich wußten meine Brüder und ich, daß Mommy im Bayou geboren und aufgewachsen war. Bis zu ihrem sechzehnten Lebensjahr hatte ihr Vater, nach dem mein Bruder Pierre benannt worden war, nichts von ihrer Existenz geahnt. Er glaubte, ihre Zwillingsschwester Gisselle sei das einzige Kind, das seiner Liebesbeziehung zu Gabrielle Landry entsprungen war. Zu dieser Zeit war er verheiratet gewesen, doch Daphne, seine Ehefrau, hatte Gisselle akzeptiert und als ihr eigenes Kind ausgegeben, nachdem mein Urgroßvater Dumas sie direkt nach ihrer Geburt den Landrys abgekauft und nach New Orleans gebracht hatte. Als sechzehn Jahre später meine Mutter überraschend auftauchte, flog der gewaltige Schwindel fast auf, doch die Familie hatte sich eine Geschichte ausgedacht und in Umlauf gesetzt, der zufolge sie gleich nach ihrer Geburt geraubt worden war und nach Hause zurückgekehrt sei, als das Cajun-Paar, das sie als Baby gestohlen hatte, plötzlich Gewissensbisse bekommen hatte.
Ab und zu schilderte Mommy, wie schwer das Leben mit einer Zwillingsschwester und mit einer Stiefmutter gewesen war, die sie beide ablehnten, doch Mommy verabscheute es, schlecht über die Toten zu reden. Sie war von ihrer Grandmère aufgezogen worden, einer Cajun-Heilerin, die die Kranken und Verletzten mit einer Mischung aus religiösen Zeremonien, medizinischen Kenntnissen und Ritualen, die altem Aberglauben entsprangen, heilte. Mommy glaubte an Geister. Sie erzählte mir, ihre Grandmère Catherine und Nina Jackson, die alte Köchin der Familie Dumas, die Voodoo praktizierte, hätten sie gewarnt, wenn sie mit diesen Geschichten die Toten weckte und ans Licht zerrte, könnten sie uns alle wie ein Spuk verfolgen.
Mommy versuchte nicht, mich dazu zu bewegen, daß ich an diese Dinge glaubte; sie wollte lediglich, daß ich die Menschen respektierte, die es taten, und daß ich kein Risiko einging. Manchmal schalt Daddy sie aus und sagte zu ihr: »Pearl ist eine naturwissenschaftlich begabte Frau. Schließlich will sie später einmal Ärztin werden, nicht wahr? Setz ihr bloß nicht diese Geschichten in den Kopf.«
Wenn es jedoch darum ging, meine Zwillingsbrüder in Schach zu halten, war Daddy nicht über den Versuch erhaben, ihnen mit Mommys Geschichten Angst einzujagen.
»Wenn ihr nicht aufhört, diese Treppe rauf- und runterzurennen, dann weckt ihr eines Tages noch den Geist eurer bösen Tante, der euch heimsuchen wird, wenn ihr schlaft«, warnte er sie. Mommy sah ihn dann mit einem vorwurfsvollen Zwinkern an, und er verzog sich murrend und klagte lauthals darüber, ein Mann hätte nicht einmal mehr in seinem eigenen Haus das Sagen.
»Ich wünschte, ihr beide, du und Daddy, hättet nicht beschlossen, ein derart großes Fest für mich zu geben, Mommy«, sagte ich, als ich aufstand, um mich zu waschen und mich für die Arbeit anzuziehen, die noch bevorstand. Daddy hatte eine der berühmten Jazzbands aus New Orleans engagiert, die auf dem Patio spielen sollte. Er hatte den Konditor eines Spitzenrestaurants engagiert, die Desserts zuzubereiten, und er hatte auch Kellner und Kellnerinnen eingestellt. Er hatte sogar einen Vertrag mit einer Filmgesellschaft abgeschlossen, die diese ganze Veranstaltung aufzeichnen sollte. Er veranstaltete ein derartiges Fest zu meinem Schulabschluß, daß ich mir überhaupt nicht ausmalen konnte, was er erst tun würde, wenn ich einmal heiratete. Aber andererseits konnte ich mir gar nicht vorstellen, jemals zu heiraten. Ich konnte mir nicht vorstellen, mein eigenes Zuhause zu haben und meine eigenen Kinder großzuziehen. Die Verantwortung war einfach gewaltig. Aber was ich mir wirklich am allerwenigsten vorstellen konnte, war, mich so sehr in jemanden zu verlieben, daß ich den Rest meines Lebens mit diesem Mann würde verbringen wollen, ihn jeden Morgen beim Frühstück und jeden Abend beim Abendessen zu sehen, überall mit ihm hinzugehen und ständig so schön und begehrenswert zu sein, daß er ausschließlich mit mir zusammen sein wollte. Natürlich hatte ich schon Freunde gehabt. Im Moment ging ich fest mit Claude Avery, aber ich konnte mir nicht ausmalen, mein Leben mit ihm zu verbringen, obwohl es in der ganzen Schule kaum einen anderen Jungen gab, der so gut aussah wie er mit seinem dunklen Haar und den silberblauen Augen. Claude hatte mir schon oft gesagt, daß er mich liebte, und er wartete darauf, daß ich ihm dasselbe sagen würde, aber das einzige, wozu ich mich durchringen konnte, war: »Ich mag dich auch sehr gern, Claude.«
Liebe mußte doch gewiß etwas anderes sein, etwas ganz Besonderes, dachte ich mir. Es gab viele Geheimnisse auf Erden, viele Probleme, die noch gelöst werden mußten, aber kein anderes schien sich so wenig lösen zu lassen wie die Antwort auf die Frage: Was ist Liebe? Meinen Freundinnen war es verhaßt, wenn ich ihre dramatischen Bekundungen, wie groß die Zuneigung war, die sie für den einen oder anderen Jungen verspürten, in Zweifel zog, und immer wieder warfen sie mir vor, ich wollte alles zu genau wissen und die Dinge unter dem Mikroskop untersuchen.
»Warum mußt du bloß so viele Fragen stellen?« beklagten sie sich, allen anderen voran Catherine Didion, meine beste Freundin. Catherine und ich unterschieden uns in so vieler Hinsicht voneinander, daß es schwer zu verstehen war, warum wir so eng miteinander befreundet waren, aber vielleicht fühlten wir uns gerade von diesen Unterschieden angezogen. In gewisser Weise war das, was unser reges Interesse aneinander wachhielt, die gegenseitige Neugier. Keine von uns beiden konnte wirklich verstehen, warum die andere so war, wie sie war.
»Ein so großes Fest ist es doch gar nicht«, sagte Mommy. »Und außerdem sind wir stolz auf dich, und wir wollen, daß die ganze Welt es erfährt.«
»Darf ich mir heute morgen mein Porträt ansehen, Mommy?« fragte ich. Mommy hatte ein Bild von mir in dem Kleid gemalt, das ich auf meiner Abschlußfeier in der Schule tragen würde. Sie hatte vor, es heute auf der Party zu enthüllen, doch ich selbst hatte das vollendete Werk bisher noch nicht zu sehen bekommen.
»Nein. Du wirst warten müssen. Es bringt Pech, ein Porträt vorzuzeigen, ehe es fertiggestellt ist. Ich muß es heute noch mit ein paar letzten Pinselstrichen abrunden«, sagte sie, und ich erhob keine Einwände. Mommy glaubte an gute und böse Gris-Gris und sie wollte dem Schicksal niemals ins Handwerk pfuschen. Sie trug immer noch das 10-Cent-Stück, das Nina Jackson ihr vor vielen Jahren als einen Glücksbringer geschenkt hatte. Sie trug es an einer Schnur um ihren rechten Knöchel.
»Und jetzt sollte ich mich besser mit deinen beiden Brüdern unterhalten und dafür sorgen, daß sie heute nicht das ganze Haus auf den Kopf stellen und jedem zur Last fallen.«
»Wirst du mir später dabei helfen zu entscheiden, was ich anziehen soll und wie ich mich frisieren soll, Mommy?«
»Ja, selbstverständlich, mein Liebes«, sagte sie, und in dem Moment läutete mein Telefon. »Bring mir bloß nicht den ganzen Vormittag damit zu, mit Catherine zu plaudern«, warnte mich Mommy, ehe sie sich auf den Weg zu den Zwillingen machte.
»Nein, ganz bestimmt nicht«, versprach ich, doch als ich den Hörer abnahm und mich meldete, war nicht etwa Catherine dran, sondern Claude.
»Habe ich dich geweckt?«
»Nein«, sagte ich.
»Jetzt ist unser großer Tag also gekommen«, verkündete Claude. Er schloß in diesem Jahr ebenfalls die Schule ab, doch ich wußte, daß er nicht nur davon sprach. Claude und ich gingen jetzt schon seit fast einem Jahr fest miteinander. Wir hatten uns geküßt, und ich hatte mich auch auf Petting mit ihm eingelassen, und einmal hatten wir in Ormand Lelocks Haus fast nackt nebeneinander gelegen, als seine Eltern ihn zwei Tage lang allein gelassen hatten. Zweimal hatten wir kurz davor gestanden, es tatsächlich zu tun, aber ich hatte mich jedesmal widersetzt. Ich hatte Claude gesagt, für mich müßte es etwas ganz Besonderes sein, und er hatte die Idee gehabt, wir könnten es uns für die Nacht unserer Abschlußfeier aufheben. Ich hatte nicht eingewilligt, aber ich hatte ihm auch nicht widersprochen, und ich wußte, daß Claude glaubte, heute würde es dazu kommen.
Als es das erste Mal beinah passiert war, hatte ich ihn zurückgehalten, indem ich ihm erklärt hatte, es sei ein Zeitpunkt, zu dem ich geradezu prädestiniert sei, schwanger zu werden. Er hatte frustriert und verärgert darauf reagiert, und als ich ihm den Zyklus einer Frau erklärte, war er vor Wut außer sich geraten.
»Der Zyklus beginnt mit dem Eisprung«, setzte ich an.
»Ich dachte, ich gehe mit dir aus«, stöhnte er, »und dann muß ich feststellen, daß ich statt dessen im Naturkundeunterricht sitze und einen Vortrag über die menschliche Fortpflanzung zu hören bekomme. Du denkst zuviel. Du kannst niemals abschalten!«
Hatte er damit recht? fragte ich mich. Wenn seine Finger mich an intimen Stellen berührten, bebte ich, aber ich fing unwillkürlich an, mir Gedanken zu machen und genau zu analysieren, warum mein Herz so heftig pochte. Ich dachte an Adrenalin und daran, warum meine Haut so warm geworden war. Abbildungen aus Lehrbüchern zogen vor meinem geistigen Auge vorbei, und Claude beschwerte sich darüber, daß ich zu reserviert und unbeteiligt war.
Als wir das nächste Mal allein miteinander waren, war er darauf vorbereitet und zeigte mir stolz seinen Schutz. Ich wollte seine Gefühle nicht verletzen, sagte ihm jedoch, ich sei noch nicht soweit.
»Du bist noch nicht soweit!« rief er aus. »Und woher willst du wissen, wann du soweit bist? Gib mir jetzt bloß keine komplizierte wissenschaftliche Antwort.«
Wie lautete meine Antwort? Wir hatten eine Menge Spaß miteinander gehabt, und all unsere Freunde nahmen an, wir seien ineinander verliebt. Die anderen Schüler in unserer Schule fanden, wir seien ein perfektes Paar. Aber ich wußte, daß wir kein perfektes Paar waren. Es mußte noch etwas anderes geben, etwas Wesentlicheres, was sich zwischen einem Mann und einer Frau abspielt, dachte ich.
Ich beobachtete Mommy und Daddy und wie sie auf Parties und bei Essenseinladungen miteinander umgingen, und ich sah, wie sehr sie aufeinander eingespielt waren. Jeder von beiden las die Gedanken des anderen und wußte genau, was der andere empfand, selbst dann, wenn ein Raum voller Menschen sie voneinander trennte. In ihren Augen knisterte Spannung, und ihre Liebe und ihr Verlangen waren ihnen so deutlich anzusehen, daß ich das Gefühl hatte, sie seien sich ihrer Zuneigung wahrhaft sicher. Vielleicht verlangte ich zuviel vom Leben, aber ich wünschte mir eine Liebe wie diese, und ich wußte, daß ich das mit Claude nicht haben konnte.
Ich wußte nicht, wie ich Claude sagen sollte, daß er nicht der Richtige für mich war, und fast hätte ich mir eingeredet, ich sollte es mit ihm tun, und sei es nur, um ihn und meine eigene wissenschaftliche Neugier in bezug auf Sex zu befriedigen. Trotzdem hatte ich mich bis zum heutigen Tage widersetzt, und jetzt kam die Nacht auf mich zu, die Claude für uns festgelegt hatte.
»Es ist alles geregelt«, sagte er. »Die Eltern von Lester Anderson brechen gleich nach der offiziellen Abschlußfeier nach Natchez auf. Er hat uns das Haus für unsere private Party zur Verfügung gestellt.«
»Ich kann unmöglich von meiner eigenen Party verschwinden, Claude.«
»Natürlich nicht gleich, das ist klar. Aber später, wenn wir alle ausgehen, werden deine Eltern es bestimmt verstehen. Sie waren schließlich früher selbst einmal jung«, sagte er. Er hatte eine Art an sich, die Augen zu verdrehen und ein Mädchen von Kopf bis Fuß zu mustern, und damit brachte er die meisten Mädchen in Verlegenheit. Viele kicherten und fühlten sich geschmeichelt, wenn Claude sie so ansah. In den letzten Wochen hatte ich den Verdacht geschöpft, daß Claude sich nebenher noch mit jemand anderem traf, vielleicht mit Diane Ratner, die ihre Blicke in den Korridoren so durchdringend auf uns richtete, daß ich spürte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten.
»Für meine Mutter hat niemand eine solche Party veranstaltet, als sie in meinem Alter war«, sagte ich liebevoll.
»Ich bin ganz sicher, daß sie trotzdem Verständnis dafür haben wird. Du willst doch später noch ausgehen, oder etwa nicht?« fragte er eilig. Als ich nicht augenblicklich darauf antwortete, stieß er ein weiteres: »Oder etwa nicht?« hervor, und aus seiner Stimme war Verzweiflung herauszuhören.
»Doch«, sagte ich.
»Dann ist es also abgemacht. Wir sehen uns dann später. Ich habe vor der Abschlußfeier noch eine ganze Menge zu tun, aber ich hole dich rechtzeitig ab.«
»In Ordnung«, sagte ich.
»Ich liebe dich«, fügte er hinzu und legte auf, ehe ich etwas erwidern konnte. Einen Moment lang saß ich mit pochendem Herzen da. Würde ich mich heute nacht endlich rumkriegen lassen? Sollte ich kapitulieren? Vielleicht suchte ich nur nach Ausreden, weil ich mich davor fürchtete.
Mommy und ich hatten oft genug intime Gespräche miteinander geführt, aber sie hatte meine Fragen nie wirklich beantwortet. Statt dessen hatte sie mir gesagt, niemand könnte einem anderen solche Fragen beantworten.
»Diese Fragen kannst nur du selbst dir beantworten, Pearl. Nur du allein wirst wissen, wann und mit wem es richtig für dich ist. Wenn du selbst etwas Besonderes daraus machst, dann wird es auch etwas ganz Besonderes sein. Frauen, die Sexualität leichtfertig handhaben, werden im allgemeinen auch leichtfertig behandelt. Hast du mich verstanden?«
Einerseits hatte ich verstanden, andererseits aber auch nicht. Ich war mir über die Grundlagen im klaren, die wissenschaftliche Seite, aber ich wußte nichts über den Zauber, denn genau den mußte Liebe für mich besitzen, glaubte ich, eine Form von Magie.
Als ich nach unten kam, stand das ganze Haus auf dem Kopf. Leute eilten durch die Gegend und befolgten Mommys Anweisungen. Sie nahmen diese und jene Veränderungen vor und stellten die Möbel um. Überall wurden Vasen mit Blumen aufgestellt. Die Hausmädchen machten Jagd auf die kleinsten Staubkörner. Sämtliche Fenster wurden geputzt, und alle Möbelstücke wurden frisch poliert. Das Surren von Staubsaugern erfüllte die Luft. Mommy ließ gerade unseren Ballsaal schmücken. Ein zwei Meter langes Spruchband mit Glückwünschen wurde an der Decke angebracht, ebenso wie zahllose bunte Luftballons, Girlanden in allen Regenbogenfarben und Lametta. Die Jazzband war bereits eingetroffen, um die Akustik zu überprüfen und die Notenständer und die Instrumente aufzustellen.
»Guten Morgen, Pearl«, rief Daddy mir zu, sowie er vom Patio hereinkam. »Wie geht es meiner kleinen Medizinstudentin?« Er gab mir einen Kuß auf die Stirn und umarmte mich kurz. Nichts, was ich je gesagt oder getan hatte, hatte Daddy größere Freude bereitet als mein Entschluß, Ärztin zu werden. Das war etwas, was er sich selbst einmal erträumt hatte.
»Bis zum Physikum habe ich es gebracht«, hatte er mir erzählt.
»Und warum hast du nicht weiterstudiert, Daddy?« hatte ich ihn gefragt. Einen Moment lang hatte es so ausgesehen, als würde er mir keine Antwort darauf geben. Seine Lippen hatten sich zusammengepreßt, seine Augen waren klein geworden, und sein Gesicht hatte sich verfinstert.
»Die äußeren Umstände haben mich eine andere Richtung einschlagen lassen«, hatte er dann geheimnisvoll erwidert. »Es war mir nicht bestimmt, Arzt zu werden. Aber vielleicht«, fügte er eilig hinzu, »liegt es daran, daß es dir bestimmt war.«
Welche äußeren Umstände? fragte ich mich. Wie kann einem Menschen etwas, was ihm derart am Herzen liegt, nicht bestimmt sein? Daddy war ein derart erfolgreicher Geschäftsmann, daß mir die Vorstellung schwerfiel, es gäbe etwas, was er nicht bewerkstelligen konnte, wenn er sich darauf versteifte. Als ich jedoch versuchte, weitere Antworten von ihm zu bekommen, reagierte Daddy mit Verschlossenheit und Unbehagen.
»Es ist nun einmal so gekommen«, sagte er und beließ es dabei. Da ich sah, daß dieses Thema ihn zu schmerzlich berührte, als daß er darüber hätte reden wollen, bohrte ich nicht weiter nach, aber das hieß noch lange nicht, daß damit meine Fragen aus der Welt geschafft waren. Sie hingen über uns allen, baumelten unsichtbar von den Decken des Hauses und hafteten den Bildern in unseren Fotoalben an, Familienfotos, die die seltsamen und mysteriösen Wendungen festhielten, die das Leben meiner Eltern vor und kurz nach meiner Geburt genommen hatte. Es war, als hätten wir in einer staubigen alten Truhe oben auf dem Dachboden Geheimnisse verborgen, und eines Tages – vielleicht sogar schon sehr bald – würde ich die Truhe öffnen und, ebenso wie Pandora, auf Enthüllungen stoßen, die zu schneller Reue führten.
»Ich fürchte, du wirst heute morgen beim Frühstück mit deinen Brüdern vorliebnehmen müssen«, sagte Daddy. »Deine Mutter und ich haben schon gefrühstückt, und wir haben viel zu tun, denn in diesem Haus geht es hektischer zu als in einem Bienenkorb.«
»Ich wünschte, ihr hättet kein ganz so großes Fest für mich geplant, Daddy.«
»Was? Etwas anderes kommt überhaupt nicht in Frage. Das Fest ist sogar bei weitem nicht groß genug. Stündlich fällt mir noch jemand ein, den wir hätten einladen sollen.«
»Die Gästeliste ist doch jetzt schon ellenlang!«
Er lachte. »Wenn man an meine Geschäftsverbindungen und die Künstlerschar deiner Mutter denkt, von deinen Lehrern und von deinen Freunden ganz zu schweigen, dann können wir von Glück sagen, daß sie nicht noch viel länger ist.«
»Und vor all diesen Menschen wird mein Porträt enthüllt werden. Es wird mir unsäglich peinlich sein.«
»Sieh es nicht als ein Porträt von dir an, Pearl. Am besten siehst du darin schlicht und einfach ein Kunstwerk deiner Mutter«, riet er mir. Ich nickte. Daddy war immer so vernünftig. Gewiß hätte er einen wunderbaren Arzt abgegeben.
»Ich werde mich mit dem Frühstück beeilen, damit ich euch hinterher helfen kann, Daddy.«
»Unsinn. Du wirst dir Zeit lassen, junge Frau. Du mußt entspannt sein, denn dir steht eine große Nacht bevor. Wie groß, das wirst du erst ahnen, wenn das Fest begonnen hat. Und außerdem hast du genug damit zu tun, dir Gedanken über deine Rede zu machen.«
»Wirst du dir später meinen Übungsvortrag anhören?«
»Natürlich, Prinzessin. Wir werden uns alle als dein erstes Publikum bereitstellen. Aber im Moment muß ich mich darum kümmern, wo wir die Wagen unterbringen werden. Ich habe Parkwächter engagiert, die die ankommenden Wagen parken und später wieder vorfahren werden.«
»Im Ernst?«
»Wir können unmöglich zulassen, daß unsere Gäste auf der Suche nach einem Parkplatz x-mal um Häuserblocks fahren müssen, das verstehst du doch sicher? Bist du so lieb und kümmerst dich darum, daß deine Brüder ordentlich frühstücken und niemandem zur Last fallen, ja?« fragte er und gab mir noch einen Kuß, ehe er zur Haustür hinauseilte.
Jean und Pierre saßen schon am Tisch und schauten beide so liebenswürdig und unschuldig drein, daß mir auf Anhieb klar war, daß sie etwas ausgeheckt haben mußten. Jean hingen Strähnen seines blonden Haars in die Stirn und über die Augen. Wie üblich war sein Hemd nicht richtig zugeknöpft. Pierres Erscheinungsbild war makellos, doch um seine Lippen spielte die Andeutung eines hämischen Lächelns, und Jeans blaue Augen funkelten, als er mich ansah. Ich vergewisserte mich vorsichtshalber, ob sie mir wirklich keinen Honig auf die Sitzfläche des Stuhls geschmiert hatten, damit ich daran kleben blieb.
»Guten Morgen, Pearl«, sagte Pierre. »Wie fühlt man sich, wenn man die Schule endgültig abschließt?«
»Ich bin sehr nervös«, sagte ich und setzte mich. Die beiden starrten mich an. »Habt ihr euch einen eurer albernen Streiche ausgedacht?«
Beide schüttelten gleichzeitig den Kopf, aber ich traute ihnen nicht. Ich sah mir gründlich den Eßtisch an, überprüfte den Fußboden um meinen Stuhl herum und nahm mir die Salz- und Pfefferstreuer vor. Es war schon vorgekommen, daß sie Pfeffer in den Salzstreuer gefüllt hatten, und ein anderes Mal hatten sie den Salzstreuer mit Zucker gefüllt.
Sie tauchten die Löffel in ihre Haferflocken und fingen an zu essen, ohne mich auch nur einen Moment lang aus den Augen zu lassen. Ich blickte zur Decke auf, um sicherzugehen, daß keine Schwarze Witwe oder eine andere eklige Spinne aus Plastik über mir hing.
»Was habt ihr beide angestellt?« hakte ich noch einmal nach. »Nichts«, erwiderte Jean daraufhin viel zu schnell.
»Ich schwöre es euch, wenn ihr heute etwas anstellt, dann lasse ich euch im Keller einsperren.«
»Ich weiß, wie ich aus einem abgesperrten Raum rauskomme«, prahlte Jean. »Ich weiß, wie man ein Schloß knackt. Stimmt’s, Pierre?«
»Das ist nicht weiter schwierig, und schon gar nicht mit unseren alten Schlössern«, sagte Pierre pedantisch. Er hatte eine Art an sich, die Augen zusammenzukneifen und die Unterlippe über die Oberlippe zu ziehen, wenn er eine ernstzunehmende Meinung äußerte.
»Ich kann auch die Angeln von der Tür abschrauben«, behauptete Jean.
»Schon gut. Hört mit dem Unsinn auf. Es ist mein Ernst«, sagte ich. Jean schien enttäuscht zu sein.
»Guten Morgen, Mademoiselle«, sagte Aubrey, unser Butler, als er aus der Küche kam, um mir ein Glas frisch gepreßten Orangensaft zu bringen. Aubrey war schon seit vielen Jahren bei uns. Er fiel niemals aus der Rolle des höflichen Engländers. Er war glatzköpfig und hatte nur kleine graue Haarbüschel direkt über den Ohren. Das dicke Brillengestell rutschte ständig auf seiner knochigen Nase herunter, und er kniff die grüngesprenkelten Augen zusammen, wenn er uns ansah.
»Guten Morgen, Aubrey. Heute möchte ich nur einen Kaffee und ein Croissant mit Marmelade. Mir ist zumute, als tummelten sich Schmetterlinge in meinem Magen.«
»Igitt«, sagte Jean. »Die waren vorher alle Raupen.«
»Sie meint doch nur, daß sie nervös ist«, erklärte Pierre.
»Weil du eine Rede halten mußt?« fragte Jean.
»Ja, vor allem deshalb«, sagte ich.
»Worum dreht sich deine Rede überhaupt?« fragte Pierre.
»Es geht darum, daß wir dankbar für das sein sollten, was wir haben, und für das, was unsere Eltern und unsere Lehrer für uns getan haben, und wie wir diese Dankbarkeit jetzt in harte Arbeit umsetzen müssen, um die Gelegenheiten, die sich uns bieten, und die Begabungen, die wir besitzen, nicht zu vergeuden und verkümmern zu lassen«, erklärte ich.
»Wie langweilig«, sagte Jean.
»Nein, das ist überhaupt nicht langweilig«, verbesserte ihn Pierre.
»Ich kann es nicht leiden, dazusitzen und mir Reden anzuhören. Ich wette, jemand wirft dir ein feuchtes Papierkügelchen an den Kopf«, drohte Jean.
»Ich rate dir, nicht derjenige zu sein, der das tut, Jean Andreas. Hier gibt es den ganzen Tag über jede Menge zu tun. Kommt bloß niemandem in die Quere und macht Mommy und Daddy das Leben nicht schwer«, warnte ich die beiden.
»Heute abend dürfen wir aufbleiben, bis alle Gäste gegangen sind«, verkündete Pierre.
»Und Mommy hat uns erlaubt, ein paar von unseren Freunden einzuladen«, fügte Jean hinzu. »Wir sollten Feuerwerkskörper anzünden, um zu feiern.«
»Wagt das bloß nicht«, sagte ich. »Pierre?«
»Er hat keine.«
»Charlie Littlefield hat aber welche!«
»Jean!«
»Ich sorge schon dafür, daß er es nicht tut«, versprach mir Pierre. Er bedachte Jean mit einem vernichtenden Blick, und Jean zuckte die Achseln. Seine Schultern waren im letzten Jahr breiter und voller geworden. Er war zäh und kräftig und hatte sich in der Schule in ein halbes Dutzend Ringkämpfe verwickeln lassen, doch ich hatte in Erfahrung gebracht, daß er drei dieser Schlägereien ausgefochten hatte, um Pierre gegen andere Jungen zu verteidigen, die ihn mit seinen Gedichten aufzogen. Alle ihre Freunde wußten, daß sich jeder, der sich mit Pierre anlegte, auf eine Schlägerei mit Jean einließ, und wenn sich jemand über Jean lustig machte, dann machte er sich gleichzeitig auch über Pierre lustig.
Der Rektor hatte Mommy und Daddy in die Schule bestellt, um mit ihnen über die Schlägereien zu reden, in die sich Jean so häufig verwickeln ließ, aber ich konnte sehen, wie stolz Daddy darauf war, daß Jean und Pierre sich gegenseitig beschützten. Mommy hielt ihm vor, die beiden nicht häufig genug auszuschalten.
»Die Welt ist hart und grausam«, sagte Daddy. »Sie müssen genauso hart und grausam sein.«
»Alligatoren sind hart und grausam, aber Menschen fertigen Schuhe und Notizbücher aus ihnen an«, gab Mommy daraufhin zurück. Ganz gleich, worum sich das Gespräch oder die Auseinandersetzung auch drehten, Mommy hatte es an sich, immer wieder auf ihre Cajun-Vergangenheit zurückzugreifen und eine Analogie zu finden, mit der sie ihre Argumente unterstreichen konnte.
Nach dem Frühstück ging ich wieder in mein Zimmer, um meiner Ansprache den letzten Schliff zu verleihen, und Catherine rief an.
»Hast du dich entschlossen, was du heute nacht tun wirst?« fragte sie.
»Es wird furchtbar schwierig werden, von meiner eigene Party zu verschwinden. Meine Eltern tun ja soviel für mich«, stöhnte ich.
»Nach einer Weile merken die überhaupt nicht mehr, daß du weg bist«, sicherte mir Catherine zu. »Du weißt doch selbst, wie Erwachsene sind, wenn sie für ihre Kinder Parties geben. In Wirklichkeit veranstalten sie sie ja doch nur für sich selbst und ihre Freunde.«
»Das trifft auf meine Eltern nicht zu«, sagte ich.
»Du mußt einfach zu Lester gehen«, jammerte sie. »Schließlich haben wir es monatelang geplant, Pearl! Claude erwartet es von dir. Ich weiß, wie sehr er sich schon darauf freut. Er hat es Lester gesagt, und Lester hat es mir gesagt, damit ich es dir sage.«
»Ich werde auf die Party gehen, aber ich weiß nicht, ob ich über Nacht bleiben werde«, sagte ich.
»Deine Eltern erwarten von dir, daß du die ganze Nacht durchmachst. Das ist wie im Karneval. Sei bloß nicht ausgerechnet heute nacht der Spielverderber, Pearl«, warnte sie mich. »Ich weiß, weshalb du dir Sorgen machst«, fügte sie hinzu. Catherine war der einzige Mensch auf Erden, der die Wahrheit über mich und Claude kannte.
»Ich kann nichts dafür«, flüsterte ich.
»Ich weiß nicht, weshalb du dir solche Sorgen machst. Schließlich weißt du, wie oft ich es schon getan habe, und ich bin immer noch am Leben, oder etwa nicht?« sagte Catherine lachend.
»Catherine ...«
»Wenn das nicht die Nacht ist, um mal ordentlich loszulegen. Du hast es dir verdient«, sagte sie. »Wir werden viel Spaß haben. Ich habe Lester versprochen, dafür zu sorgen, daß du kommst.«
»Wir werden es ja sehen«, sagte ich und war immer noch nicht bereit, mich festzulegen.
»Ich schwöre es dir, Pearl Andreas, wir werden dich dazu zwingen, endlich eine Frau zu werden, und wenn wir dich fortzerren müssen, weil du um dich trittst und schreist.« Wieder lachte sie.
War es wirklich das, was einen zur Frau machte? fragte ich mich. Ich wußte, daß viele meiner Schulfreundinnen es so sahen. Manche steckten sich ihre sexuellen Erfahrungen wie Verdienstabzeichen an. Sie stolzierten durch die Gegend und strahlten Überlegenheit aus. Es war, als seien sie auf dem Mond gewesen und zurückgekommen und wüßten soviel mehr über das Leben als wir übrigen. Die Promiskuität hatte ihnen eine gewisse Raffinesse verliehen und ihnen Einsichten über das Leben im großen und ganzen und insbesondere über die Männer vermittelt. Catherine glaubte, all das träfe auf sie zu, und daher gab sie sich oft herablassend.
»Du bist belesen«, sagte sie immer wieder zu mir, »aber vom Leben hast du keine Ahnung. Noch nicht.«
Hatte sie etwa recht?
Würde diese Nacht in mehr als einer Hinsicht meine Reifeprüfung sein?
Nachdem Catherine und ich unser Gespräch beendet hatten, fiel es mir schwer, mich meiner Rede wieder zuzuwenden, doch ich tat es trotzdem. Nach dem Mittagessen setzten sich Daddy, Mommy und die Zwillinge in Daddys Büro, um mir zuzuhören, als ich meinen Vortrag probte. Jean und Pierre saßen vor dem Sofa auf dem Fußboden. Jean zappelte herum, doch Pierre blickte zu mir auf und lauschte gebannt.
Als ich meinen Vortrag beendet hatte, klatschten sie alle in die Hände. Daddy strahlte, und Mommy wirkte so glücklich, daß ich beinah selbst in Tränen ausbrach. Der Beginn der Abschlußfeier in der Schule war auf vier Uhr angesetzt, und daher ging ich nach oben, um mich zu frisieren. Mommy kam und setzte sich neben mich.
»Ich bin ja so nervös, Mommy«, sagte ich zu ihr. Mein Herz pochte schon jetzt.
»Du wirst deine Sache gut machen, Schätzchen.«
»Es ist etwas ganz anderes, meine Rede vor dir und Daddy und den Zwillingen zu halten, als vor einem Publikum von Hunderten von Leuten! Ich habe Angst, daß es mir schlicht und einfach die Sprache verschlägt.«
»Schau dich in dem Moment, bevor du anfängst, im Publikum nach mir um«, sagte sie. »Dann wird es dir schon nicht die Sprache verschlagen. Ich werde dich mit Grandmère Catherines Blick ansehen«, versprach sie mir.
»Ich wünschte, ich hätte Grandmère Catherine gekannt«, sagte ich und seufzte tief.
»Ja, das wünschte ich auch«, sagte sie, und als ich ihr Spiegelbild ansah, bemerkte ich, wie weit ihre Augen träumerisch in die Ferne geschweift waren.
»Mommy, du hast gesagt, du würdest mir heute viel erzählen, was die Vergangenheit betrifft.«
Sie nickte und zog die Schultern zurück, als bereitete sie sich darauf vor, auf einem Zahnarztstuhl Platz zu nehmen.
»Also, gut. Was willst du wissen, Pearl?«
»Du hast mir nie wirklich erklärt, warum du deinen Halbbruder Paul geheiratet hast«, sagte ich eilig und senkte den Blick. Nur die allerwenigsten Menschen wußten, daß Paul Tate Mommys Halbbruder war.
»Oh, doch, das habe ich dir ganz genau erklärt. Ich habe dir gesagt, daß wir beide, du und ich, ganz allein miteinander waren und im Bayou gelebt haben, und Paul wollte uns beschützen und für uns sorgen. Er hat Cypress Woods einzig und allein für mich gebaut.«
Ich konnte mich kaum noch an Cypress Woods erinnern. Seit Pauls Tod und dem widerlichen Vormundschaftsprozeß, der daraufhin erfolgt war, waren wir nie mehr dorthin zurückgekehrt.
»Er hat dich mehr geliebt, als ein Bruder seine Schwester lieben sollte?« fragte ich furchtsam. Allein schon die Vorstellung, daß die beiden sich zusammengetan hatten, schien mir sündhaft zu sein.
»Ja, und das war die Tragödie, aus der es kein Entrinnen gab.«
»Aber warum hast du ihn geheiratet, wenn du doch damals schon Daddy geliebt hast und ich schon geboren war?«
»Alle haben geglaubt, daß du Pauls Tochter bist«, sagte sie. Sie lächelte. »Einige von Grandmère Catherines Freundinnen waren sogar tatsächlich erbost darüber, daß er mich nicht schon eher geheiratet hat. Ich nehme an, ich habe sie in diesem Glauben gelassen, damit sie mich nicht für eine fürchterliche Person halten.«
»Weil du dich von Daddy hast schwängern lassen und dann ins Bayou zurückgegangen bist?«
»Ja.«
»Warum bist du nicht einfach in New Orleans geblieben?«
»Mein Vater war gestorben, und das Leben mit Daphne und Gisselle war ziemlich unerfreulich. Als Beau nach Europa geschickt worden ist, bin ich fortgelaufen. Genauer gesagt«, fügte sie hinzu, »wollte Daphne, daß ich eine Abtreibung vornehmen lasse.«
»Wirklich?«
»Dann wärst du nie geboren worden.«
Allein schon der Gedanke daran ließ mir den Atem stocken.
»Deshalb bin ich ins Bayou zurückgegangen, und dort hat sich Paul um uns gekümmert. Als ich gehört habe, daß sich Daddy in Europa mit einer anderen Frau verlobt hat, habe ich endlich eingewilligt und Paul geheiratet.«
»Und dann war Daddy gar nicht verlobt?«
»Es war eine dieser abgemachten Sachen. Er hat mit der jungen Dame gebrochen und ist nach New Orleans zurückgekehrt. Meine Schwester hatte sich schon vorher mit ihm getroffen. Sie hat schon immer das bekommen, was sie wollte, und dein Vater war lediglich eine weitere Trophäe, mit der sie sich schmücken wollte«, sagte Mommy, und ihre Stimme war nicht frei von Bitterkeit.
»Daddy hat Gisselle geheiratet, weil sie dir so ähnlich gesehen hat, stimmt’s?« Das war etwas, was ich aus Daddy herausgequetscht hatte, ehe er beschlossen hatte, die Flut von Fragen einzudämmen, mit der ich ihn überschüttete.
»Ja«, sagte Mommy.
»Aber keiner von euch beiden ist glücklich gewesen?«
»Nein, und das, obwohl Paul soviel für uns getan hat. Ich habe damals all meine Zeit ausschließlich meiner Kunst und dir gewidmet. Aber als Gisselle dann krank geworden ist und im Koma lag ...«
»Hast du ihren Platz eingenommen.« Diese Geschichte kannte ich. »Und was ist dann passiert?«
»Sie ist gestorben, und nach Pauls tragischem Tod im Sumpf ist es zu diesem gräßlichen Prozeß gekommen. Gladys Tate wollte sich rächen. Aber das hast du doch fast alles ohnehin schon gewußt, Pearl.«
»Ja, Mommy, aber ...«
»Was ist, Schätzchen?«
Ich schaute in ihr liebevolles Gesicht auf. »Warum bist du schwanger geworden, wenn du nicht mit Daddy verheiratet warst?« fragte ich. Mommy war heute so weise. Wie konnte es sein, daß sie damals nicht klug genug war, um zu wissen, was passieren würde? Das mußte ich sie fragen, obwohl ich wußte, daß es eine sehr persönliche Frage war. Ich wußte, daß die meisten meiner Freundinnen, darunter auch Catherine, niemals ein derart intimes Gespräch mit ihren Müttern hätten führen können.
»Wir waren so verliebt, daß wir uns nicht viele Gedanken gemacht haben. Aber das ist keine ausreichende Entschuldigung«, fügte sie eilig hinzu.
»Ist es das, was passiert, und ist das der Grund dafür, daß manche Frauen schwanger werden, obwohl sie nicht verheiratet sind? Sind sie derart verliebt, daß sie sich keine Gedanken machen?«
»Nein. Manche sind einfach nur zu sehr vom Sex besessen und verlieren die Selbstbeherrschung. Du kannst das klügste Mädchen in der ganzen Schule und noch so sehr belesen sein, und du kannst die besten Noten nach Hause bringen, aber wenn es um Hormone geht ... tja, dann muß man eben vorsichtig sein«, sagte sie.
»Das erscheint mir ungerecht«, sagte ich.
»Was?«
»Daß Männer nicht dieselben Risiken tragen.«
Mommy lachte. »Nun, das ist durchaus ein weiterer Grund dafür, sich nicht von einem jungen Mann zu etwas überreden zu lassen, was man nicht wirklich tun will. Wenn die Männer wüßten, was es heißt, ein Kind zu gebären, dann würden sie vielleicht nicht ganz so leichtfertig handeln.«
»Sie sollten die Schmerzen, die die Wehen mit sich bringen, selbst durchmachen«, sagte ich.
»Und morgens sollte ihnen übel werden, und sie sollten mit hängendem Bauch und Rückenschmerzen durch die Gegend laufen«, fügte Mommy hinzu.
»Und den Drang nach sauren Gurken und Brötchen mit Erdnußbutter verspüren.«
»Und dann Krämpfe bekommen.«
Wir lachten beide schallend und umarmten uns dann.
Daddy hörte uns, als er die Treppe heraufkam. Er klopfte an die Zimmertür. »Darf man fragen, worüber ihr beiden Weiber jetzt schon wieder kichert?« erkundigte er sich.
»Über schwangere Männer«, sagte Mommy.
»Hm?«
Wir lachten wieder schallend los.
»Frauen sind nicht nur das andere Geschlecht. Sie stammen von einer vollkommen anderen Rasse ab«, erklärte Daddy. Das brachte uns nur noch mehr zum Lachen.
Nachdem meine Frisur so saß, wie ich es mir wünschte, nahm ich das Unterkleid zur Hand, das ich unter dem Kleid für meine Abschlußfeier tragen würde. Dann öffnete ich die Schachtel, die mein quadratisches Barett und mein Ballkleid enthielt, und augenblicklich stieß ich einen lauten Schrei aus.
»Was ist passiert, Pearl?« keuchte Mommy.
»Mein Barett ist verschwunden, Mommy.«
»Was? Das kann nicht sein.« Sie sah selbst nach, und dann zog sie die Augenbrauen hoch. »Das sieht deinen Brüdern ähnlich«, sagte sie und stolzierte aus dem Zimmer. Ich folgte ihr in meinem Kleid für die Abschlußfeier, als wir die Treppe hinunterliefen und Mommy nach Pierre und Jean rief. Sie kamen durch die Eingangshalle gelaufen, Pierre dicht auf den Fersen von Jean.
»Habt ihr das Barett eurer Schwester genommen, das sie für die Abschlußfeier braucht?« fragte sie. Sie stand da und hatte die Arme in die Hüften gestemmt.
Pierre warf einen schuldbewußten Blick auf Jean, der den Kopf schüttelte.
»Jean! Flunkerst du etwa?«
»Was geht hier vor?« erkundigte sich Daddy, der herangeeilt kam und hinter uns stehen blieb.
»Pearls Barett ist verschwunden, und ich glaube, daß diese beiden kleinen Gauner ganz genau wissen, wo wir es finden können«, sagte Mommy, ohne den Blick von den Zwillingen zu lösen. Pierre schlug schnell die Augen nieder.
»Also, was ist?« sagte Daddy mit strenger Stimme.
»Ich habe auf der Adonis-Statue im Garten ein Barett gesehen«, gestand Jean.
»Was?« Daddy und Mommy sahen einander an, und dann tappten wir alle in den Garten hinaus.
Die Statue trug tatsächlich das Barett, das ich für meine Abschlußfeier brauchte. Den ganzen Tag über waren Menschen an dieser Statue vorbeigelaufen, und niemand hatte es bemerkt, oder zumindest hatte sich niemand dazu geäußert. Daddys Lippen verzogen sich einen Moment lang zu einem Lächeln, doch als er Mommy ins Gesicht sah, wurde sein Mund sofort zu einem schmalen Strich. Er holte das Barett und reichte es mir, ehe er sich an die Zwillinge wandte, die entsetzte Gesichter schnitten.
»Wie konntet ihr es wagen, eurer Schwester einen solchen Streich zu spielen? Ihr wißt doch beide, wie nervös sie ohnehin schon ist.«
»Es war alles meine Idee«, sagte Pierre.
»Nein, das stimmt nicht, es war meine«, beharrte Jean.
Daddy sah erst die Statue und dann die beiden an. »Ich vermute, daß Jean Pierre hochgehoben hat, damit er der Statue das Barett aufsetzen kann. Stimmt’s, oder habe ich recht?«
Pierre nickte.
»Ich glaube, heute abend werdet ihr beide früh in eure Zimmer gehen und die Party verpassen.«
»Oh, nein!« rief Jean aus. »Wir wollten Pearl doch nur einen Streich spielen. Wir hätten ihr gesagt, wo ihr Barett ist.«
»Trotzdem ...«
»Es ist schon gut, Daddy«, sagte ich. »Von jetzt an werden die beiden für den Rest des Tages die reinsten Engel sein, nicht wahr, meine kleinen Brüder?« sagte ich. Beide nickten heftig und waren mir dankbar dafür, daß ich ihnen so klaglos verziehen hatte.
»Also, wenn eure Schwester euch verzeihen kann, dann habt ihr noch mal Glück gehabt. Ihr solltet alles tun, was ihr könnt, damit das der schönste Abend ihres bisherigen Lebens wird«, warnte Daddy die beiden.
»Mhm. Wird gemacht«, sagte Jean.
»Und jetzt zieht euch um, und wenn ihr mir wieder unter die Augen kommt, erwarte ich von euch, daß ihr einen ordentlichen Anblick bietet«, sagte Daddy. Die beiden machten eilig kehrt und liefen ins Haus zurück.
Mommy und Daddy sahen einander an, und dann warfen sie einen Blick auf die Statue, ehe wir alle drei in Gelächter ausbrachen. Das schien die Eisschicht zu durchbrechen, die mich eingehüllt hatte. Jetzt fürchtete ich mich weniger vor dem, was mir heute noch bevorstand.
Aber vielleicht hätte ich mich fürchten sollen. Vielleicht war es besser, ständig ein wenig Angst vor der Zukunft zu haben, damit man sich dementsprechend vorsah. Vielleicht glaubte Mommy deshalb so fest an gute und böse Gris-Gris und bekreuzigte sich dreimal, wann immer wir versehentlich auf eine Beerdigung stießen.
Irgendwie wußte ich, daß ich viel eher Gewißheit darüber erlangen würde, als ich es mir je erträumt hätte.