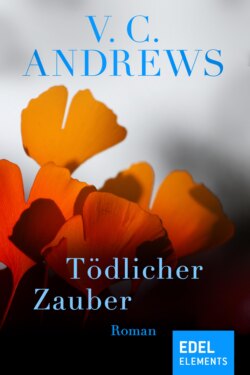Читать книгу Tödlicher Zauber - V.C. Andrews - Страница 8
3.
Schöne neue Welt
ОглавлениеDer erste Tag der Sommerferien bescherte uns einen Hitzerekord. Die Temperaturen überschritten die Vierziggradmarke, und die Luftfeuchtigkeit war derart hoch, daß ich mir einbildete, sehen zu können, wie sich direkt vor meinen Augen Tröpfchen in der Luft bildeten. Ich brauchte nur ein paar Kreuzungen weit zu laufen, um zur Haltestelle der Straßenbahn zu gelangen, die mich zum allgemeinen Krankenhaus Broadmoor brachte, in dem ich in den Sommermonaten arbeiten würde. Doch als ich in die Straßenbahn einstieg, war meine Kleidung bereits klatschnaß, und ich hatte das Gefühl, mein Haar klebte auf meiner Stirn und Kopfhaut. Sämtlichen Fahrgästen schien diese Schwüle zuzusetzen, denn sie saßen mit erschöpften und abgespannten Gesichtern da und konnten es wohl kaum erwarten, ihre klimatisierten Arbeitsplätze zu erreichen. Sogar der Baldachin, den die ausladenden Kronen der Eichen bildeten und der normalerweise so hoch und majestätisch wirkte, schien niedergedrückt und ermattet zu sein, und das Laub hing kläglich nach unten. Die Vögel, die gewöhnlich freudig umherschwirrten, wirkten wie ausgestopft und auf die Zweige geklebt, denn sie dachten gar nicht daran, ihre Energien zu vergeuden.
Trotz dieser Hitze war ich von überschäumender Spannung gepackt. Ich rechnete zwar nicht damit, viel mehr tun zu dürfen, als den Krankenschwestern zur Hand zu gehen und Botengänge zu erledigen, und dennoch freute ich mich darauf, unter Medizinern zu sein und möglichst viel über die Krankenpflege zu lernen. Zum ersten Mal in meinem Leben würde ich wirklich ein Teil dieser mysteriösen und magischen Welt sein, in der Ärzte und Krankenschwestern aufgrund ihrer Klugheit, ihres Wissens und ihrer Einblicke über die Behandlungen entschieden, die dazu dienten, Kranke zu heilen und Menschenleben zu retten. Ich brauchte meine Phantasie nicht überzustrapazieren, um zu verstehen, warum Mommys Cajun-Verwandtschaft an die Kräfte von Heilern glaubte. Obwohl die Medizin zu den Naturwissenschaften zählte, waren Ärzte und Krankenschwestern in der Vorstellung der meisten Menschen Zauberer. Sie horchten unser Inneres ab und schauten in es hinein, um zu entdecken, wo unsere Körper Schwächen hatten oder welche winzigen Feinde in uns eingedrungen waren, um Schaden anzurichten. Das Broadmoor Krankenhaus war auf einem kleinen grasbewachsenen Hügel errichtet worden. Hohe Platanen mit dichtem Laub ragten in zwei Zweiergruppen davor auf, und die Auffahrt wurde von wilden Mohrrüben gesäumt. In den Gärten wuchsen Unmengen von Azaleen, gelben und roten Rosen und Hibiskussträuchern. Klettertrompeten rankten sich über die unteren Balkone, und purpurne Glyzinien lugten durch die verschnörkelten schmiedeeisernen Zäune. Rechts daneben war ein kleiner Teich angelegt worden, dessen Wasser die Farbe von starkem dunklem Tee hatte.
Ursprünglich war das Gebäude ein Herrenhaus gewesen, das die Konföderiertentruppen während des Bürgerkriegs beschlagnahmt und in ein Notlazarett umgewandelt hatten. Im Lauf der Jahre hatte man angebaut und modernisiert, aber es war keineswegs eines der größten Krankenhäuser der Stadt. Daddy glaubte jedoch, ich würde einen größeren Nutzen daraus ziehen, in einem kleinen Krankenhaus zu arbeiten, da dort eine persönlichere Atmosphäre herrschen würde.
Die Straßenbahn hielt etwa eine Kreuzung von dem Krankenhaus entfernt an, und ich lief eilig auf den Haupteingang zu. Im Vergleich zu den moderneren Krankenhäusern der Stadt war die Eingangshalle winzig. Die alten Kronleuchter waren durch helle, aseptisch wirkende Neonröhren ersetzt worden, und die beigen Wände waren frisch gestrichen. Die Bodenfliesen waren gerade erst geschrubbt worden; ein kleines Schild warnte vor Rutschgefahr. Ich wartete am Informationsschalter, um dort den Weg zum Personalbüro zu erfragen. Eine ältere Dame in einer rosafarbenen Tracht schickte mich in den kurzen Korridor auf der rechten Seite und sagte mir, es sei die erste Tür links.
Dort fand ich eine große dunkelhaarige Frau vor, die die Schubladen von Aktenschränken zuknallte, während sie eine Kopiermaschine, die Formulare ausspuckte, nicht aus den Augen ließ. Als sie sich umdrehte, um zu sehen, wer in das Büro gekommen war, fiel mir ein dunkelblauer Tintenfleck auf ihrem Kinn auf. Sie war mindestens einen Meter achtzig groß und hatte einen auffallend harten und knochigen Gesichtsschnitt. Unter ihrer dunkelblauen Bluse konnte man deutlich die Schlüsselbeine erkennen. Sie hatte lange Arme und schmale Finger.
Ihr Lächeln wirkte, als spannten sich ihre Lippen kurz wie ein Gummiband, und über ihr Gesicht zog sich ein blaßroter Streifen. Sie griff sich an die Nasenspitze und öffnete die matt-braunen Augen etwas mehr, denn ihre Lider hingen so tief herunter, daß sie nahezu vollständig geschlossen waren. Sie schnappte nach Luft, ehe sie etwas sagte, als müßte sie erst genug Atem schöpfen, ehe ein Laut aus ihr herauskam.
»Ja?« fragte sie dann, ohne ihren Ärger über diese Störung zu verhehlen.
»Ich suche Mrs. Morgan«, sagte ich.
»Ich bin Mrs. Morgan.«
»Bonjour! Ich bin Pearl Andreas. Ich bin heute den ersten Tag hier«, sagte ich. »Mr. Marbella, der Krankenhausverwalter, hat gesagt, ich sollte mich gleich nach meinem Erscheinen bei Ihnen zur Arbeit melden.«
»Zuerst mußt du diese Papiere ausfüllen«, sagte sie und wies auf einen kleinen Tisch zu meiner Rechten. Darauf lagen stapelweise Formulare.
»Alle?« fragte ich.
»Fang links an, und fülle jeweils ein Formular von jedem der drei ersten Stapel aus. Vergiß bloß nicht, deine Sozialversicherungsnummer einzutragen. Solange die nicht ausgefüllt ist, kann ich der Rechnungsabteilung keine Genehmigung erteilen, dir den ersten Lohn auszuzahlen. Und prüfe nach, ob die Nummer auch wirklich korrekt ist.«
»Ja, Ma’am.«
»Sowie das alles erledigt ist, gehst du zu Mrs. Winthrop im ersten Stock. Sie ist die Oberschwester der heutigen Tagschicht. Die Treppe am Ende des Ganges hoch und dann nach rechts. Sie wird dir eine Schwesterntracht aushändigen und dich über deine Aufgaben und Pflichten belehren.«
»Ja, Ma’am.«
»Deine Dienstkleidung gehört dir nicht«, belehrte sie mich. »Sie bleibt Besitz des Krankenhauses. Du kannst sie nach Hause mitnehmen, wenn du willst, und es unterliegt deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, daß deine Schwesterntracht stets sauber und gepflegt aussieht. Ein Pfand in Höhe von zehn Dollar für die Arbeitskleidung wird dir von deinem ersten Wochenlohn abgezogen.«
Sie beugte sich über den Schreibtisch und sah auf meine Schuhe herunter. »Heute kannst du diese Schuhe tragen, aber morgen solltest du in weißen Schuhen mit weichen Sohlen erscheinen. Die kannst du in dem Geschäft für Ärztebedarf in der Canal Street kaufen. Bezahlen mußt du sie selbst.«
»Ich verstehe«, sagte ich.
Sie seufzte wieder; diesmal entstand der Eindruck, als würde ihr Körper schlichtweg unter der Bluse und dem Rock zusammensacken, dessen Saum bei jedem ihrer Schritte fast den Boden streifte. »Ist das dein erster Job?«
»Nun, im Grunde genommen ...«
»Ich werde dir alles erklären, was mit Lohnsteuer, Quellensteuer, Essenszuschüssen und Medikamenten für deinen Privatgebrauch zu tun hat ... nachdem du diese Formulare ausgefüllt hast«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Meine Assistentin ist mal wieder krankgeschrieben. Im allgemeinen ist sie für personelle Neuzugänge zuständig. Da arbeitet sie in einem Krankenhaus und läßt sich ständig krankschreiben«, fügte sie hinzu. »In den zwölf Jahren, die ich schon hier arbeite, bin ich nicht einen einzigen Tag lang ausgefallen, aber heute haben die Leute nicht mehr dieselbe Einstellung zu ihrer Arbeit. Wenn es um Verantwortung geht, sind junge Menschen die reinsten Drückeberger.«
»Ich nicht«, sagte ich. »Ich bin sogar unglaublich gespannt darauf, den Sommer über hier zu arbeiten. Ich werde später einmal Ärztin werden«, berichtete ich ihr.
»Ach, wirklich?« Sie zog die Wange zwischen ihre Zähne, biß leicht darauf und legte den Kopf zur Seite. »Ich persönlich bin noch nie bei einer Ärztin gewesen, und wahrscheinlich werde ich mich auch niemals einer Frau anvertrauen, wenn mir etwas fehlt.« Sie riß den Kopf zurück, nahm eine steife Haltung ein und wies auf den Schreibtisch, als hätte ihr jemand einen Rippenstoß versetzt, um sie daran zu erinnern, daß sie sich an ihrem Arbeitsplatz befand. »Je schneller du diese Formulare ausfüllst, desto eher kannst du damit beginnen, dir deinen Lohn zu verdienen. Dort drüben mußt du täglich beim Kommen und beim Gehen deine Karte in die Stechuhr schieben«, sagte sie und deutete auf die gegenüberliegende Wand. »Ich werde noch im Lauf des heutigen Tages eine provisorische Karte für dich besorgen. Heute werde ich ausnahmsweise handschriftlich festhalten, wann du tatsächlich mit deiner Arbeit beginnst. Erwarte bloß nicht, daß dir die Zeit gutgeschrieben wird, die du für das Ausfüllen der Formulare brauchst.«
»Ja, Ma’am«, sagte ich und machte mich an das Ausfüllen der Formulare. Nachdem ich damit fertig war und sie ihr gab, rasselte sie die Informationen über meinen Lohnstreifen herunter, und eine Erklärung folgte derart schnell auf die andere, daß ich kaum Zeit fand zuzuhören, ganz zu schweigen davon, daß ich irgend etwas verstanden hätte.
Dann beugte sie sich zu mir vor, schürzte einen Moment lang die Lippen und sagte: »Tu deine Arbeit, und steck die Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Leute, wenn du keine Schwierigkeiten bekommen willst.«
»Danke, Ma’am«, sagte ich. Sie trat zurück und wies mit einer Kopfbewegung auf die Tür. Ich lief eilig hinaus und nahm die Treppe in den ersten Stock. Das Schwesternzimmer befand sich etwa auf halber Höhe des Ganges. Eine Krankenschwester, die um die fünfzig Jahre alt zu sein schien und graue Locken und freundliche blaue Augen hatte, drehte sich zu mir um, als ich näher kam. Neben ihr stand eine kleine, schlanke Schwarze mit großen, runden Augen.
»Ich suche Mrs. Winthrop«, sagte ich. »Ich bin Pearl Andreas.«
»Komm herein, meine Liebe, ich bin Mrs. Winthrop.
Wir haben dich schon erwartet. Sophie wird dich zum Wäscheschrank führen und eine Schwesterntracht für dich heraussuchen«, sagte sie und nickte der schlanken jungen Schwarzen zu, die ungefähr sechzehn Jahre alt war. Ihr Haar war sehr kurz geschnitten, und sie hatte eine winzige Narbe auf der linken Wange, die dennoch ins Auge stach. Eilig kam sie um den Schreibtisch herum.
»Hier entlang«, sagte sie. Sie starrte mich an und musterte mich dann eingehend von Kopf bis Fuß. Als wir uns weit genug vom Schwesternzimmer entfernt hatten, drehte sie sich abrupt zu mir um. »Warum willst du als Schwesternhelferin arbeiten?« fragte sie schroff. »Du scheinst aus einer reichen Familie zu stammen.«
»Ich möchte in den Sommerferien in einem Krankenhaus arbeiten, weil ich vorhabe, Medizin zu studieren«, sagte ich zu ihr. »Vorher möchte ich so viele Erfahrungen wie möglich sammeln.«
»Du willst Ärztin werden? Wie lange muß man zur Schule gehen, um das Diplom zu bekommen?« fragte sie. Inzwischen machte sie einen freundlicheren Eindruck.
»Man besucht das College und studiert an der medizinischen Fakultät einer Universität. Das dauert etwa sieben Jahre, und dann muß man in einem Krankenhaus sein Klinikum absolvieren. Ich werde Ende Zwanzig sein, ehe ich selbst praktizieren kann.«
»Wir haben hier einen von denen«, sagte Sophie.
»Was für einen?«
»Einen Arzt, der hier sein Praktikum absolviert. Dr. Weller. Er ist aber noch kein richtiger Arzt. Das dauert noch einige Jahre.«
»Es ist wahr, daß man viele Jahre lang hart arbeiten muß. Ich hoffe, ich schaffe es durchzuhalten«, sagte ich.
Wieder kniff sie die Augen zusammen. »Und du bist ganz sicher, daß du Ärztin werden willst?«
»Ja, ich bin ganz sicher.«
»Eine Frau, die Arzt ist, ist mir hier noch nie begegnet.«
»Tja, vielleicht werde ich die erste sein«, sagte ich lächelnd.
Einen Moment lang sah sie mich nachdenklich an, und dann kniff sie skeptisch die Augen zusammen. »Hast du schon mal jemandem eine Bettpfanne untergeschoben?«
»Nein.«
»Hast du schon mal Erbrochenes aufgewischt?«
»Ja, einmal, als einer meiner Brüder sich übergeben hat«, erwiderte ich.
Sie beugte sich zu mir vor. »Hast du je Blut gesehen, Unmengen von Blut?«
»Ich habe bereits Blut gesehen«, versicherte ich ihr.
»Und Därme?«
»Ich habe Tiere seziert, und ich weiß, wie ein Mensch von innen aussieht«, sagte ich.
Sophie wich schockiert zurück. »Wo hast du denn das getan?«
»In der Schule. Im Labor. Du nicht?«
»Ich habe die Schule nur bis zur fünften Klasse besucht«, erzählte sie mir, »und wir hatten dort kein Labor, aber ich bin hier dafür zuständig, das Labor zu putzen, und daher kommt es, daß ich Blut, Därme und Eingeweide nicht nur gesehen, sondern auch gerochen habe. Man braucht einen unglaublich robusten Magen. Den habe ich. Inzwischen gibt es keinen Anblick und keinen Geruch mehr, bei dem ich mich übergeben muß«, fügte sie stolz hinzu.
»Das freut mich für dich«, sagte ich. »Es würde dir schwerfallen, täglich zur Arbeit zu gehen, wenn dir dort immer wieder übel würde.«
Sie nickte. »Das andere Mädchen, das letzten Freitag hergekommen ist, das ist am ersten Tag kreideweiß geworden und hat eine halbe Stunde lang nur im Bad gestanden und gekotzt, ehe Mrs. Winthrop sie nach Hause geschickt hat. Ich bin froh, daß du jetzt hier bist, denn seit dieses andere Mädchen fortgegangen ist, mußte ich zweimal soviel arbeiten.«
»Ich werde mich bestimmt nicht übergeben. Das verspreche ich dir«, sagte ich.
Das schien sie zufriedenzustellen. Wir erreichten den Wäscheschrank, in dem nicht viele Schwesterntrachten hingen. Alles, was da war, war mir entweder zu klein oder zu groß. Die Tracht, die mir noch am besten paßte, lag so eng an, daß ich die beiden obersten Knöpfe nicht schließen konnte. »Ich vermute, fürs erste wird es diese Tracht hier tun müssen«, sagte ich.
»Was trägst du um den Knöchel? Ist das ein Zehncentstück?« fragte Sophie.
»Ja. Es ist ein Glücksbringer.«
Einen Moment lang musterte sie mich argwöhnisch. »Wer hat ihn dir gegeben?«
»Meine Mutter. Ein ganz besonderer Mensch in ihrem Leben hat ihn ihr vor langer Zeit geschenkt.«
»Meine Mama sagt, Leute, die ein Zehncentstück um den Knöchel tragen, praktizieren Voodoo.«
»Das Zehncentstück ist ein gutes Gris-Gris, falls es das ist, was du meinst, aber das heißt noch lange nicht, daß ich Voodoo praktiziere.«
»Tut es deine Mama?«
»Nein, nicht wirklich«, sagte ich, doch sie sah mich weiterhin mißtrauisch an.
»Wie alt bist du?« fragte Sophie.
»Siebzehn. In zwei Monaten werde ich achtzehn. Und wie alt bist du?«
»Willst du die Wahrheit wissen oder das, was ich den Leuten hier erzähle?«
»Die Wahrheit.«
»Ich werde im August vierzehn, aber sie glauben alle, daß ich siebzehn werde. Sag es bloß niemandem«, warnte sie mich.
»Nein, ganz bestimmt nicht.«
»Laß uns jetzt zu Mrs. Winthrop gehen.«
»Konntest du denn keine Tracht finden, die ihr besser paßt, Sophie?« fragte die Oberschwester sofort.
»Die anderen sind entweder noch viel kleiner oder viel, viel größer, Mrs Winthrop«, sagte Sophie. »Sie hat sie alle anprobiert.«
»Ich fürchte, die hier paßt mir noch am besten«, sagte ich. »Wenn das so ist, werde ich Mr. Marbella bitten, mehr Schwesterntrachten zu bestellen. Da du jetzt hier bist, Pearl, werden wir die Station zwischen dir und Sophie aufteilen. Du wirst die Zimmer zweihundert bis zweihundertfünf übernehmen. Sophie wird sich um die restlichen Zimmer kümmern.« Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Es ist jetzt an der Zeit, den Patienten ihren Saft zu bringen und ihre Wasserkrüge nachzufüllen. Sophie wird dir zeigen, wo du alles findest.«
Sophie führte mich in die Küche, wo sich eine weitere, wesentlich jüngere Krankenschwester mit dem Assistenzarzt unterhielt, der dort sein Klinikum machte. Er saß mit dem Rücken zu uns, und sie lehnte an der Anrichte. Als wir eintraten, lachten die beiden.
»Entschuldigung«, sagte Sophie und machte einen kleinen Knicks. »Wir müssen jetzt den Saft verteilen.«
Die Krankenschwester verzog hämisch das Gesicht und machte ihr den Weg zum Kühlschrank frei. Auf ihrem Namensschild konnte ich lesen, daß sie Mrs. Crandle war. Sie hatte hellbraunes Haar, das sie relativ kurz trug, grüne Augen und einen festen, verkniffenen Mund mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Sie war nicht unattraktiv, doch ihre Nase war etwas zu spitz und ein wenig zu lang. Der Assistenzarzt drehte sich auf seinem Stuhl um und lächelte strahlend, als er mich sah.
»Wen haben wir denn da?« fragte er.
»Sie ist die neue Schwesternhelferin«, erklärte Sophie. »Sie heißt Pearl.«
»Hallo, Pearl«, sagte er. »Ich bin Dr. Weller. Meine Mutter fand schon immer, ich sollte Arzt werden. Wegen unseres Namens. Kapiert? Ich sorge dafür, daß es den Leuten besser geht.« Er lachte, aber Mrs. Crandle schnitt eine Grimasse, als peinigte es sie, sich diesen Witz zum x-ten Male anhören zu müssen.
»Hallo«, sagte ich. Er erhob sich zu seiner vollen Größe von einem Meter achtzig und reichte mir die Hand. Sein Lächeln wurde breiter, und ich konnte seine makellosen schneeweißen Zähne sehen. Seine dunklen Augen funkelten schelmisch, als ich ihm die Hand gab. Eilig schlang er seine Finger um meine. Seine Haut war so hell wie meine, doch durch den starken Kontrast zu seinem dunklen Haar wirkte er etwas bleich. Sein kräftiges Kinn hatte ein Grübchen, und ein zweites Grübchen in seiner rechten Wange ließ sich anscheinend von seinem Willen beeinflussen, da es sich bildete, wieder verschwand und sich von neuem bildete.
»Es war aber auch höchste Zeit, daß endlich etwas mehr Schwung in den Laden kommt«, sagte er und grinste immer noch von einem Ohr zum anderen. Er warf Mrs. Crandle einen Blick zu, und sie hob die Augen zur Decke.
»Genau das hat uns noch gefehlt«, bemerkte sie. »Noch etwas, das Sie von der Arbeit ablenkt.«
»Hör nicht auf sie. Ich lasse mich niemals von etwas ablenken, was ich mir in den Kopf setze«, sagte er, ohne mich auch nur einen Moment lang aus den Augen zu lassen. Seine Blicke glitten langsam an mir herunter, und als er mir wieder ins Gesicht sah, hatten seine Augen einen zufriedenen Ausdruck.
»Eine Tracht einer Schwesternhelferin, die so sexy ist, habe ich noch nie gesehen«, fügte er hinzu.
»Es war keine passende Tracht da, aber ...«, setzte ich an – und spürte, wie mein Gesicht glühte und meine Wangen sich röteten.
»He, ich wollte damit doch nicht sagen, daß sie dir nicht steht.« Er lachte. Meine Hand hatte er immer noch nicht losgelassen.
»Wir müssen jetzt anfangen, den Saft an die Patienten auszuteilen«, sagte ich.
»Ja, klar.« Noch ein weiteres belustigtes Lächeln, und er ließ meine Hand los.
»Sie wird später auch einmal Ärztin werden«, prahlte Sophie.
»Stimmt das?«
»Ja«, sagte ich.
»Nicht vielleicht Krankenschwester, sondern wirklich Ärztin?«
Ich sah Mrs. Crandle an, die sich abrupt wieder zu mir umgewandt hatte, als er mir diese Frage gestellt hatte.
»Ich finde, Krankenschwestern kommt ebensoviel Bedeutung zu«, sagte ich, »aber ich interessiere mich in erster Linie dafür, auch außerhalb des Krankenhauses Medizin zu praktizieren.«
»Ach? Du scheinst ja reichlich ehrgeizig zu sein.« Er zog die Stirn in Falten. Dann fragte er mich mit einer tieferen Stimme: »Wie sieht es mit deinen Noten in der Schule aus?«
»Ich war Klassenbeste«, sagte ich.
Er zog die Augenbrauen hoch. »Beeindruckend. Wir sollten wirklich auf der Hut sein und darauf achten, wie wir uns ausdrücken, Mrs. Crandle«, scherzte er.
»Ich würde sagen, Sie sollten in mehr als einer Hinsicht auf der Hut sein«, bemerkte sie. »Ich muß jetzt jedenfalls einen Patienten an den Tropf hängen. Haben Sie denn gar nichts zu tun, Doktor?«
»Himmel«, sagte er. »Natürlich habe ich zu tun. Also, viel Glück, Pearl. Hab keine Hemmungen, zu mir zu kommen, wenn du irgendwelche Fragen hast«, sagte er und folgte widerstrebend Mrs. Crandle aus der Küche.
»Er macht immer Witze«, sagte Sophie. »Mrs. Crandle sagt, eines Tages werden sich ein paar von seinen Patienten totlachen. Geht das denn, daß man sich totlacht?«
»Nein, ich glaube nicht«, sagte ich. Sie schien nicht gerade überzeugt zu sein, doch nickte sie und zeigte mir dann, wo alles Nötige zu finden war. Ich lud meinen Wagen voll und begann meine erste Runde.
In dem ersten Zimmer fand ich zwei ältere Frauen vor, von denen eine an ein EKG angeschlossen war. Im zweiten Zimmer traf ich auf einen Mann mit einem gebrochenen Bein, im dritten auf eine Frau in ihren Dreißigern, die sich wegen Magenproblemen untersuchen ließ. Sie hieß Sheila, und sie war offenkundig sehr nervös und äußerst besorgt. »Ich muß einen Fastentag einlegen«, sagte sie zu mir. »Morgen früh habe ich die nächste Untersuchung.«
»Was fehlt Ihrem Magen denn?« fragte ich.
»Jedesmal, wenn ich etwas esse, bekomme ich an genau dieser Stelle hier gräßliche Schmerzen«, sagte sie und deutetet auf die Stelle.
»Und jetzt wird Ihre Gallenblase untersucht?«
»Ja. Woher wissen Sie das denn? Haben Sie das auch schon mal gehabt?« fragte sie voller Hoffnung.
»Nein. Ich weiß nur, daß dort die Gallenblase sitzt und daß man genau an dieser Stelle Schmerzen hat, wenn mit der Gallenblase etwas nicht stimmt. Aber trotzdem muß das noch lange nicht die Ursache sein«, fügte ich eilig hinzu.
»Ich weiß«, sagte sie betrübt. »Es könnte auch etwas anderes sein. Es könnte etwas weitaus Ernsteres sein.«
»Regen Sie sich nicht unnötig auf. Warten Sie erst einmal sämtliche Untersuchungsergebnisse ab. Meistens malen wir uns die Dinge schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit sind«, sagte ich zu ihr. Ich hatte gehört, wie unser Hausarzt diese Worte zu Mommy gesagt hatte, als Pierre und Jean damals gleichzeitig einen bösen Keuchhusten gehabt hatten. Sheila lächelte, und ich schüttelte ihr Bettzeug auf und sorgte dafür, daß sie es bequemer hatte.
Als ich mich umdrehte, um mich auf den Weg in das nächste Zimmer zu machen, sah ich Dr. Weller in der Tür stehen und breit grinsen. Er trat in den Korridor zurück, als ich den Wagen zur Tür hinausschob.
»Ich habe jedes Wort gehört, das du gesagt hast.« Er beugte sich zu mir vor. »Wenn Mrs. Winthrop hört, daß du Patienten medizinische Ratschläge erteilst, schickt sie dich auf der Stelle nach Hause.«
»Ich habe doch gar keine ...«
»Du wolltest sie glauben machen, es könnte ihre Gallenblase sein. Du solltest dich schämen«, sagte er und drohte mir scherzhaft mit dem Finger. Dann lachte er. »Es ist schon in Ordnung. Es könnte sehr gut sein, daß du recht hast. Im Grunde genommen«, sagte er und lehnte sich mit verschränkten Armen an die Wand, »war es eine kluge Entscheidung von dir, in deinen Sommerferien in einem Krankenhaus zu arbeiten. Allein schon dadurch, daß du dich hier rumtreibst und gut zuhörst, kannst du eine ganze Menge lernen.«
»Genau das habe ich mir auch gedacht«, sagte ich.
»Weißt du, ich lerne schließlich selbst mehrere Stunden täglich. Ich werde hier von Dr. Bardot ausgebildet. Er stellt mich ständig auf die Probe.« Er lächelte. »Ich wette, du kannst mir helfen«, sagte er mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck und nickte.
»Ich? Wie denn das?«
»Du könntest gemeinsam mit mir lernen. Du weißt schon, den Stoff mit mir durchgehen und mich abfragen. Oder bist du zu sehr mit gesellschaftlichen Verpflichtungen eingedeckt?« fragte er mich.
»Gesellschaftliche Verpflichtungen?«
»Gibt es vielleicht auch noch bei einem Freund eine Stechuhr?«
»Oh. Nein, nicht mehr«, sagte ich.
»Das ist gut. Dann kannst du dir ja vielleicht manchmal etwas Zeit für mich nehmen. Ich verspreche dir, daß du dabei auch eine ganze Menge lernen wirst«, fügte er hinzu. »Und damit meine ich nicht nur medizinische Kenntnisse. Ich kann dir ganz genau sagen, was auf dich zukommt und wie du dich am besten auf Bewerbungen vorbereitest. Verstehst du, es wird in diesem Land zunehmend schwerer, einen Studienplatz an einer Universität mit einer guten medizinischen Fakultät zu bekommen. Es laufen eine ganze Menge Kandidaten rum, die ausgezeichnete Noten mitbringen und sich alle um dieselben Plätze bewerben«, warnte er mich.
Ich dachte einen Moment lang nach. Soviel wie möglich über diese Dinge zu erfahren und mir Wissen anzueignen war schließlich der Grund dafür gewesen, daß ich hier arbeiten wollte.
»Einverstanden«, sagte ich. »Lernen sie während Ihrer Pausen?«
»Oh, nein. Das werden wir erst nach der Arbeit tun. Ich wohne nicht weit von hier. Ich habe eine kleine Wohnung in der Nähe der Tulane University. Dort besuche ich Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Wirst du auch dort studieren?«
»Das kann schon sein«, sagte ich.
»Gut. Von mir kannst du alle Tricks lernen. Wann hast du morgen deine Schicht? Zur selben Zeit wie heute?«
»Ja.«
»Ich höre etwa um dieselbe Uhrzeit auf. Dann können wir gleich danach einen Anfang machen – das heißt, wenn es dir recht ist«, sagte er.
Ich zögerte. Mir gefiel die Vorstellung, mit einem Praktikanten zusammenzuarbeiten, aber warum hatte er sich ausgerechnet mich ausgesucht, und noch dazu so schnell? »Würden Sie nicht lieber mit jemandem zusammen lernen, der selbst schon Medizin studiert?« fragte ich.
»Die wollen nur das lernen, was sie unbedingt lernen müssen.« Er lächelte mich wieder an. »He, ich werde dich schon nicht beißen, und selbst, wenn ich es täte, würde ich die Wunde behandeln«, fügte er hinzu und lachte. »Aber wenn dir bei der Vorstellung nicht wohl zumute ist oder ...«
»Nein, es ist schon in Ordnung.«
»Prima. Und mach dir keine Sorgen, wie du hinterher nach Hause kommst. Darum werde ich mich schon kümmern. Ich kann dir sogar etwas zum Abendessen kochen, wenn du willst. Natürlich nichts besonders Raffiniertes. Noch lebe ich nicht vom Gehalt eines Arztes. Es ist nun einmal eine Tatsache, und das solltest du am besten gleich wissen, daß man als Praktikant in einem Krankenhaus von den Ärzten versklavt wird. Aber man muß wohl im Leben für alles einen Preis zahlen. Bis später.« Er zwinkerte mir zu und ging.
Ich fragte mich, ob ich zu vorschnell eingewilligt hatte, ihm zu helfen. Er hatte das Vorklinikum bereits hinter sich. Wahrscheinlich würde ich jede zweite Frage nicht verstehen. Gewiß würde ich nur seine und auch meine eigene Zeit damit vergeuden, dachte ich, aber dann dachte ich mir: Das sollte er selbst am besten wissen, und trotzdem will er, daß ich ihm dabei helfe.
»Das ist nicht gerade der geeignete Ort für Tagträume«, hörte ich jemanden sagen. Mrs. Crandle stand in der Tür des nächsten Zimmers.
»Oh, es tut mir wirklich leid«, sagte ich und setzte mich eilig wieder in Bewegung.
Sophie hatte nicht übertrieben, was die Probleme anging, auf die wir als Schwesternhelferinnen stoßen konnten. Ein älterer Mann in Zimmer zweihundertfünf hatte ins Bett gemacht, und ich mußte es wieder sauber machen. Ehe ich damit fertig war, hatte ich bestimmt an die hundertmal geschluckt und eine Stunde lang immer wieder den Atem angehalten. Mrs. Crandle verlangte von mir, auch das Bettgestell zu säubern und den Fußboden um das Bett herum zu schrubben.
Sophie und ich mußten in die Waschküche runterlaufen und frisches Bettzeug holen. Ich leerte ein halbes Dutzend Bettpfannen und putzte Badezimmer. Ich glaubte schon, mein erster Tag im Krankenhaus würde relativ ereignislos verlaufen und man würde mir Arbeiten von der Sorte zuweisen, wie ich sie erwartet hatte, doch kurz vor Ablauf meiner Schicht bekam Mrs. Conti, die ältere Frau in Zimmer zweihundert, einen Herzanfall. Mrs. Crandle rief sofort einen Arzt, und Dr. Weller kam durch den Korridor gerannt. Ich beobachtete, wie sie einen Defibrillator ins Zimmer rollten. Ein weiterer Arzt kam aus der kardiologischen Abteilung im zweiten Stock hinzugeeilt. Sie mühten sich ab und taten, was sie konnten, aber Mrs. Contis Herz war stehen geblieben und ließ sich nicht wieder in Gang setzen.
Mrs. Brennen, ihre Zimmergenossin, schrie hysterisch, und sie mußten ihr Beruhigungsspritzen geben. Sämtliche Gesichter waren von Trauer umflort. Mrs. Conti hatte geschlummert, als ich ihr den Saft gebracht hatte, und sie hatte nur kurz die Augen aufgeschlagen, als ich zurückgekommen war, um ihren Wasserkrug nachzufüllen und zu sehen, ob sie sonst noch etwas brauchte. Ich hatte ihren Herzmonitor gesehen und gehört, und Mrs. Brennen hatte mir erzählt, Mrs. Conti hätte zehn Tage lang oben in der kardiologischen Station gelegen, ehe sie in den ersten Stock verlegt worden war.
»Warum hat man sie eine Station tiefer verlegt und sie nicht bei den Kardiologen gelassen?« flüsterte ich Dr. Weller zu, als er aus dem Zimmer kam, nachdem sie die Bemühungen, die Patientin wiederzubeleben, aufgegeben hatten.
»Sie haben sie vor zwei Tagen hierher verlegt, weil sie gute Fortschritte gemacht hatte und ihr Bett für eine andere Patientin gebraucht wurde.« Er zuckte die Achseln. »Sowas läßt sich nicht immer voraussagen«, sagte er, und dann lächelte er mich provozierend an. »Willst du immer noch Ärztin werden?«
Ich sah noch einmal in das Zimmer, in dem die Tote noch lag. Ihre Familie wußte noch nichts von ihrem Ableben, aber ich war sicher, daß man sie bald vermissen und um sie trauern würde. Als ich mir die betrübten Kinder und Enkelkinder vorstellte, spürte ich, daß ich vor Wut zu sieden begann. Wenn ich ihre Ärztin gewesen wäre, wäre sie nicht aus der kardiologischen Abteilung verlegt worden.
»Mehr denn je«, erwiderte ich.
Er warf den Kopf zurück und lachte. »Vielleicht ist es dir wirklich ernst damit. Ich habe das Gefühl, in dir habe ich genau die richtige Studienhelferin gefunden.« Er warf noch einen letzten Blick in das Zimmer und seufzte. »Und jetzt muß ich die Büroarbeiten erledigen«, sagte er. »Das gehört nun mal dazu, wenn man Arzt werden will, und auch du wirst diese Arbeit schon sehr bald hassen lernen.«
Vielleicht war ich naiv, aber ich glaubte, es gäbe keinen Aspekt des Medizinerberufs, den ich jemals hassen würde.
Obwohl ich eigentlich gar nicht allzuviel getan hatte, fühlte ich mich erschöpft, als meine Schicht endete. Der größte Teil meiner Erschöpfung rührte daher, daß ich meinen ersten Arbeitstag voller Anspannung angetreten hatte, und dazu kam noch die emotionale Belastung, die es mit sich bringt, einen Menschen sterben zu sehen. Ich zog mir meine Straßenkleidung wieder an und machte mich gemeinsam mit Sophie auf den Weg. Wir betraten beide Mrs. Morgans Büro, um unsere Karten in die Stechuhr zu stecken.
»Wie hat es geklappt?« fragte sie und sah Sophie an.
»Sie hat sich gut gehalten, richtig gut«, sagte Sophie eilig. »Sie hat sich kein einziges Mal übergeben.«
Mrs. Morgan lächelte. »Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Hier hast du deine reguläre Karte. Schieb sie in die Stechuhr, wenn du deine Schicht beginnst, und schieb sie wieder rein, wenn deine Schicht beendet ist, und vergiß nicht, dir weiße Schuhe zu kaufen«, rief sie mir noch einmal ins Gedächtnis zurück.
»Ja, Ma’am.«
Sophie und ich verließen das Krankenhaus. Die Luftfeuchtigkeit war unvermindert hoch, doch die Sonne stand inzwischen so tief am Himmel, daß die Temperaturen ein wenig gesunken waren.
»Meine Mutter sagt, ich sollte froh darüber sein, daß ich in einem Krankenhaus mit Klimaanlage arbeite«, sagte Sophie, als wir die Auffahrt hinunterliefen.
»Was tut deine Mutter?«
»Sie ist Wäscherin.«
»Und dein Vater?«
»Er arbeitet im Französischen Viertel. Er ist Koch. Ich habe zwei jüngere Schwestern, die noch in die Schule gehen, und einen Bruder, der beim Militär ist. Und was ist mit dir?«
»Ich habe Zwillingsbrüder, die zwölf Jahre alt sind. Wo wohnst du, Sophie?«
»Auf der anderen Seite des Französischen Viertels. Ich nehme die Straßenbahn zur Canal Street.«
Wir warteten gemeinsam auf die Straßenbahn.«
»Wie lange arbeitest du schon im Krankenhaus?« fragte ich sie.
»Etwas mehr als ein Jahr.«
»Willst du denn nicht wieder in die Schule gehen? Du könntest dort noch soviel lernen«, sagte ich.
Sie schlug eilig die Augen nieder. »Das geht nicht«, sagte sie. »Ich muß arbeiten.«
»Warum? Verdient dein Vater denn als Koch nicht genug Geld?« Ich wußte, daß gute Köche im Französischen Viertel hoch geschätzt und gut bezahlt wurden.
Sophie zuckte die Achseln. »Vielleicht«, sagte sie. »Mit Sicherheit wissen wir es nicht.«
»Wieso denn das?«
»Er lebt nicht bei uns«, berichtete sie mir in dem Moment, in dem die Straßenbahn an unserer Haltestelle anhielt. Sophie stieg eilig ein, und ich setzte mich neben sie. Wir schauten beide zum Fenster hinaus, als die Straßenbahn sich klappernd auf ihren Schienen in Bewegung setzte. »Er kommt nicht mal mehr zwischendurch zu uns nach Hause«, fuhr Sophie fort. »Ab und zu läßt er uns etwas Geld zukommen. Wenn ich ihn sehen will, dann muß ich in das Restaurant gehen, aber er hat nie viel Zeit für mich.«
»Das tut mir sehr leid für dich«, sagte ich. Als die Straßenbahn auf meine Haltestelle zufuhr und ich aufstand, schien Sophie tief beeindruckt zu sein.
»Du wohnst im Garden District?«
»Mhm.«
»Hier bin ich noch nie gewesen«, sagte sie.
»Vielleicht kannst du eines Tages bei uns zu Abend essen«, schlug ich vor.
»Wirklich?« Ihr Lächeln verblaßte. »Meistens muß ich nach der Arbeit gleich nach Hause, weil ich Mama helfen muß.«
»Vielleicht klappt es ja eines Tages trotzdem«, munterte ich sie auf. »Wir sehen uns dann morgen wieder. Danke für deine Hilfe, mich am ersten Tag zurechtzufinden. Tschüß.«
»Tschüß«, rief sie mir nach.
Als ich nach Hause kam, wollten alle hören, wie mein erster Arbeitstag verlaufen war. Die Zwillinge schnitten Grimassen und stöhnten, als ich einige der Reinigungsarbeiten schilderte, die mir aufgetragen worden waren, aber als ich ihnen von Mrs. Contis Tod berichtete, leuchteten ihre Augen vor brennendem Interesse.
»Du hast eine Tote gesehen?« fragte Pierre.
»Ja.«
»Hast du sie angefaßt?« sagte Jean.
»Nein.«
»Hat sie gestunken?«
»Ich finde, wir sollten das Thema wechseln und erst nach dem Abendessen wieder darauf zurückkommen«, sagte Daddy. »Meinst du nicht auch, Pearl?«
»Doch, Daddy.«
Ich erzählte ihnen von Sophie, doch die Zwillinge interessierten sich für nichts anderes mehr als für Mrs. Contis Tod. Als ich Daddy von Dr. Weller erzählte, lehnte er sich zurück und sah Mommy an.
»Er hat dich gerade erst kennengelernt und will dich jetzt schon zum Abendessen einladen?« fragte sie mich.
»Vermutlich liegt es einfach nur daran, daß wir erst nach der Arbeit gemeinsam studieren werden. Warum?«
Daddy schien besorgt zu sein.
»Ich bin sicher, daß er einfach nur von Pearl beeindruckt ist, und da sie außerdem noch Interesse an Medizin gezeigt hat ...«, sagte Mommy.
Daddy dachte einen Moment lang nach und schien dann ruhiger zu werden. »Vermutlich hast du recht, Ruby. Im allgemeinen hast du recht, wenn es um Menschen geht. Deine Mutter wird in zwei Wochen wieder eine Ausstellung eröffnen«, fügte er stolz hinzu. »Und dein Bild wird unter den ausgestellten Gemälden sein.«
»Das ist ja wunderbar, Mommy.«
Wir redeten über Mommys Kunst, und nach der Crème brûlée, die zum Dessert serviert wurde, ging Daddy mit mir los, um Schuhe mit weichen Sohlen für mich zu kaufen, und Mommy begab sich in ihr Atelier, um zu arbeiten.
»Nun«, sagte Daddy zu mir, als wir im Wagen saßen, »was meinst du jetzt, nachdem du dir all das mit eigenen Augen angesehen hast?«
»Ich glaube, daß ich mehr denn je Ärztin werden möchte, Daddy.« Er nickte. »Was hat dich in Wirklichkeit von deinem Medizinstudium abgebracht, Daddy?« fragte ich ihn noch einmal. Ich wußte, daß seine Familie das Geld hatte, ihm ein Medizinstudium zu finanzieren, und ich wußte auch, daß er ein sehr guter Student gewesen war.
»Meine Familie war wütend auf mich, vor allem, nachdem ich deine Mutter geschwängert hatte. Ich war selbst sehr wütend auf mich, weil ich Ruby im Stich gelassen hatte, und eine Zeitlang habe ich mich selbstzerstörerisch gebärdet. Ich habe enorm viel getrunken, als ich in Europa war, und ich habe meine Zeit und mein Talent vergeudet. Und dann...«
Er hielt inne, und ich konnte ihm ansehen, daß er sich seinen Erinnerungen hingab. »Und dann habe ich gehört, daß Ruby Paul geheiratet hat. Ich habe in Selbstmitleid geschwelgt, Kurse versäumt und meine Zeit vertrödelt. Und eines Morgens hat dann plötzlich jemand an meine Wohnungstür geklopft. Als ich geöffnet habe, stand deine Tante Gisselle vor mir. Im ersten Moment habe ich sie für Ruby gehalten. Ihre Gesichter waren so unglaublich ähnlich. Ich habe mir gestattet, mich meinen Phantasien hinzugeben, und deine Tante Gisselle hat meine Illusionen angespornt. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Gisselle und ich haben geheiratet, und ich bin zurückgekommen, um in der Firma meiner Familie zu arbeiten.
Deshalb freut es mich so sehr, daß du die Laufbahn einschlagen willst, von der ich abgekommen bin«, sagte er, und Tränen brannten hinter seinen Lidern, als er sich zu mir umwandte. »Ich weiß, daß du eine wundervolle Ärztin werden wirst, Pearl.«
»Ich werde es versuchen, Daddy«, sagte ich. Mein Herz schmerzte, und meine Kehle schnürte sich zu, als ich die Tränen schluckte. »Ich werde mich wirklich bemühen.«
Nachdem wir nach Hause zurückgekehrt waren, flehten die Zwillinge mich an, ihnen mehr über Mrs. Conti zu erzählen. Sie wollten ganz genau wissen, wie es war, eine Leiche zu sehen. Schließlich holte ich dann einige meiner Anatomiebücher heraus und ließ sie die Bilder ansehen. Es faszinierte sie, wie ihr eigener Körper von innen aussah, aber Jean war auch ein wenig fassungslos.
»Ich bin wirklich froh, daß wir Haut haben, die all das verbirgt«, bemerkte er. »Damit ich es nicht ständig selbst sehen muß.«
Pierre lachte, doch ich schloß die Bücher und hielt den beiden einen Vortrag darüber, wie wunderbar der menschliche Körper doch war. »Der menschliche Körper ist eine der vollkommensten Schöpfungen im ganzen Universum«, erklärte ich ihnen.
»Wenn der menschliche Körper so vollkommen ist, warum werden wir dann krank?« fragte Jean.
»Er ist vollkommen, aber nicht unanfällig«, sagte ich.
In seiner Verwirrung schnitt Jean eine Grimasse.
»Sie meint, du kannst nicht verhindern, daß Bakterien in deine Nase oder in deinen Mund fliegen«, sagte Pierre. »Es sei denn, du läufst mit Stöpseln in der Nase und mit Klebeband auf dem Mund durch die Gegend. Aber dann könnten sie immer noch durch deine Ohren reinkommen, stimmt’s, Pearl?«
»Dann stecken wir uns eben auch was in die Ohren«, sagte Jean.
»Dann kannst du aber nichts mehr hören.«
»Dann werden wir also immer wieder krank werden«, schloß Jean betrübt.
»Aber gerade deshalb brauchen wir ja Ärzte, stimmt’s, Pearl?« fragte Pierre.
Ich lächelte. »Ja, Pierre, das ist wahr.«
»Konnten die Ärzte denn nichts dagegen tun, daß Mrs. Conti stirbt?« fragte Jean.
»Sie war alt. Ihr Körper war müde.«
»Sie war abgenutzt, wie unsere Dreiräder«, erklärte Pierre.
Jean nickte, doch dann strahlte er plötzlich über das ganze Gesicht. »Und wir werden später einmal eine Ärztin haben, die bei uns im Haus lebt und uns alle davor bewahrt, daß wir ständig krank werden. Wir haben schließlich Pearl.«
Ich lachte. »Bis dahin wird noch einige Zeit vergehen, Jean.« »Und bis dahin wird sie nicht mehr bei uns wohnen. Sie wird erwachsen werden und heiraten und ihre eigenen Kinder haben«, erklärte Pierre.
Jeans Lächeln verflog.
»Aber ich verspreche euch, daß ich mich immer um euch beide kümmern werde«, sagte ich und zauberte mit diesen Worten wieder das Strahlen auf Jeans Gesicht. »Und jetzt geht nach oben und macht euch fertig zum Schlafengehen. Jeder Mensch, und vor allem junge Menschen, die jeden Tag einen halben Meter wachsen, braucht Ruhe.«
»Oh ...«
»Andernfalls verschrumpeln nämlich diese Organe in deinem Körper«, drohte Pierre. Jeans Augen wurden groß, und er sah mich fragend an.
»Nein, das tun sie nicht«, versicherte ich ihm. »Aber jetzt geht ins Bett.«
Die beiden sprangen auf.
»Gute Nacht, Pearl«, sagte Pierre.
»Gute Nacht, Pearl.« Jean lächelte schelmisch. »Ich hoffe, du wirst keine Alpträume haben, in denen Mrs. Conti vorkommt.«
Pierre zog ihn zur Tür hinaus, und die beiden sprangen lachend die Treppe hinauf.
Es dauerte nicht allzu lange, bis ich mich ebenfalls ins Bett legte. Ich war gerade unter meine Decke gekrochen, als das Telefon läutete. Es war Catherine. Seit dem Abend nach der Abschlußfeier hatten wir nicht mehr miteinander geredet. Ich hörte eine Art Förmlichkeit aus ihrer Stimme heraus. Von der Warmherzigkeit und der Offenheit unserer früheren Beziehung war keine Spur geblieben.
»Hast du schon angefangen, im Krankenhaus zu arbeiten?« fragte sie.
»Ja, heute.«
»Wie ist es gelaufen?« fragte sie ohne echtes Interesse.
»Ich glaube, ich kann dort eine Menge lernen«, sagte ich. »Ein Praktikant hat mich aufgefordert, ihm beim Lernen zu helfen.«
»Ach? Wie sieht er aus?«
»Das ist vollkommen belanglos. Er will einfach nur jemanden, der ihm dabei hilft, seinen Verstand zu schärfen und seine Kenntnisse zu vertiefen. Ein Praktikant ist in Wirklichkeit noch ein Student. Für mich ist das eine großartige Chance.«
»Wie schön für dich.« Nach einem Moment sagte sie: »Es sind immer noch alle stinksauer auf dich, weil du nicht zu Lester gekommen bist. Sie halten dich für einen Snob.«
»Ich kandidiere schließlich nicht für ein politisches Amt«, sagte ich trocken.
»Du solltest nicht vergessen, wer deine wahren Freunde sind«, sagte sie. »Selbst dann nicht, wenn du das klügste Mädchen in der ganzen Schule bist.«
»Ich vergesse sie niemals, aber wie ich bereits sagte, sind wahre Freunde dazu da, sich gegenseitig zu helfen und füreinander einzuspringen.«
»Jedem wird mal ein Streich gespielt, Pearl. Findest du nicht, daß deine Reaktion übertrieben war?«
»Nein.«
Einen Moment lang schwieg sie, und dann beschloß sie, schwerere Geschütze aufzufahren. »Claude hat mit Diane seinen Spaß gehabt. Sie haben sich in eines der Gästezimmer zurückgezogen und sind erst am nächsten Morgen wieder rausgekommen. Seitdem treffen sie sich regelmäßig miteinander.«
»Dann hat es vielleicht so kommen sollen«, sagte ich.
Catherine seufzte frustriert. »Ich schwöre dir, ich kenne niemanden, der es einem schwerer macht, mit ihm befreundet zu sein«, schloß sie.
Im ersten Moment war ich sprachlos. Sollte sie etwa recht haben? Die Dinge, für die sich die meisten Mädchen in meinem Alter interessierten, schienen mir nicht besonders wichtig zu sein. War das ein Fluch oder ein Segen?
»Jedenfalls fahren wir in die Sommerferien. In den nächsten drei Wochen werden wir einander nicht sehen. Ich nehme an, das ist dir egal.«
»Ich habe gesagt, daß ich enttäuscht darüber war, was passiert ist und was du getan hast, Catherine, aber ich hoffe, du wirst meinen Standpunkt früher oder später begreifen, und wir werden weiterhin Freundinnen sein.«
»Und ich hoffe, daß der Rettungsschwimmer, den ich letztes Jahr kennengelernt habe, wieder denselben Job am Strand hat. Letztes Jahr fand er nämlich noch, ich sei zu jung für ihn, aber vielleicht ändert er dieses Jahr seine Meinung.«
»Wie alt war er?«
»Dreiundzwanzig. Ich weiß schon, du findest, er sei zu alt für mich«, fügte sie eilig hinzu.
»Nein. Das ist nicht zu alt für dich.«
»Wirklich nicht? Ich finde auch nicht, daß er zu alt für mich ist.« Sie senkte die Stimme. »Aber meine Eltern wären gar nicht froh darüber. Wie würden sich deine Eltern dazu stellen?«
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Ich nehme an, wenn wir uns wirklich etwas auseinander machen würden, würden sie keine größeren Einwände erheben.«
»Deine Mutter ist ja so verständnisvoll. Tja, vielleicht schreibe ich dir eine Postkarte.«
»Tu das, Catherine.«
»Verabreiche bloß niemandem die falschen Pillen«, warnte sie mich.
»Ich darf keine Medikamente verabreichen. Ich bin bloß Schwesternhelferin.«
»Dann laß eben niemandem die falsche Hilfe zukommen«, sagte sie und lachte. »Hör mal. Es tut mir leid. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sind die Mädchen wirklich zu weit gegangen und ich hätte es dir auf der Stelle sagen sollen, aber andererseits wollte ich nicht auch von allen anderen gehaßt werden.«
»Auch?«
»Du weißt schon, was ich meine. Jedenfalls habe ich gesagt, daß es mir leid tut.«
»In Ordnung. Danke. Viel Spaß.«
»Den werde ich bestimmt haben«, versicherte sie mir, und wir legten auf. Einen Moment lang saß ich da und dachte nach. Irgendwo in meinem Hinterkopf hörte ich die Stimme eines kleinen Mädchens, das sich an seine Kindheit klammern wollte und versuchte, mich davon abzubringen, allzu ernst zu sein. Doch diese Stimme zog sich immer weiter zurück, wurde immer leiser und war kaum noch vernehmbar.
Ob es mir nun paßte oder nicht – ich war jetzt dabei, mit einem Kopfsprung in die Welt der Erwachsenen einzutauchen. Und mir blieb gar nichts anderes übrig, als mich auf dieses Abenteuer einzulassen und es in vollen Zügen auszukosten.
Nachdem Catherine und ich miteinander gesprochen hatten, dauerte es nicht lange, bis ich einschlief, aber ich hatte tatsächlich einen Alptraum, in dem Mrs. Conti vorkam. Ich sah, wie sie die Augen aufschlug, als ich in ihr Zimmer zurückkehrte, und diese Augen waren glasig und milchig weiß. Dann dachte ich an Dr. Weller und sein verschmitztes Lächeln. »Willst du immer noch Ärztin werden?« hatte er
mich herausfordernd gefragt.
»Mehr denn je.«
Ich murmelte im Schlaf vor mich hin.
»Mehr denn je.«