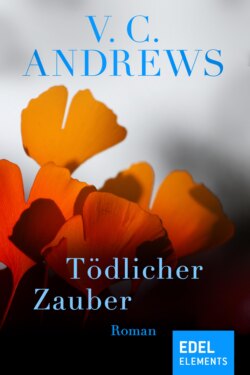Читать книгу Tödlicher Zauber - V.C. Andrews - Страница 7
2.
Denk einfach nur an schöne Dinge
ОглавлениеEhe ich mich auf den Weg zur Schule machte, um dort an der offiziellen Abschiedsfeier teilzunehmen, war Mommy in mein Zimmer gekommen und hatte mir dabei geholfen, das Kleid auszuwählen, das ich auf meiner Party tragen würde. Wir steckten meine Frisur auf, und sie erzählte mir noch ein wenig mehr von ihrer Schulzeit im Bayou und von ihrer eigenen Abschlußfeier. Mommy und Gisselle hatten im letzten Schuljahr eine Privatschule in Baton Rouge besucht, doch nach Mommys Schilderungen zu urteilen war das eine unerfreuliche Erfahrung gewesen, abgesehen von ihrem Kunstunterricht und ihrer Bekanntschaft mit Louis Clairborne, einem berühmten Musiker, der gelegentlich in New Orleans Klavierabende gab und immer zum Abendessen zu uns nach Hause kam, wenn er sich in der Stadt aufhielt. Jedesmal, wenn er in unser Haus kam, brachte er den Zwillingen und mir etwas ganz Besonderes von einer seiner Europatourneen mit. Ich besaß Puppen und Spieldosen aus Frankreich und Holland.
»Tja, Mommy«, sagte ich, als Aubrey kam, um mir zu sagen, daß Claude eingetroffen war, um mich abzuholen, »jetzt ist es also soweit.« Darauf ließ ich einen leisen wimmernden Laut folgen.
»Hör auf, dir Sorgen zu machen«, sagte sie und umarmte mich. Als ich gerade zur Tür hinausgehen wollte, rief sie mir nach: »Warte noch.«
Ich drehte mich um und sah, wie sie auf dem Stuhl vor der Frisierkommode saß und sich vorbeugte, um ihren Glücksbringer abzunehmen, das Zehncentstück, das sie sich um den Knöchel gebunden hatte.
»Eigentlich wollte ich dir das geben, ehe du am Ende des Sommers ins College aufbrichst, aber ich möchte, daß du es jetzt schon hast, Pearl.«
»Oh, nein, Mommy. Das ist dein Glücksbringer. Dieses Geschenk kann ich unmöglich annehmen.«
»Natürlich kannst du das. Ich kann diesen Glücksbringer an dich weitergeben.«
»Aber dann hast du ihn nicht mehr«, warnte ich sie.
»Es ist an der Zeit für dich, ihn zu übernehmen, Pearl. Bitte, nimm ihn an«, flehte sie. »Es würde mir sehr viel bedeuten.« »Ich weiß, welches Verhältnis du zu diesem speziellen Zehncentstück hast, Mommy«, sagte ich kopfschüttelnd, trat aber dennoch vor, um das Amulett entgegenzunehmen.
»Setz dich, damit ich es dir um den Knöchel binden kann«, sagte sie zu mir. Ich tat es. »So«, sagte sie und tätschelte mein Knie. »Ich weiß, daß es dir albern vorkommt, aber dieser Glücksbringer wird für dich denselben Zauber haben, den er auch für mich gehabt hat.«
»Ich finde das nicht albern, Mommy, aber was ist mit dir? Wenn ich ihn trage, trägst du ihn nicht mehr.«
»Ich habe mehr Glück gehabt, als einem normalen Mensch zusteht. Sieh dir nur diese wunderbare Familie an, die ich habe, und den Erfolg, den ich mit meiner Kunst gehabt habe. Und jetzt lebe ich dafür zu sehen, daß sich dir und den Jungen genauso viele Gelegenheiten bieten und daß ihr euch daran erfreut.«
»Ich danke dir, Mommy.«
»Aber erzähl es deinem Vater bloß nicht gleich«, warnte sie mich und warf dabei einen Blick auf die offene Tür. »Er glaubt, ich würde mich von dem althergebrachten Glauben zu sehr mitreißen lassen, und er wird mich nur dafür ausschimpfen, daß ich dir diese Vorstellungen aufdränge.«
Mommy und ich hielten nie ernstzunehmende Dinge vor Daddy geheim, aber es gab ein paar Kleinigkeiten, von denen wir ihm nichts erzählten.
»Wir können es ihm hinterher immer noch erzählen«, fügte sie hinzu.
»Abgemacht, Mommy.« Wir umarmten einander noch einmal, und dann verschwand ich. Claude wartete draußen bei seinem Wagen und lief ungeduldig auf und ab.
»Hallo«, rief ich ihm zu und eilte die Stufen hinunter. Er kam auf mich zu, um mich zu küssen. In der letzten Zeit steckte er mir jedesmal die Zunge in den Mund. Diesmal beließ er es nicht nur dabei, sondern preßte mich so eng an sich, daß ich mich gewaltsam losreißen mußte.
»Bitte, Claude. Wir stehen direkt vor dem Haus meiner Eltern!«
Er tat diesen Verweis mit einem Achselzucken ab, als hätte sich ein Moskito auf seine Schulter gesetzt.
»Jedenfalls ist endlich der Tag gekommen. Unsere Freilassung aus dem Gefängnis«, verkündete er.
»Hast du die Schule etwa als ein Gefängnis angesehen, Claude?«
»He, von jetzt an werden uns die Erwachsenen weniger streng über die Schulter blicken. Für mich ist das eine Befreiung, und heute nacht«, sagte er lächelnd, »hauen wir endlich mal so richtig auf die Pauke, stimmt’s?« Er versuchte wieder, mich zu küssen.
»Ja, vermutlich schon«, sagte ich und entfernte mich von ihm, um in den Wagen einzusteigen. Claudes Überschwang erschreckte mich ein wenig. Er wirkte auf mich wie ein junger Mann, der bereit ist, durch geschlossene Türen zu gehen.
»Schau nicht so traurig«, sagte er. Er hielt mir die Wagentür auf, und ich stieg eilig ein.
»Es werden außer uns nur wenige Leute heute abend zu Lester kommen«, eröffnete er mir, nachdem er sich neben mich gesetzt hatte. »Keine Lahmärsche. Und es wird nicht etwa nur reichlich zu trinken geben«, fügte er zwinkernd hinzu.
»Nicht nur reichlich zu trinken? Wie meinst du das?«
»Du weißt schon.« Er zwinkerte mir wieder zu.
»Du weißt genau, daß ich nicht mag, wenn du das tust, und du weißt ebenso gut, daß ich es nicht mitmache«, sagte ich entschieden. Diese Diskussion führten wir nicht zum ersten Mal miteinander. Claudes Lächeln schwand.
»Sei nicht so verklemmt. Schließlich feierst du deinen Schulabschluß nur ein einziges Mal im Leben«, sagte er.
Ich preßte die Lippen zusammen und hielt die Worte zurück, die mit Sicherheit einen Streit ausgelöst hätten. Im Moment beschäftigten mich nämlich wichtigere Dinge – allem voran meine Rede.
Als wir in der Schule eintrafen, herrschte bereits große Aufregung. Ich schloß mich im Vorraum der Mädchentoiletten Catherine und einigen unserer Freundinnen an, die ein letztes Mal ihr Aussehen überprüfen wollten. Mädchen borgten sich Lippenstifte aus, sprühten sich mit Parfum ein und puderten sich die Wangen, und viele von ihnen rauchten. Diane bot mir eine Zigarette an, und ich lehnte wie gewöhnlich ab.
»Ach, ja, richtig. Unsere kleine Ärztin will sich die Lunge nicht vergiften«, scherzte sie, und die anderen Mädchen lachten.
»Es ist wahr, Diane. Es ist eine unumstößliche Tatsache, daß allein schon das passive Mitrauchen gefährlich ist. Daß es mir schadet, hier zu stehen und euren Rauch einzuatmen, ist längst erwiesen.«
Die Mädchen um mich herum schienen einen Moment lang verdrossen zu sein.
»So was Doofes. Glaubst du etwa, du wirst ewig leben?« gab Diane zurück. Ihre Freundinnen grinsten breit.
»Nein, aber ich weiß, was es heißt, Lungenkrebs zu haben. Erfreulich ist das nicht gerade«, sagte ich mit scharfer Stimme.
»Hört euch das bloß an. Die Tugendhaftigkeit in Person. Was für eine Langweilerin. Ich kann nur hoffen, daß deine Rede nicht so deprimierend ist. Wir haben nämlich allen Grund zu feiern.« Sämtliche Mädchen sahen mich an.
»Meine Ansprache ist nicht deprimierend«, sagte ich zu meiner Verteidigung. »Entschuldigt mich bitte für einen Moment«, sagte ich dann. »Ich muß auf die Toilette.«
Gelächter folgte mir in die Kabine. Ich hörte, wie plötzlich alle verstummten und im Gänsemarsch den Vorraum verließen. Als ich herauskam, war niemand mehr da. Trotz meiner Bestürzung war ich froh darüber, daß ich keine weiteren Auseinandersetzungen zu führen hatte, und ich machte mich ebenfalls auf den Weg. Erst, als ich in das Kleid geschlüpft war, das ich für die offizielle Abschlußfeier tragen würde, und mein Barett aufgesetzt hatte, bemerkte ich, daß ich meine Rede offensichtlich in der Toilette liegengelassen hatte. In heller Aufregung rannte ich zurück, aber meine Notizen waren nicht da!
Außer mir vor Panik lief ich im Korridor auf und ab und fragte jedes einzelne Mädchen aus, doch niemand wußte etwas.
»Was ist passiert?« erkundigte sich Claude.
»Ich finde meine Rede nicht mehr. Jemand hat sie mir weggenommen, als ich auf der Toilette war«, berichtete ich ihm.
»Das ist doch nicht dein Ernst? Und was wirst du jetzt tun?« »Ich weiß es nicht.«
Ich wandte mich an Catherine. Sie machte den Eindruck, als wollte sie etwas sagen, fürchtete sich aber zu sehr. Verzweifelt sah ich mich nach allen Richtungen um. Mr. Stegman, der Lehrer, der die Aufsicht hatte, befahl mir, endlich meinen Platz einzunehmen.
»Ich kann meine Rede nicht finden!« sagte ich zu ihm. »Ich hatte sie bei mir, als ich auf die Toilette gegangen bin, aber sie ist nicht mehr dal.
»Ach, du meine Güte«, sagte er und holte Mr. Foster, den Direktor.
»Hast du dich wirklich gründlich umgesehen, Pearl? Geh noch einmal zurück und sieh nach«, schlug er vor. »Ich werde den Beginn der Festlichkeiten noch ein paar Minuten hinauszögern.«
Ich sah Catherine an.
»Die Rede muß dort sein«, sagte sie. Ein gräßlicher Gedanke drängte sich mir auf. Ich lief zu den Toiletten zurück und riß die Tür neben der Kabine auf, die ich benutzt hatte. Dort fand ich meine Rede. Sie schwamm in der Toilettenschüssel.
»Oh, nein!« schrie ich und fischte die Blätter aus dem Wasser. Zahlreiche Worte waren unleserlich. Ich trocknete die Seiten möglichst behutsam mit einem Handtuch ab, und dann nahm ich meinen Platz an der Spitze der Prozession ein.
»Hast du deine Rede gefunden?« fragte Dr. Foster.
Ich hielt die durchweichten Papiere hoch.
»Wie konnte das denn bloß passieren?«
»Ja«, sagte ich laut genug, damit es alle, die mit mir in eine Klasse gingen, hören konnte. »Wie konnte das bloß passieren?«
Mein Herz pochte so heftig, daß ich glaubte, ich würde mich mit Sicherheit vor sämtlichen Familien und allen anwesenden Gästen lächerlich machen. Ich weiß nicht, wie mich meine Beine durch den Korridor und zur Tür hinaustrugen, aber ich hatte gar keine andere Wahl.
Ich kam nicht dazu, mir große Sorgen zu machen. Wir marschierten zu der Bühne, die für die Feierlichkeiten im Freien errichtet worden war, und dort nahmen wir unsere Plätze ein. Ich bemühte mich, das Publikum nicht anzusehen. Es herrschte ein unglaublicher Lärm – Gelächter, Geplauder, schreiende Babies und Ermahnungen an Kleinkinder, endlich stillzusitzen. Ich kam mir vor wie in einem Tollhaus. Von meiner Rede würde ohnehin niemand etwas hören, dachte ich mir. Weshalb also hätte ich mir Sorgen machen sollen?
Für unsere Feier war uns ein warmer, klarer Tag beschert worden, und eine leichte Brise ließ die Fahnen wehen und blies uns Haarsträhnen über die Schultern. Weiße Wattewolken zogen über einen azurblauen Himmel. In der Ferne konnte ich das Stampfen der Dampfschiffe hören, die sich zur Abfahrt bereitmachten, um Touristen auf dem Mississippi flußaufwärts zu befördern.
Nach der Begrüßung und ein paar einleitenden Worten unseres Rektors wurde ich aufgerufen. Mit weichen Knien stand ich auf. Ich schloß die Augen, holte tief Atem, öffnete die Augen wieder und begab mich zum Mikrofon. Meine Klassenkameradinnen waren totenstill, denn alle fragten sich, was ich wohl tun würde. Ich ließ meine Blicke über das Publikum schweifen, bis ich Mommy fand, die mich voller Zuversicht ansah, und dann sprudelten die Worte einfach von selbst aus mir heraus. Ich brauchte nicht auf meine Notizen zu sehen. Die Worte waren in großen Druckbuchstaben in mein Gehirn eingraviert.
Zu meinem Erstaunen waren alle verstummt. Ich hob den Kopf, holte tief Atem und begann. Zuerst bedankte ich mich bei dem Rektor, und dann wandte ich mich an den Lehrkörper und an unsere Eltern, an die Familien und Freunde, und meine Stimme wurde kräftiger und immer kräftiger, als ich die Ansprache hielt, die ich in den allerletzten Tagen verfaßt hatte. Verblüffenderweise riß der Strom der Worte nicht ab, sowie ich erst einmal begonnen hatte. Von Zeit zu Zeit sah ich ins Publikum, schaute einzelnen Zuhörern ins Gesicht und stellte fest, daß die Leute mir tatsächlich zuhörten. Auf den meisten Gesichtern stand ein liebenswürdiges und beifälliges Lächeln. Die Zwillinge starrten mich gebannt an. Beide hatten die Münder einen Spalt weit geöffnet, und sie zappelten nicht auf ihren Sitzen herum. Als ich meinen Vortrag beendet hatte, ertönte donnernder Applaus, und als ich Mommy und Daddy ansah, strahlten beide über das ganze Gesicht. Sogar Pierre und Jean schienen beeindruckt zu sein. Genau im selben Moment hörten sie auf zu klatschen, und als ich meinen Platz wieder einnahm, warf ich einen Blick auf Claude und sah, daß er stolz lächelte und seinen Kameraden Rippenstöße versetzte, um ihren Neid zu wecken. Diane Ratner und ihre Freundinnen schienen am Boden zerstört zu sein, aber Catherine umarmte mich geschwind.
»Das hast du prima gemacht. Ich wußte, daß du es schaffst, ganz gleich, was passiert. Ich habe mir tatsächlich jedes einzelne Wort angehört, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.«
»Danke«, sagte ich trocken. Ich wollte ihr deutlich zu verstehen geben, daß ihre mangelhaften Freundschaftsbeweise mich tief enttäuscht hatten.
Ich lehnte mich zurück, als der Rektor und unsere Klassenlehrerin vortraten, um uns die Abschlußzeugnisse zu überreichen. Als ich mich erhob, um mein Zeugnis entgegenzunehmen, bedachte mich das Publikum noch einmal mit tosendem Applaus. Daddy machte Fotos, und die Zwillinge winkten und jubelten mir zu.
»Gut gemacht«, sagte der Rektor. »Viel Glück.«
Ich bedankte mich bei ihm und lächelte noch einmal meine Eltern an, damit Daddy eine weitere Aufnahme von mir machen konnte.
Nach dem Zeremoniell wurde ich mit Komplimenten für meine Rede überhäuft. All meine Lehrer kamen auf uns zu, um sich zu verabschieden und mir Glück zu wünschen, ebenso wie einige meiner Klassenkameradinnen und deren Eltern. Ich freute mich, als ich sah, daß meine Tante Jeanne – die Schwester von Mommys Halbbruder Paul – und James, ihr Ehemann, ebenfalls erschienen waren, um mir zu gratulieren. Tante Jeanne war das einzige Familienmitglied der Tates, das Umgang mit uns pflegte. Sie war zwei bis drei Zentimeter größer als Mommy und hatte dunkelbraunes Haar und mandelförmige Augen. Mommy sagte, Tante Jeanne hätte mehr Ähnlichkeit mit ihrer Mutter Gladys als mit ihrem Vater Octavius, da sie von ihrer Mutter den dunklen Teint, das spitze Kinn und die nahezu perfekte Nase geerbt hatte. Ich mochte sie, weil sie immer freundlich und nett mit uns umging und mich besonders lieb behandelte.
»Deine Rede hat mich wirklich begeistert, Pearl, meine Süße«, sagte Tante Jeanne und umarmte mich.
»Wirklich eine beachtliche Rede«, fügte Onkel James hinzu und nickte. Er drückte Daddy die Hand. »Du hast wirklich allen Grund, stolz zu sein, Beau.«
Mommy und Daddy hatten so strahlende Gesichter, daß mir Schauer über den Rücken liefen.
»Wie geht es deiner Familie, Jeanne?« fragte Mommy, und ein dunkler Schatten zog über ihr Gesicht.
»Mutter hat zusätzlich zu ihrer Arthritis jetzt auch noch die Gicht. Daddy ist vollständig unverändert. Er deckt sich mit Unmengen von Arbeit ein.« Tante Jeanne lächelte. »Die jüngste Tochter meiner Schwester Toby ist gerade sechzehn geworden. Es wird nicht lange dauern, bis ich die nächste Schulabschlußfeier besuche.«
Tante Jeanne und Onkel James hatten nie Kinder gehabt. Ich war nicht sicher, warum. Falls Mommy es wußte, dann behielt sie es für sich.
»Ihr kommt doch sicher noch mit zu uns, Jeanne?« fragte Mommy.
»Ja, natürlich. Wir hätten uns diese Party um keinen Preis entgehen lassen«, sagte sie. »Du wußtest doch, daß ich kommen würde, Ruby«, flüsterte sie, doch ich konnte ihre Worte hören. Ich sah, wie die beiden einander in die Augen blickten, und ich nahm die unausgesprochenen Worte wahr, die sie miteinander wechselten, Worte, von denen ich wußte, daß sie sich alle um Paul drehten, den Halbbruder meiner Mutter, den Mann in meinem seltsamen Traum. »Paul wäre ja so stolz auf sie gewesen«, fuhr Jeanne fort. Tränen traten in Mommys Augen, als sie nickte. Die beiden umarmten einander noch einmal.
Mommy sah sich nach den Zwillingen um, die sich damit vergnügten, sich in der dichten Menschenmenge herumzutreiben und einige meiner Freundinnen zu necken.
Ausnahmsweise war ich ihnen dankbar für ihr Benehmen. Mommy rief die Jungen zu sich. Es war an der Zeit, daß wir uns auf den Heimweg machten und die letzten Vorbereitungen für die Party trafen. Mommy schlang einen Arm um mich, und wir liefen alle zur Limousine.
»Ich bin ja so stolz auf dich«, sagte sie.
Ich wollte ihr nichts von dem Streich erzählen, den meine sogenannten Freundinnen mir im Toilettenvorraum gespielt hatten. »Ich war schrecklich nervös. Hat man mir das nicht angemerkt?«
»Kein bißchen. Ich habe dir doch gesagt, daß dir die Worte wie von selbst über die Lippen kommen werden, wenn du erst einmal angefangen hast. Und genauso war es auch«, sagte Mommy.
In der Limousine zogen mich die Zwillinge damit auf, wie ich nach bestimmten Formulierungen ins Publikum gesehen hatte, doch Mommy schalt sie dafür aus, und sie unterdrückten ihr Kichern. Jetzt war mir nicht mehr flau im Magen. Ganz im Gegenteil, ich fühlte mich restlos ausgehungert und konnte es kaum erwarten, etwas zu essen. Ich war so nervös gewesen, daß ich den ganzen Tag über kaum einen Bissen zu mir genommen hatte.
Als wir zu Hause ankamen, waren einige unserer Gäste bereits eingetroffen, und die Musiker spielten schon. Es herrschte eine festliche Atmosphäre. Ich eilte nach oben, um mein Partykleid anzuziehen und meine Frisur in Ordnung zu bringen. Als ich die Treppe herunterkam, waren weitere Gäste eingetroffen, und alle brachten mir Geschenke mit. In einem der Wohnzimmer war eine Ecke für die Geschenke freigeräumt worden, und die Zwillinge konnten diesen Berg, der immer größer wurde, einfach nicht aus den Augen lassen. Um ihre Neugier zu befriedigen, rissen sie das Geschenkpapier auf. Mommy ermahnte sie, sich von meinen Geschenken fernzuhalten, und sie liefen los, um mit ihren Freunden zu spielen.
Eine Heerschar von Bediensteten begann, warme und kalte Vorspeisen und Champagner zu servieren. Daddys Geschäftsfreunde versammelten sich im Ballsaal, und Mommy begrüßte einige der bedeutenden Mitglieder der Künstlergemeinde, darunter andere Künstler und Galeriebesitzer. Alles, was in der guten Gesellschaft Rang und Namen hatte, war hier versammelt.
Mein Porträt stand verhüllt auf einer Staffelei, gleich neben der Torte, die mehr als einen Meter hoch war und auf der in Rot die Worte »Viel Glück, Pearl«, prangten. Ein Scheinwerfer war auf das Porträt und die Torte gerichtet. Daddy wollte mit der feierlichen Enthüllung warten, bis sämtliche Gäste eingetroffen waren.
Claude erschien ziemlich spät mit Lester Anderson und einigen seiner anderen Freunde, und mir war augenblicklich klar, warum sie sich verspätet hatten. Sie schwankten und lachten übertrieben laut, und ihnen war deutlich anzumerken, daß sie bereits alkoholische Getränke zu sich genommen hatten. Als Claude auf mich zukam, um mich zu küssen, roch sein Atem nach Whiskey.
»Ist das ein Punsch mit Schuß?« fragte er mich.
»Nein, natürlich nicht«, sagte ich. Er zwinkerte Lester zu, einem großen, schlaksigen Jungen, der immer so wirkte, als hätte er gerade etwas angestellt. Lester himmelte Claude an und wäre auf fast jeden seiner Vorschläge eingegangen.
»Soll ich?« fragte Lester mich und deutete auf eine Flasche Rum in der Innentasche seiner Jacke.
»Lester Anderson, wag das bloß nicht«, warnte ich ihn. Sämtliche Jungen lachten. Claude schlang einen Arm um meine Taille und versuchte, meinen Hals zu küssen.
»Laß das sein, Claude. Einige Freunde meines Vaters beobachten uns bereits.«
»Laß uns einen Moment lang von hier verschwinden«, flüsterte er. »Ich habe dir noch nicht gehörig gratuliert.«
»Nein. Hab’ Geduld«, sagte ich. Er war enttäuscht, doch ließ er mich in Ruhe und benahm sich.
Kurze Zeit darauf bat Daddy die Musiker, eine kurze Pause einzulegen. Dann trat er ans Mikrofon und kündigte die Enthüllung des Porträts an.
»Heute abend haben wir ein ganz besonderes Geschenk für Pearl«, begann er. »Im Grunde genommen handelt es sich dabei ausschließlich um das Werk meiner Frau, aber einer der Gründe, aus denen ich sie geheiratet habe, war der, daß ich mir über ihr Talent im klaren war und wußte, welche Wunder sie vollbringen kann.«
Alle Anwesenden lachten. Ich sah Tante Jeanne an, die insgeheim Blicke mit Mommy auszutauschen schien. Daddy nahm das Tuch, das das Gemälde verhüllte, und ich spürte, wie mein Herz pochte. Meine Nervosität war fast so groß wie in dem Moment, in dem ich mich erhoben hatte, um meine Rede zu halten.
»Pearl«, sagte Daddy. Ich trat vor, und die Gäste klatschten. Mommy blieb an Daddys Seite, als er zu einem kleinen Trommelwirbel der Kapelle langsam das Tuch anhob und ein Gemälde enthüllte, das mir schlichtweg den Atem verschlug. Mommy hatte nicht einfach nur ein Porträt von mir in meinem Kleid für die offizielle Abschlußfeier gemalt. Nein, dahinter hatte sie ein zweites Porträt von mir gemalt, in einem Ärztekittel und mit einem Stethoskop um den Hals. Die Gäste schnappten nach Luft, und dann applaudierten alle. Einige der Anwesenden eilten auf Mommy zu, um ihr die Hand zu drücken.
»Das sieht ja aus wie Zwillinge«, rief Pierre.
»Dich gibt es zweimal auf dem Bild, genau wie uns«, quietschte Jean. Alle lachten.
»Es ist wunderschön, Mommy«, sagte ich, als wir einander umarmten. »Ich hoffe, ich werde deinen Erwartungen entsprechen.«
»Ganz bestimmt, Schätzchen.«
»Das will ich dir geraten haben«, sagte Daddy und gab mir ebenfalls einen Kuß.
Danach kam die Party in vollen Schwung. Die Musiker zogen durch das Haus, als veranstalteten wir eine Karnevalsfeier. Das Essen wurde gebracht und auf die Tische gestellt. Es gab Platten mit Truthahn und Roastbeef, gebackene, gefüllte Langusten in Austernsauce, Krabben Mornay und gefüllte Krebse, aber auch Langusten-Étouffée. Alle waren beeindruckt von diesen Köstlichkeiten, und als die Desserts auf Servierwagen herausgefahren wurden, stießen die Gäste Freudenrufe aus und drängten sich um die Pfirsichtorte, das Bananenbrot mit Nüssen, die Crêpes, den Pekannußkuchen, die flambierte Orangencrème und das Schokoladen-Rum-Soufflé. Auch meine Glückwunschtorte wurde angeschnitten und serviert.
Die wunderbaren Gerichte trugen nur noch mehr zu der festlichen Stimmung bei. Überall tanzten Menschen miteinander, sogar in den Korridoren. Ich bewegte mich möglichst oft durch die Menge und sprach mit vielen von Mommys und Daddys Freunden. Als ich im Ballsaal stehenblieb, um Atem zu holen, spürte ich plötzlich, wie jemand von hinten auf mich zukam.
»Ein günstiger Zeitpunkt, um unbemerkt von hier zu entwischen«, flüsterte Claude, der mir die Hände auf die Hüften gelegt hatte.
»Ich kann noch nicht verschwinden, Claude.« Ich wich vor ihm zurück.
»Warum denn nicht? Du warst bei dem großen Ereignis anwesend, der Enthüllung deines Porträts. Und wir haben alle mehr als genug gegessen.« Er stockte, und seine blauen Augen richteten sich argwöhnisch auf mein Gesicht. »Hast du deinen Eltern etwa nicht erzählt, daß du später noch auf eine andere Party gehst?« Er wartete einen Moment lang und fügte dann eilig hinzu: »Du hast es ihnen nicht gesagt, stimmt’s?«
»Ich wollte es ihnen sagen, aber sie waren so gespannt und haben sich so sehr auf meine eigene Party gefreut, daß ich es nicht übers Herz gebracht habe. Laß mir noch ein Weilchen Zeit«, flehte ich.
Claude sah mich finster an und kehrte widerstrebend zu seinen Freunden zurück, die, wie sie angedroht hatten, eine Schale Punsch für ihren eigenen Bedarf mit Rum versetzt hatten. Jetzt teilten sie ihn sich mit Catherine, Marie Rose und Diane Ratner. Diane war schon immer hinter Claude her gewesen. Ich sah, wie sie die Gelegenheit nutzte, als ich mich mit Daddys und Mommys Freunden abgeben mußte. Sie hatte sich bei Claude eingehängt und flüsterte ihm ständig ins Ohr. Was sie auch sagte, es gefiel ihm ganz offensichtlich, doch er ließ mich nicht aus den Augen. Ich sah, daß er mit jedem Moment, der verging, wütender wurde. Der Zorn ließ seine silberblauen Augen wie Steine in einem kalten Bach schimmern.
Ich wollte gerade noch einmal mit ihm reden, als Tante Jeanne mir eine Hand auf die Schulter legte. »Und was wirst du im kommenden Sommer anfangen?« fragte sie mich.
»Ich werde als Schwesternhilfe in einem Krankenhaus arbeiten. Daddy meinte, das sei eine nützliche Erfahrung für mich.«
»Dann ist es dir also wirklich ernst damit, Ärztin zu werden?« sagte sie mit einem Lächeln.
»Ja, sehr ernst sogar.«
Sie nickte. »Vielleicht ist es dir so bestimmt«, sagte sie, und diese Worte ließen mich an meine Urgroßmutter Catherine denken.
»Hast du meine Urgroßmutter Catherine gekannt, Tante Jeanne?«
»Ich habe von ihr gehört. Sie war eine sehr berühmte Heilerin. Ich wünschte, sie wäre noch am Leben und könnte meiner Mutter helfen. Sie ist bei einer Heilerin gewesen, aber diese Frau besitzt anscheinend nicht die Heilkräfte, die deine Urgroßmutter besessen hat. Dir macht es nichts aus, unter Kranken zu sein und ständig mit Siechtum und Blut konfrontiert zu werden?«
»Nein«, sagte ich. »Es gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich Kranken helfen kann.«
Sie lächelte. »Dann ist Catherines Gabe vielleicht an dich übergegangen.« Sie starrte mich mit einem wundersamen Blick an und nickte. »Ich wünsche dir viel Glück, mein Schätzchen. Besuch uns eines Tages mal im Bayou.«
»Das werde ich tun«, sagte ich und schluckte. Mommy und Daddy hatten mir nie verboten, dorthin zu gehen, doch der Widerwille beider, ins Bayou zurückzukehren, war so groß, daß es mir wie ein Tabu erschien.
»Wir müssen bald gehen, aber das wollte ich dir vorher noch geben«, sagte Tante Jeanne und reicht mir ein kleines Schächtelchen. Es war nicht in Geschenkpapier eingewickelt. »Danke«, sagte ich und war ein wenig überrascht. Warum hatte sie das Geschenk nicht eingepackt und es zu den übrigen Geschenken gelegt?
»Na, los, mach es auf«, sagte sie. Ich warf einen Blick über den Saal und sah, wie Mommy uns anstarrte. Furcht stand in ihr Gesicht geschrieben. Ihr ängstlicher Gesichtsausdruck ließ meine Finger zittern, doch schließlich öffnete ich das kleine Schächtelchen und fand darin ein silbernes Medaillon vor.
»Es ist ein Bild darin«, erklärte Tante Jeanne.
Ich drückte auf den Verschluß, und das Medaillon sprang auf. Darin fand ich ein Bild von Paul vor, wie er mich als Säugling auf den Armen hielt. Er trug den Hut aus Palmwedeln. Im ersten Moment brachte ich kein Wort heraus. Genauso sah ich ihn zu Beginn meines ständig wiederkehrenden Alptraums immer vor mir, in dem er mich trug.
»Ich dachte mir, das würdest du sicher gern besitzen«, sagte Tante Jeanne.
»Ja. Danke.«
»Erinnerst du dich überhaupt noch an ihn?« fragte sie.
»Ein klein wenig«, sagte ich.
»Er hat dich sehr gern gehabt, und du hast ihn sehr gern gehabt«, sagte sie wehmütig. Dann holte sie tief Atem, nahm meine Hände in ihre und ließ gleichzeitig das Medaillon zuschnappen. »Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Traurigkeit. Verwahre es an einem sicheren Ort, und schau es dir von Zeit zu Zeit an«, bat sie mich. Ich bedankte mich noch einmal bei ihr, und sie ging zu Daddy und Mommy, um sich von ihnen zu verabschieden.
Sowie sie gegangen war, kam Mommy auf mich zu. »Ich habe gesehen, daß sie dir etwas gegeben hat«, sagte sie.
Ich zeigte es ihr, und sie schnappte nach Luft. »Ich wußte ganz genau, daß es etwas mit Paul zu tun hat.«
»Hassen uns die anderen Tates tatsächlich, Mommy?« fragte ich.
»Laß es uns einfach so sagen, wir stehen nicht gerade auf ihrer Freundesliste«, erwiderte Mommy. Sie warf noch einen Blick auf das Bild. »Er war ein sehr gut aussehender Mann, findest du nicht auch?«
»Doch«
Sie gab mir das Medaillon zurück.
»Es war nett von ihr, dir dieses Medaillon zu schenken, und sie hat recht, wenn sie versucht, dafür zu sorgen, daß Paul nicht in Vergessenheit gerät. Bewahre dieses Medaillon gemeinsam mit deinen kostbarsten Besitztümern auf.«
»Das werde ich tun, Mommy.«
Sie lächelte liebevoll und wandte sich wieder ihren Gästen zu. Kurze Zeit später, als ich gerade mit Dominique redete, einem Galeriebesitzer, der Mommy dazu überreden wollte, mein Bild in seinem Schaufenster auszustellen, kam Catherine auf mich zu.
»Claude ist schon reichlich verärgert. Wir wollen alle gehen, Pearl. Lester und die anderen sind bereits gegangen und erwarten uns bei ihm zu Hause. Was ist jetzt? Kommst du mit oder nicht?«
Ich biß mir auf die Unterlippe. Ein Teil von mir wollte gehen, doch ein anderer Teil von mir erhob Einwände dagegen. Ich warf einen Blick über den Saal und sah Daddy lachen. Die Zwillinge mampften mit ihren Freunden Erdbeerbiskuits. Jetzt konnte ich mich verdrücken, ohne allzuviel Aufsehen zu erregen, dachte ich mir.
»Laß mich mit meiner Mutter reden«, sagte ich.
»Einverstanden. Ich sage Claude Bescheid«, sagte Catherine. Mommy entging nur selten etwas, was sich um sie herum abspielte. Während sie mit ihren Freunden aus den Künstlerkreisen redete, behielt sie mich im Auge. Sowie ich auf sie zuging, entfernte sie sich von der Gruppe.
»Was ist, Liebling?« fragte sie. »Du willst mit deinen Freunden ausgehen?«
»Ich glaube, schon«, sagte ich.
Sie warf einen Blick auf Claude, Catherine und die anderen, und dann hefteten sich ihre Augen auf mich. »Aus irgendwelchen Gründen bist du nicht von ganzem Herzen bei der Sache, Pearl«, sagte sie mit der Treffsicherheit eines Mediums. »Warum nicht, Liebling? Wird es eine wilde Party werden?« »Das kann schon sein«, gestand ich.
Sie nickte. »Du weißt ja, was es mit dem Erwachsenwerden auf sich hat«, sagte sie und nickte wieder wie jemand, der endlich zu einer Schlußfolgerung gelangt ist. »Es geht darum zu wissen, wann man nein sagen sollte. Ich glaube, mehr steckt gar nicht dahinter«, fügte sie hinzu. »Du mußt diese Entscheidung selbst treffen. Wenn du gehen willst, dann ist das in Ordnung. Heute ist dein großer Abend, Pearl. Daddy wird es verstehen.«
Wir umarmten einander, und dann kehrte ich zu meinen Freunden zurück. Claude zog die Augenbrauen hoch und lächelte. Ich wollte gerade nicken, doch im letzten Moment unterließ ich es. Wenn ich erst einmal dieses Haus verließ und mit Claude zu Lester ging, dann würde es schwieriger werden, nein zu sagen, als mein Medizinstudium abzuschließen, dachte ich mir.
»Kommst du jetzt endlich?« fragte Claude begierig.
»Warum bleiben wir beide nicht hier, Claude?« schlug ich vor. »Hier können wir problemlos ungestört sein.«
»Hier? Ist das dein Ernst? Wohin man auch geht, überall lungern Bedienstete herum – es sei denn, wir schleichen uns nach oben, in dein Zimmer«, schlug er vor, und seine Blicke glitten lüstern über mich.
»Claude, ich mag es nicht, wenn man mich drängt«, sagte ich. »Dich drängt? Wir gehen jetzt schon fast ein Jahr lang miteinander. Heutzutage ist das so, als wäre man verheiratet«, protestierte er.
Ich fing an zu lachen, doch er redete weiter, und seine Wut steigerte sich. »Du machst dir keine Vorstellung davon, was es für mich heißt, all meine Freunde zu belügen und ihnen vorzumachen, wir seien wirklich ein Liebespaar. All meine Freunde haben Freundinnen, die sich nicht davor fürchten, mit ihnen zu schlafen.«
»Soll das heißen, daß du Geschichten über uns erfindest?« fragte ich.
»Ja, selbstverständlich. Willst du etwa, daß ich mich lächerlich mache?«
»Und du glaubst, wenn wir nicht miteinander schlafen, stehst du lächerlich da? Das ist alles, worum es dir geht? Nimmst du denn gar keine Rücksicht auf mich und meine Gefühle?«
»Genau das habe ich vor«, sagte er und trat näher. »Mich deiner Gefühle anzunehmen. Jetzt komm schon. Laß uns gemeinsam mit den anderen von hier fortgehen.«
»Ich möchte lieber hier bleiben, Claude«, sagte ich, nachdem ich tief Atem geholt hatte.
Er schüttelte den Kopf. »Du wirst niemals mit mir schlafen, stimmt’s?«
»Ich habe nicht die Absicht, nur mit dir zu schlafen, um bei ein paar dummen Schulkindern in der Achtung zu steigen. Dafür muß es schon einen ernsthafteren Grund geben.«
Er nickte. Ich sah, daß seine Augen ein wenig blutunterlaufen waren. »Ich finde, du solltest mir meinen Ring zurückgeben«, sagte er. »Solange du ihn um den Hals trägst, ist er die reinste Vergeudung.«
Mein Herz pochte. Mußte denn ausgerechnet an diesem Abend und nicht etwa an irgendeinem anderen etwas so Unerfreuliches passieren?
»Also, was ist?« sagte er. »Wofür entscheidest du dich?«
Ich öffnete den Verschluß der Kette, an der sein Ring hing, und gab ihn zurück.
Er war erstaunt und ballte die Finger um seinen Ring herum zur Faust. »Ich hätte von Anfang an auf meine Freunde hören sollen. Sie haben mir alle gesagt, du hättest nur Verstand und keinerlei Gefühle. Wahrscheinlich bist du nach jeder unserer Verabredungen nach Hause gegangen und hast einen Bericht darüber verfaßt, stimmt’s?«
»Natürlich nicht«, sagte ich.
»Du tust mir leid«, fuhr er fort und schüttelte den Kopf. »Du wirst die Menschen immer nur sezieren. Was hast du jetzt schon wieder getan? Hast du etwa deine Temperatur gemessen und beschlossen, heute nacht sei die Wahrscheinlichkeit eines Eisprungs enorm groß?« fragte er und verzog die Lippen zu einem sarkastischen Grinsen. Seine Worte trafen mich wie Pfeile, die auf mein Herz gerichtet waren. Tränen brannten unter meinen Lidern, aber ich hätte es mir nie verziehen, in seinem Beisein zu weinen.
»Kommst du jetzt endlich, Claude?« fragte Diane Ratner und hob anzüglich eine Schulter.
»Ja, allerdings. Darauf kannst du dich verlassen«, sagte er und lächelte sie an. Dann hing er sich bei ihr ein und umfaßte ihre Taille. Sie quietschte vor Vergnügen und warf mir einen selbstzufriedenen Blick zu. Ich konnte regelrecht hören, wie sie sich brüsten würde: »Du magst zwar die Klassenbeste sein, die die Abschlußrede hält, und du magst zwar dieses große Haus haben, in dem diese riesige Party für dich veranstaltet wird, aber ich habe dir deinen Freund ausgespannt.«
»Bist du jetzt zufrieden?« fragte mich Claude.
»Ja. Wenn du beschlossen hast, daß das das Allerwichtigste ist, dann bin ich sogar sehr zufrieden, weil ich nämlich die richtige Entscheidung getroffen habe«, sagte ich.
Sein Lächeln verflog schnell. »Setz du dich doch hin und lies ein Buch«, fauchte er.
»Ein möglichst trockenes«, fügte Diana noch hinzu. Ihr schallendes Gelächter trieb hinter ihnen her, als sie sich den anderen anschlossen und sich auf den Weg zur Haustür machten.
Catherine kam auf mich zugerannt. »Was tust du da?«
»Das einzig Vernünftige«, sagte ich. Sie schüttelte den Kopf und warf einen Blick auf die anderen. »Geh schon. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme auch ohne euch zurecht.« »Und dabei wollten wir heute nacht ganz groß auf die Pauke hauen«, jammerte sie.
»Jeder feiert auf seine Art. Warum hast du zugelassen, daß sie meine Rede zerstört haben? Ich dachte, wir seien gute Freundinnen.«
»Das war doch nur ein Scherz. Ich wußte, daß du es auch ohne deine Aufzeichnungen schaffen wirst«, sagte sie, doch sie wandte den Blick ab.
»Freunde sind füreinander da und beschützen sich gegenseitig, aber vermutlich setzt das eine gewisse Reife voraus«, bemerkte ich trocken.
Glut loderte in ihren Augen, als sie den Kopf herumriß und mich fest ansah. »Ich weiß nicht mehr, was ich noch von dir halten soll, Pearl. Vielleicht bist du für unseren Geschmack zu sehr von dir selbst eingenommen. Du enttäuschst mich«, fügte sie hinzu und wandte sich ab, um eilig hinter den anderen herzulaufen. Ich beobachtete, wie sie geschlossen das Haus verließen, und einen Moment lang waren meine Ohren taub für die Musik, das Stimmengewirr und das Gelächter um mich herum. Ich hörte nur noch Claudes zornige Worte und Catherines Enttäuschung.
Ich biß mir auf die Unterlippe und zwängte das Schluchzen zurück, das sich mir entringen wollte. Obwohl ich mehr als genug gegessen hatte, verspürte ich ein hohles Gefühl im Magen. War ich tatsächlich zu tugendhaft? Wurde ich wirklich nur von meinem Verstand gesteuert?
Ich sah mich nach den Partygästen um. Alle hatten soviel Spaß, und Daddy hatte nie einen jüngeren oder glücklicheren Anschein erweckt. Mommy war in ein Gespräch mit einigen ihrer Galeristenfreunde vertieft. All meine Klassenkameraden waren gegangen. Warum stand ich ausgerechnet heute abend da und fühlte mich am Boden zerstört, wo mir doch genau in dieser Nacht ganz wunderbar hätte zumute sein sollen? Ich eilte durch eine Seitentür ins Freie und lief über die Terrasse zum Pool und den Umkleidekabinen, und ich ließ die fröhlichen Klänge des Gelächters, der Musik und der Stimmen hinter mir zurück.
Ich verschränkte die Arme unter dem Brüsten und lief langsam mit gesenktem Kopf weiter. Plötzlich kamen die Zwillinge und zwei ihrer Freunde aus dem Becken auf mich zugesprungen und schrien alle gleichzeitig: »Buh!«
»Laßt mich in Ruhe«, fuhr ich sie grob an.
Pierre fiel der Unterkiefer herunter, doch Jean lachte weiterhin.
»Wir wollten uns nur einen Scherz erlauben, Pearl«, sagte Pierre.
»Für euch beide fehlt mir im Moment die Geduld. Laßt mich allein!« schrie ich sie an.
»Es tut uns leid«, sagte Pierre. Er packte Jean am Arm. »Komm schon. Laß uns sehen, ob wir noch ein Eis finden.«
»Was ist denn mit der los?« fragte Jean verwirrt.
»Komm schon«, befahl ihm Pierre. Obwohl Jean der Stärkere von beiden war, gehorchte er seinem Bruder, und alle vier eilten ins Haus zurück und ließen mich mit meinen tristen Gedanken allein.
Der Himmel über mir, der weitgehend klar gewesen war und an dem die Sterne gefunkelt hatten, zog sich immer mehr zu. Es war, als würden die Wolken wie ein riesiger dunkler Vorhang von einem Horizont an den anderen gezogen, um den Himmel zu verbergen und mich von dem Glück auszuschließen, das ich am heutigen Tage erfahren hatte. Ich legte mich auf einen Liegestuhl und lauschte den Geräuschen der Stadt, die über die Mauern unseres Gartens drangen.
»Was ist passiert, Pearl?« hörte ich kurze Zeit darauf jemanden sagen. Als ich aufblickte, sah ich Mommy im Schatten stehen.
»Nichts.«
Sie trat in den bleichen Lichtschein, der von der Terrasse kam. »Ich kenne dich zu gut, mein Schätzchen, und du weißt genau, daß ich deine Traurigkeit fühlen kann«, sagte sie. So war es auch. Zeitweilig standen wir einander so nahe, daß Daddy verwundert den Kopf schüttelte. »Ich habe dich in mir getragen. Wir beide sind zu sehr Teil voneinander, um nicht die tiefsten Gefühle des anderen wahrzunehmen. Was ist vorgefallen?«
Ich zuckte die Achseln. »Ich habe nein gesagt, und alle sind gegangen. Sie halten mich für eine tugendhafte Streberin, ein gefühlloses Wesen, das nur Verstand besitzt.«
»Ah, ich verstehe.« Sie setzte sich neben mich. In der Dunkelheit fielen Schatten über ihr Gesicht, doch der matte Lichtschein fiel in ihre Augen, in denen Mitgefühl schimmerte. »Ich weiß, daß es schmerzlich für dich ist, deine Freunde fortzuschicken, aber du mußt das tun, wovon dir dein Herz sagt, daß es richtig ist.«
Nach einer Weile fügte sie hinzu: »Vor langer, langer Zeit habe ich einmal nein gesagt, und ich glaube, das hat mir das Leben gerettet.«
»Wirklich? Was ist passiert?«
»Meine Schwester und ein Freund sind in einem Wagen vorbeigefahren und haben mich aufgefordert mitzukommen. Sie hatten Haschisch geraucht, und ich konnte ihnen ansehen, daß sie bereits high waren. Sie haben herumgealbert und waren zu Leichtsinn aufgelegt. Sie haben mich damals auch für einen Spielverderber gehalten, und ich erinnere mich noch gut daran, daß ich mich gefragt habe, ob vielleicht mit mir etwas nicht stimmt und ob ich vielleicht zu alt für mein Alter bin.«
»War das die Nacht des Unfalls, bei dem Gisselle verkrüppelt worden ist?«
»Ja, und der Junge ist ums Leben gekommen. Ich will damit nicht sagen, daß ständig etwas Furchtbares passieren muß, aber du mußt auf deine Instinkte vertrauen und an dich selbst glauben.«
»Manchmal hat es Spaß gemacht, mit Claude zusammen zu sein. Er ist der beliebteste Junge in der ganzen Schule. Aber meine Gefühle für ihn waren nicht stark genug. In Wahrheit habe ich bisher noch nie irgendeinem Jungen gegenüber starke Gefühle aufgebracht, Mommy. Ist das ungewöhnlich? Bin ich zu analytisch? Bestehe ich wirklich nur aus meinem Verstand?«
»Natürlich nicht«, sagte sie lachend. »Warum mußt du dich auf eine ernsthafte Beziehung mit jemandem einlassen, wenn du noch so jung bist?«
»Du hast es getan«, sagte ich voreilig und bereute es sogleich. »Bei mir war das etwas anderes, Pearl. Ich hatte ein vollkommen anderes Leben hinter mir. Das habe ich dir doch erzählt. Meine Kindheit hat ein vorzeitiges Ende gefunden. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, um jung und unbeschwert zu sein.«
»Aber du hast dich doch in Daddy verliebt, als du ihn noch gar nicht lange gekannt hast, oder nicht?«
»Doch, ich glaube, schon.« Sogar in der Dunkelheit konnte ich das winzige Lächeln sehen, das bei der Erinnerung daran um ihre Lippen spielte. »Hier draußen, in dieser Badehütte, haben wir uns das erste Mal geküßt, ein Kuß, der mein Leben verändert hat. Aber das heißt nicht, daß es bei allen Menschen so sein muß, und schon gar nicht bei dir«, fuhr sie eilig fort. »Du wirst Karriere machen, und du hast dich höheren Zielen verschrieben als deine meisten Freunde«, fügte sie hinzu.
»Ist das gut so?« fragte ich mich laut. »Oder werde ich mir dadurch etwas Wichtiges entgehen lassen?«
»Das glaube ich nicht, Schätzchen. Ich glaube, dir sind wesentlichere Dinge bestimmt, und wenn du dich verliebst und wenn jemand sich in dich verliebt, dann wird diese Verbindung weitaus stärker sein, als du es dir heute ausmalen kannst.«
»Ich habe fast das Gefühl, ich sollte zu Marie Laveau im Französischen Viertel gehen und mir dort einen Liebestrunk besorgen«, sagte ich, und Mommy lachte.
»Wer hat dir denn davon erzählt? Sag bloß nicht, ich sei es gewesen«, fügte sie eilig hinzu.
»Nein, ich habe etwas darüber gelesen. Du hast so etwas doch nie getan, oder?«
»Nein, aber ab und zu habe ich eine Kerze angezündet, oder Nina Jackson hat ein Bröckchen Schwefel angesteckt, um böse Geister zu vertreiben, von denen sie geglaubt hat, sie würden mich bedrängen. Vermutlich kommt dir all das albern vor«, sagte sie. »Und vielleicht ist es das ja auch.«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich glücklicher, wenn ich weniger naturwissenschaftlich orientiert wäre«, sagte ich.
»Jedenfalls weiß ich, daß meine Freunde mich dann lieber mögen würden.«
»Unsinn. Bloß, um anderen einen Gefallen zu tun, darfst du nicht jemand sein, der du nicht bist«, ermahnte mich Mommy.
»He«, rief Daddy, der in der Terrassentür stand. »Bist du da draußen, Ruby?«
»Ja, Beau.«
»Einige deiner Freunde möchten gehen und wollen sich von dir verabschieden.«
»Ich komme gleich.«
»Ist irgend etwas passiert?« fragte Daddy, als er sah, daß ich mit Mommy zusammensaß.
»Nein.«
Er schaute uns skeptisch an. »Bist du ganz sicher?«
»Mir fehlt nichts, Daddy«, sagte ich. »Wir kommen gleich.« Ich stand auf, und Mommy schlang einen Arm um mich.
»Dir sollte auch nichts fehlen«, sagte sie und drückte mich eng an sich. »Ich bin stolz auf dich, und das nicht nur, weil du die Klassenbeste bist und eine wunderbare Rede gehalten hast, sondern auch deshalb, weil du vernünftig und reif für dein Alter bist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein wunderbares Gefühl es ist, eine Tochter zu haben, der man vertrauen kann und auf die Verlaß ist.«
»Danke, Mommy.« Ich drückte ihr einen Kuß auf die Wange, und als ich ihr Haar und ihr Parfum roch, wurde mir gleich leichter ums Herz. Ich konnte mich glücklich schätzen, dachte ich, und ich würde mir diesen wunderbaren Tag und diesen wunderbaren Abend von nichts und niemandem verderben lassen.
Nachdem unsere Gäste gegangen waren, bettelten und flehten die Zwillinge mich an, einen Teil meiner Geschenke auszupacken. Mommy wollte, daß sie ins Bett gingen, aber Daddy sagte, dies sei ein ganz besonderer Abend und sie dürften noch ein wenig länger aufbleiben, und daher begaben wir uns alle ins Wohnzimmer, und ich packte die ersten Geschenke aus.
Es war Kleidung für das College darunter, aber auch einige kostspielige Nachschlagewerke. Dr. Portier und seine Frau hatten mir die neueste Ausgabe von Gray’s Anatomie geschenkt.
Es dauerte nicht lange, bis meine Geschenke die Zwillinge zu langweilen begannen. Gemeinsam lehnten sie sich auf dem Sofa zurück. Pierre hatte einen Arm um Jeans Schultern gelegt, und Jean blinzelte und kämpfte gegen die Schwere seiner Lider an. Schließlich versetzte Daddy ihnen einen Rippenstoß und schickte sie ins Bett. Jeder Widerstandsgeist war aus ihnen gewichen, und sie wankten brav vor ihm her, als er sie nach oben brachte. Mommy folgte ihm, um nachzusehen, ob den beiden auch nichts fehlte.
Daddy kam als erster von beiden wieder nach unten. »Bist du glücklich, Prinzessin?« fragte er mich.
»Ja, Daddy.«
»Heute war der glücklichste Tag in meinem ganzen Leben«, sagte er.
»Nein, das ist nicht wahr, Daddy.«
»Wieso denn das?«
»Der glücklichste Tag in deinem ganzen Leben war der, an dem du Mommy kennengelernt hast.«
Er lachte. »Das ist etwas ganz anderes.«
»Aber es war doch der glücklichste Tag in deinem Leben, oder nicht?«
»Damals wußte ich es noch nicht, aber es stimmt, das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Hier draußen vor dem Haus sind wir einander zum ersten Mal begegnet, und ich habe sie für ihre Schwester gehalten, die sich für den Karneval verkleidet hat.«
»Woran erkennt ein Mann, daß er verliebt ist, Daddy? Hört er wirklich Glocken in seinem Kopf läuten?«
»Glocken?« Er lächelte. »An Glocken kann ich mich nicht erinnern. Ich erinnere mich nur daran, daß jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, mein erster Gedanke der war, mit deiner Mutter zusammen zu sein.« Er sah mich an. »Hast du Ärger mit Claude?« Ich nickte. »Das Problem ist ganz einfach, Pearl. Du bist zu reif für ihn.«
»Ich bin zu reif für alle Jungen in meinem Alter.«
»Das kann gut sein.«
»Heißt das, daß ich nur mit einem viel älteren Mann glücklich werde?«
»Nein«, sagte er lachend. »Nicht unbedingt. Und bring mir bloß niemanden ins Haus, der dein Vater sein könnte«, warnte er mich. Dann umarmten wir einander und machten uns auf den Weg nach oben. Vor meiner Schlafzimmertür drückte er mir einen Kuß auf die Stirn.
»Gute Nacht, Prinzessin«, sagte er.
»Gute Nacht, Daddy.«
»Als du unten deine Geschenke ausgepackt hast«, sagte er, »hatte ich den Eindruck, ich hätte etwas gesehen, was du um deinen Knöchel trägst. Ist es das, wofür ich es halte?« Ich nickte. Er schüttelte den Kopf. »Nun, schließlich heißt es, wenn man fest genug an etwas glaubt, dann wird es auch passieren. Für wen halte ich mich eigentlich, wenn ich mir anmaße, es besser zu wissen?« Er gab mir noch einen Kuß, und ich ging in mein Zimmer.
Mommy kam, um mir ebenfalls gute Nacht zu sagen. Ich erzählte ihr, daß Daddy das Zehncentstück bemerkt hatte.
»Jetzt wird er mich fürchterlich aufziehen«, sagte sie. »Aber das ist mir gleich. Schließlich habe ich meine Großmutter Dinge tun sehen, die sich jeder Vernunft und Logik widersetzen.«
»Es gibt immer noch so viele Dinge, die du mir nicht über die Vergangenheit erzählt hast, stimmt’s?«
»Ja«, sagte sie betrübt.
»Aber jetzt wirst du es mir erzählen. Du wirst mir alles erzählen, nicht wahr? Die guten und die bösen Sachen. Versprichst du mir das?«
»Denk heute nacht nur an erfreuliche Dinge, mein Schätzchen. Wir haben noch jede Menge Zeit, um dunkle Schränke zu öffnen.« Sie gab mir einen Kuß und schaute einen Moment lang mit einem engelhaften Lächeln auf den Lippen auf mich herunter, ehe sie ging.
Ich konnte Musik in der Nacht hören, Trompeten und Saxophone, Posaunen und Schlagzeug. New Orleans war eine Stadt, der es verhaßt war, schlafen zu gehen. Es war, als wüßte diese Stadt, daß die Gespenster und die Geister, die den Wall aus Gelächter, Musik und Gesang umzingelten, ungehindert durch die Straßen spazieren und in unsere Träume vordringen konnten, sowie sich wirklich alle schlafen legten.
Im Haus von Lesters Eltern küßte Claude jetzt wahrscheinlich Diane. Dieser Kuß war mir zugedacht gewesen.
Mein Kuß war auf Eis gelegt worden und wartete in den Kulissen auf die Lippen meines mysteriösen Geliebten. Aber vielleicht war auch das nur ein Traum. Vielleicht gab es für mich gar keinen Geliebten und würde auch niemals einen geben. Vielleicht war eine dieser Verwünschungen, von denen Mommy fürchtete, sie könnten auf unserer Schwelle hinterlassen werden, ein Fluch, der mir zugedacht war.
Ich streckte die Hand nach dem Nachttisch aus und öffnete das Medaillon, das Tante Jeanne mir geschenkt hatte, denn ich wollte mich in Pauls Armen betrachten. Auch Liebe konnte schmerzhaft sein, dachte ich.
Ich hatte die Schule als Klassenbeste abgeschlossen, aber im Moment hatte ich das Gefühl, nicht allzuviel zu wissen. Ich ließ das Medaillon wieder zuschnappen, schaltete das Licht aus und schloß die Augen.
Beim Einschlafen hörte ich den Applaus in meinen Ohren widerhallen, der mir gespendet worden wart, als ich meine Rede mit den Worten beendet hatte: »Der heutige Tag, an dem uns die akademischen Grade verliehen werden, ist weniger das Ende von etwas, sondern viel mehr ein Anfang.«
War dies der Beginn von Glück und Erfolg, oder war es vielleicht der Beginn der Irrtümer und der Einsamkeit?
»Schau niemals hinunter«, hatte Mommy einmal zu mir gesagt. »Verhalte dich genauso wie ein Hochseilakrobat. Du mußt den Blick fest in die Zukunft richten. Du mußt mehr Selbstvertrauen in dich setzen, Pearl.«
Genau das würde ich jetzt versuchen.