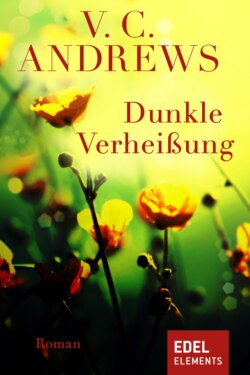Читать книгу Dunkle Verheißung - V.C. Andrews - Страница 7
2. Noch weiter fort vom Bayou
ОглавлениеAls wir aus dem Garden District hinausfuhren und den Weg zum Highway nach Baton Rouge einschlugen, wurde Gisselle unerwartet ruhig. Sie preßte das Gesicht an die Fensterscheibe und schaute auf die olivgrüne Straßenbahn hinaus, die klappernd durch die Esplanade fuhr, und mit hungrigen Blicken beobachtete sie die Leute, die in den Straßencafés saßen, als könnte sie den Kaffee und das frisch gebackene Brot riechen. In New Orleans schien es immer von Touristen zu wimmeln, von Männern und Frauen mit Kameras um den Hals und Reiseführern in der Hand, die von den Villen oder den Statuen angezogen wurden. In manchen Stadtteilen herrschte ein ruhiger, träger Rhythmus, in anderen ging es hektisch und geschäftig zu. Aber die Stadt hatte Charakter und ihre Eigenart, und es war unmöglich, hier zu leben und nicht Teil dieser Stadt zu sein oder sie daran zu hindern, daß sie ein Teil von einem selbst wurde.
Als wir unter dem langen Baldachin von dichtbelaubten Eichen durchfuhren und an den grandiosen Villen und Gärten vorbeikamen, in denen Massen von Kamelien und Magnolien blühten, befiel mich Melancholie. Dieses Gefühl überraschte mich. Mir war nicht klar gewesen, daß ich mich inzwischen hier zu Hause fühlte. Vielleicht lag es an Daddy, vielleicht an Nina, Edgar und Wendy, aber ganz bestimmt lag es an Beau. Ich hatte plötzlich das Gefühl zu wissen, wo ich hingehörte. Ich begriff, daß ich diesen Teil der Welt, den ich vor knapp einem Jahr für mich beansprucht hatte, vermissen würde.
Ich würde Ninas leckere Gerichte vermissen, ihren Aberglauben und ihre Rituale gegen das Böse. Ich würde es vermissen zu hören, wie sie mit Edgar plauderte oder über die Macht eines Krautes oder des bösen Auges stritt. Ich würde vermissen, wie Wendy bei der Arbeit vor sich hin sang, und ich würde Daddys strahlendes und liebevolles Lächeln vermissen, mit dem er mich jeden Morgen begrüßt hatte.
Trotz der Spannung, die Daphne vom Augenblick meiner Ankunft in New Orleans an über unseren Köpfen hatte schweben lassen, wußte ich, daß ich die prächtige Villa mit ihrer riesigen Eingangshalle, den beeindruckenden Gemälden und Statuen und den wertvollen antiken Möbeln vermissen würde. Wie berauschend es für mich in der ersten Zeit gewesen war, mein Zimmer zu verlassen und wie eine Prinzessin in einem Schloß die gewundene Treppe hinunter zu steigen. Würde ich je diesen ersten Abend vergessen, als Daddy mich in das Zimmer geführt hatte, das von da an meins sein sollte? Wie er die Tür geöffnet hatte und mein Blick auf dieses riesige Bett mit den flauschigen Kissen und den Chintzbezügen gefallen war? Ich würde das Gemälde über meinem Bett vermissen, das Bild der wunderschönen jungen Frau, die vor dem Hintergrund eines Gartens einen Papageien fütterte. Ich würde meine großen Kleiderschränke und mein enormes Badezimmer mit der Wanne vermissen, in der ich stundenlang genüßlich liegen konnte.
Ich hatte mich in unserem Haus so wohl gefühlt, und, ja, ich mußte eingestehen, daß ich jetzt verwöhnter war als vorher. Nachdem ich in einem Pfahlbau der Cajun aufgewachsen war, einer Hütte aus dem Holz der Sumpfzypresse mit einem Blechdach, einem Haus, in dem die Zimmer nicht größer gewesen waren als manche der Abstellkammern im Haus der Dumas, hatte ich zwangsläufig vor Ehrfurcht erstarren müssen, als ich mit dem konfrontiert wurde, was von Rechts wegen auch mein Zuhause war. Mit Sicherheit würde ich die Abende vermissen, an denen ich im Garten auf der Terrasse gesessen und gelesen hatte, während die Häher und Spottdrosseln um mich herum flatterten und sich auf den Geländern der Laube niederließen, um neugierig zu schauen. Ich würde es vermissen, die Seeluft zu riechen und gelegentlich in der Ferne ein Nebelhorn zu hören.
Und doch hatte ich kein Recht darauf, unglücklich zu sein. Daddy gab eine Menge Geld dafür aus, uns in diese Privatschule zu schicken, und er tat es, um uns freudlose, triste Tage zu ersparen. Er wollte, daß wir unsere Jahre als Teenager unbeschwert von der finsteren Last früherer Sünden verbringen konnten, Sünden, die wir erst noch verstehen lernen, vielleicht sogar erst noch entdecken mußten. Vielleicht würde mit der Zeit wieder ein wenig Freude in Daddys Leben einkehren. Vielleicht konnten wir dann wieder alle zusammen sein.
Da saß ich nun und glaubte an den blauen Himmel, obwohl sich nur Wolken am Horizont abzeichneten, und ich glaubte an Vergebung, wo nur Zorn und Neid und Selbstsucht waren. Hätte Nina doch wirklich ein magisches Ritual zur Verfügung gehabt, eine Litanei, ein Kraut oder einen alten Knochen, den wir über dem Haus und seinen Bewohnern hätten schwenken können, um die dunklen Schatten zu vertreiben, die in unseren Herzen lebten!
Wir bogen ab und mußten anhalten, um einen Leichenzug passieren zu lassen, und dieser Anblick bestärkte mich in meiner plötzlich aufkeimenden Verzweiflung.
»Na, das ist ja toll«, beschwerte sich Gisselle.
»Es wird nur einen Moment dauern«, sagte Daddy.
Ein halbes Dutzend Farbiger in schwarzen Anzügen spielten Blasinstrumente und wiegten sich zu der Musik. Die Trauergäste, die ihnen folgten, taten es ihnen gleich. Ich wußte, daß Nina darin ein böses Omen gesehen und eines ihrer magischen Pulver in die Luft geworfen hätte. Später hätte sie eine blaue Kerze angezündet, nur um ganz sicherzugehen. Instinktiv bückte ich mich und berührte das magische Zehncentstück, das sie mir geschenkt hatte.
»Was ist das?« fragte Gisselle.
»Nichts weiter, nur ein Talisman, den Nina mir gegeben hat.«
Gisselle verzog höhnisch das Gesicht. »Du glaubst immer noch an dieses dumme Zeug? Das ist mir wirklich peinlich. Leg das Ding ab. Ich will nicht, daß meine neuen Freundinnen wissen, wie rückständig meine Schwester ist«, befahl sie mir.
»Du glaubst an das, woran du glauben willst, Gisselle, und ich glaube an das, woran ich glauben will.«
»Daddy, würdest du ihr bitte sagen, daß sie dieses alberne Amulett und dieses Zeug nicht nach Greenwood mitnehmen kann? Das ist peinlich für die ganze Familie.« Sie wandte sich wieder an mich. »Es wird schon schwer genug sein, deine Herkunft geheimzuhalten«, behauptete sie.
»Ich habe dich nicht gebeten, irgend etwas davon geheimzuhalten, Gisselle. Ich schäme mich meiner Vergangenheit nicht.«
»Das solltest du aber«, sagte sie mürrisch und schaute finster den Trauerzug an, als ärgerte es sie, daß jemand die Unverschämtheit besaß, genau dann zu sterben und beerdigt zu werden, wenn sie eine Straße passieren wollte.
Sowie der Leichenzug vorübergezogen war, fuhr Daddy weiter. In diesem Augenblick ging Gisselle schlagartig wieder auf, daß all das wirklich geschah.
»Ich lasse all meine Freunde zurück. Es dauert Jahre, enge Freundschaften zu schließen, und jetzt habe ich sie alle verloren. «
»Wenn es so gute Freunde waren, wie kommt es dann, daß sie nicht erschienen sind, um sich von dir zu verabschieden?« fragte ich.
»Sie sind eben wütend, weil ich weggehe.«
»Zu wütend, um sich von dir zu verabschieden?«
»Ja«, fauchte sie. »Außerdem habe ich gestern abend mit allen telefoniert.«
»Seit deinem Unfall, Gisselle, wollen die meisten nichts mehr mit dir zu tun haben. Es ist zwecklos, sich etwas vorzumachen. Sie sind das, was man Freunde für gutes Wetter nennt. «
»Ruby hat recht, Schätzchen«, sagte Daddy.
»Ruby hat recht«, ahmte Gisselle ihn nach. »Ruby hat immer recht«, murmelte sie tonlos.
Als der Lake Pontchartrain in Sicht kam, schaute ich hinaus auf die Segelboote, die auf das Wasser gemalt zu sein schienen, und ich dachte an Onkel Jean und an Daddys Geständnis, daß das, was als ein gräßlicher Bootsunfall angesehen wurde, in Wirklichkeit etwas gewesen war, das Daddy in einem Anflug von rasender Eifersucht absichtlich getan hatte. Seitdem hatte er jeden einzelnen Tag seines Lebens damit zugebracht, es zu bereuen, und er würde es auch weiterhin Tag für Tag bereuen. Aber nachdem ich monatelang mit Daddy und Daphne zusammengelebt hatte, beherrschte mich das sichere Gefühl, daß das, was sich zwischen ihm und Onkel Jean abgespielt hatte, in erster Linie Daphnes Schuld und nicht seine war. Vielleicht war das ein weiterer Grund dafür, daß sie mich nicht mehr sehen wollte. Sie wußte, daß ich in ihr jedesmal, wenn ich sie ansah, das sah, was sie in Wirklichkeit war: eine hinterhältige und verschlagene Person.
»Ihr werdet euren Spaß daran haben, die Schule in Baton Rouge zu besuchen«, meinte Daddy und warf im Rückspiegel einen Blick auf uns.
»Ich hasse Baton Rouge«, erwiderte Gisselle eilig.
»Du bist doch nur einmal dort gewesen, Schätzchen«, sagte Daddy, »als ich mich mit den Regierungsbeamten dort getroffen und dich und Daphne mitgenommen habe. Es überrascht mich, daß du dich überhaupt noch daran erinnerst. Du warst damals erst sechs oder sieben Jahre alt.«
»Ich erinnere mich. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, daß ich es nicht erwarten konnte, wieder nach Hause zu fahren.«
»Aber jetzt wirst du mehr über unsere Hauptstadt erfahren und zu schätzen wissen, was es dort für dich zu entdecken gibt. Ich bin sicher, daß ihr von der Schule aus Ausflüge in die Regierungsgebäude, die Museen und den Zoo unternehmen werdet. Ihr wißt doch, was der Name ›Baton Rouge‹ bedeutet, oder nicht?« fragte er.
»Auf französisch bedeutet es ›roter Stock‹«, sagte ich.
Gisselle funkelte mich wütend an. »Das habe ich auch gewußt. Ich habe es nur nicht so schnell gesagt wie sie«, erklärte sie.
»Oui, aber wißt ihr auch, warum es so genannt wird?« Ich wußte es nicht, und Gisselle hatte schon gar keine Ahnung; und es interessierte sie auch nicht. »Der Name kommt von einer großen Zypresse, deren Rinde man abgeschält hat, um dann frisch getötete Tiere an den Stamm zu hängen; diese Zypresse markierte die Grenze zwischen den Jagdgründen zweier früherer Indianerstämme«, erklärte er.
»Wie eklig«, rief Gisselle. »Frisch getötete Tiere, igitt.«
»Es ist unsere zweitgrößte Stadt und einer der größten Häfen des Landes.«
»Total verräuchert«, nörgelte Gisselle.
»Nun, die rund hundert Meilen lange Küste von Baton Rouge bis New Orleans ist als die Petrochemische Goldküste bekannt, aber es gibt hier nicht nur Öl. Es gibt auch die großen Zuckerplantagen, die Gegend wird auch die Zuckerschale Amerikas genannt.«
»Jetzt brauchen wir nicht mehr in den Geschichtsunterricht zu gehen«, sagte Gisselle.
Daddys Miene verfinsterte sich. Offensichtlich konnte er sie mit nichts aufheitern. Er sah mich an, und ich zwinkerte ihm zu. Daraufhin lächelte er.
»Wie bist du überhaupt auf diese Schule gekommen?« erkundigte sie sich plötzlich. »Konntest du nicht eine Schule in der Nähe von New Orleans für uns finden?«
»Genaugenommen hat Daphne diese Schule gefunden. Sie ist in solchen Dingen auf dem laufenden. Es ist eine hochangesehene Schule, es gibt sie schon sehr lange, und sie hat auch eine weitreichende Tradition von vorzüglichen Leistungen. Sie wird durch Spenden und Lehrmittelstiftungen von reichen Leuten aus Louisiana finanziert, aber vorwiegend durch eine Stiftung, die ihr die Familie Clairborne durch das einzige noch lebende Familienmitglied übertragen hat, Edith Dilliard Clairborne.«
»Ich wette, sie ist ein eingetrocknetes Skelett von hundert Jahren«, sagte Gisselle.
»Sie ist etwa siebzig. Ihre Nichte Martha Ironwood ist das Verwaltungsoberhaupt. Das, was man als Rektorin bezeichnen würde. Ihr seht also, daß ihr genau in das hineingeratet, was wir die reiche Tradition des alten Südens nennen«, meinte Daddy voller Stolz.
»Es ist eine reine Mädchenschule, ohne Jungen«, versetzte Gisselle. »Wir könnten ebensogut in ein Nonnenkloster eintreten.«
Daddy lachte schallend. »Ich bin sicher, daß du dir völlig falsche Vorstellungen machst, Schätzchen. Ihr werdet es ja sehen.«
»Ich kann es kaum erwarten. Die Fahrt ist so langweilig, stell wenigstens das Radio an«, forderte Gisselle. »Und nicht einen dieser Sender, die Cajun-Musik spielen. Such die Hitparade.«
Daddy tat, was sie verlangte, doch statt ihre Stimmung zu verbessern, lullte die Musik sie ein, und während der restlichen Fahrt unterhielten Daddy und ich uns leise miteinander. Ich war immer wieder begeistert, wenn er ausnahmsweise bereit war, mir von seinen Ausflügen ins Bayou und von seiner Romanze mit meiner Mutter zu erzählen.
»Ich habe ihr viele Versprechen gegeben, die ich nicht halten konnte«, sagte er reumütig, »aber ein Versprechen werde ich halten: Ich werde dafür sorgen, daß ihr beide, du und Gisselle, immer nur das Beste bekommt. Natürlich«, fügte er lächelnd hinzu, »wußte ich nichts von deiner Existenz. Ich habe dein Erscheinen in New Orleans immer als ein Wunder angesehen, das ich nicht verdient habe. Ganz gleich, was seitdem alles passiert ist.«
Wie sehr ich ihn doch lieben gelernt hatte! Freudentränen traten in meine Augen. Das war etwas, das Gisselle nicht verstehen konnte. Mehr als einmal hatte sie versucht, mich dazu zu bringen, unseren Vater zu hassen. Ich nahm an, daß sie eifersüchtig auf die gute Beziehung war, die sich so schnell zwischen uns beiden entwickelt hatte.
Aber sie rief mir immer wieder ins Gedächtnis zurück, daß er meine Mutter im Bayou im Stich gelassen hatte; sie war schwanger geworden, als er schon mit Daphne verheiratet war. Und dann hatte er seine Sünden noch verschlimmert, indem er eingewilligt hatte, daß sein Vater das Baby kaufte.
»Was ist das für ein Mann, der so etwas tut?« fragte sie mich bei solchen Gelegenheiten und setzte mir mit ihren Fragen und Vorwürfen erbarmungslos zu.
»Menschen machen Fehler, wenn sie jung sind, Gisselle.«
»Das glaube ich nicht. Männer wissen genau, was sie tun und was sie von uns wollen«, pflegte sie zu sagen, ihre Augen wurden klein, ihr Ausdruck zynisch.
»Es tut ihm heute noch leid«, erklärte ich. »Und er bemüht sich zu tun, was er kann, um es wiedergutzumachen. Wenn du ihn liebst, dann wirst du tun, was du kannst, um sein Leiden zu verringern.«
»Das tue ich doch«, sagte sie fröhlich. »Ich helfe ihm, indem ich ihn dazu bringe, mir alles zu kaufen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe.«
Sie ist unverbesserlich, dachte ich. Noch nicht einmal Nina und ihre Voodoo-Königinnen wußten eine Litanei oder ein Pulver, die sie verändern könnten. Aber eines Tages würde ich sie ändern. Ich hatte das sichere Gefühl; ich wußte nur nicht, wodurch oder wann.
»Vor uns liegt Baton Rouge«, kündigte Daddy eine Weile später an. Die Turmspitzen des Kapitols im Innenstadtbereich ragten über den Bäumen auf. Ich sah riesige Ölraffinerien und Aluminiumfabriken am Ostufer des Mississippi. »Die Schule liegt weiter oben, ihr werdet von dort einen großartigen Ausblick haben.«
Gisselle wachte auf, als er vom Highway abbog und durch kleine Seitenstraßen weiterfuhr, vorbei an einer ganzen Reihe von imposanten Villen aus der Vorkriegszeit, die restauriert worden waren, zweistöckige Häuser mit Säulen davor. Wir fuhren an einem wunderschönen Wohnhaus mit Tiffany-Fenstern und einer Wippe auf der unteren Galerie vorbei. Zwei kleine Mädchen saßen darauf, beide mit goldbraunen Pferdeschwänzen; sie trugen identische rosafarbene Kleider und schwarze Lederschuhe mit Schnallen. Ich malte mir aus, daß sie Schwestern waren, und in meiner Phantasie sah ich mich und Gisselle gemeinsam in einem solchen Haus mit Daddy und unserer richtigen Mutter aufwachsen. Wie anders hätte alles sein können!
»Jetzt ist es nicht mehr weit«, sagte Daddy und wies mit einer Kopfbewegung auf einen Hügel. Als er um die nächste Kurve fuhr, kam die Schule in Sicht. Als erstes sahen wir in großen eisernen Buchstaben über dem Haupteingang, den zwei eckige Steinsäulen bildeten, den Namen GREENWOOD. Ein schmiedeeiserner Zaun schien sich meilenweit nach rechts und links zu ziehen. Ich sah blühende Knopfblumensträucher, deren dunkelgrünes Laub um die kleinen weißen Kugeln herum schimmerte. Über einen großen Teil des Zaunes rankten sich Klettertrompeten mit ihren orangefarbenen Blüten.
Zu beiden Seiten erstreckten sich sanft hügelige Rasenflächen, standen hohe Roteichen, Walnußbäume und Magnolien. Eichhörnchen sprangen von Ast zu Ast, als könnten sie fliegen. Ich sah einen roten Specht auf einem Zweig landen und zu uns herüber äugen. Überall gab es Gehwege aus Steinfliesen zwischen niedrigen Hecken und Brunnen, von denen manche mit kleinen steinernen Statuen von Eichhörnchen, Hasen und Vögeln versehen waren.
Ein riesiger Garten lag vor dem Hauptgebäude – ein Blumenbeet neben dem anderen: Tulpen, Geranien, Iris, goldgelbe Rosen und überwältigende Mengen von weißem, rosafarbenem und rotem Springkraut. Alles wirkte überaus gepflegt. Das Gras war so perfekt, als würde es von einer Armee mit Scheren bewaffneter Gärtner geschnitten. Nicht ein Zweig, nicht ein Blatt, nichts schien unordentlich zu sein. Es war, als seien wir in ein Gemälde geraten.
Vor uns ragte das Hauptgebäude auf. Es war ein zweistöckiges Haus aus alten Ziegeln und graugestrichenem Holz. Dunkelgrüne Efeuranken krochen an den Backsteinen hinauf und umrahmten die großen Sprossenfenster. Eine breite Steintreppe führte zu dem großen Säulengang vor dem Hauptportal. Rechts daneben war ein Parkplatz mit Schildern, auf denen RESERVIERT FÜR DEN LEHRKÖRPER und RESERVIERT FÜR BESUCHER stand. Im Moment war der Parkplatz so gut wie voll. Eltern und junge Mädchen trafen und begrüßten sich dort, alte Freunde erneuerten offensichtlich ihre Freundschaft. Es herrschte helle Aufregung. Gelächter erfüllte die Luft, und es waren nur strahlende Gesichter zu sehen. Mädchen umarmten und küßten einander, und alle redeten gleichzeitig.
Daddy fand eine Parklücke für uns und den Lieferwagen, aber Gisselle hatte bereits ihre nächste Beschwerde anzumelden.
»Wir sind viel zu weit vom Eingang entfernt, und wie soll ich überhaupt jeden Tag diese Treppe hinaufkommen? Das ist ja furchtbar.«
»Warte erst mal ab«, beschwichtigte sie Daddy. »Man hat mir gesagt, daß es einen eigens für Rollstuhlfahrer gebauten Eingang gibt.«
»Das ist ja toll. Wahrscheinlich bin ich die einzige. Alle werden zusehen, wie ich morgens ins Haus geschoben werde.«
»Es muß hier noch andere behinderte Mädchen geben, Gisselle. Nur für dich würden sie keinen eigenen Eingang bauen«, versicherte ich ihr, aber sie schaute nur finster auf den Trubel hinaus.
»Sieh dir das an. Jeder kennt jeden. Wir sind wahrscheinlich die einzigen Fremden in dieser ganzen Schule.«
»Unsinn«, sagte Daddy. »Schließlich gibt es hier einen ganzen Jahrgang von Erstsemestern, oder etwa nicht?«
»Wir sind keine Erstsemester. Wir sind im letzten Studienjahr«, erinnerte sie ihn barsch.
»Ich werde mich mal erkundigen, was wir als nächstes tun sollten«, sagte Daddy und öffnete seine Wagentür.
»Als nächstes sollten wir nach Hause fahren, wenn du mich fragst«, bemerkte Gisselle spitz. Daddy winkte unserem Lieferwagenführer zu, dann wandte er sich an eine Frau in einem grünen Kostüm, die einen Schreibblock in der Hand hielt.
»Also, gut«, sagte Daddy, als er zurückkam. »Es scheint alles ganz einfach zu sein. Gleich dort rechts ist der Eingang mit der Schräge, ohne Stufen. Zuerst geht ihr zur Anmeldung in der Eingangshalle, und dann begleite ich euch ins Studentenwohnheim.«
»Warum gehen wir nicht gleich ins Studentenwohnheim?« fragte Gisselle. »Ich bin müde.«
»Man hat mir gesagt, ich soll euch vorher dorthin bringen, damit ihr eure Unterlagen holen könnt, eine Mappe mit Informationen über eure Kurse, einen Lageplan des Geländes und dergleichen.«
»Ich brauche keinen Lageplan, ich werde mich sowieso immer nur in meinem Zimmer aufhalten«, sagte Gisselle.
»Oh, ganz bestimmt nicht, da bin ich sicher«, erwiderte Daddy. »Ich hole jetzt deinen Stuhl aus dem Lieferwagen, Gisselle.«
Sie kniff die Lippen zusammen, verschränkte die Arme und lehnte sich zurück. Ich stieg aus. Der Himmel war kristallblau, die Wolken waren flauschig und prall und sahen aus wie Zuckerwatte. Man hatte einen prächtigen Ausblick auf die Stadt hinunter und weit darüber hinaus, bis zum Mississippi, auf dem Boote und Schiffe flußaufwärts und flußabwärts fuhren. Ich kam mir vor wie auf dem Dach der Welt.
Daddy half Gisselle in ihren Rollstuhl. Sie war steif und unkooperativ und zwang ihn, sie buchstäblich auf den Stuhl zu heben. Als sie endlich saß, schob er sie langsam zur Eingangsrampe. Gisselle sah starr vor sich hin, und ihr Gesicht verzog sich zu einem Ausdruck hämischer Mißbilligung. Mädchen lächelten uns an, und einige von ihnen begrüßten uns, aber Gisselle tat so, als höre und sähe sie nichts.
Die Rampe führte uns durch einen Seiteneingang in die geräumige Eingangshalle mit Marmorfußboden, hoher Decke, enormen Kronleuchtern und einem großen Wandteppich hinten rechts, auf dem eine Zuckerplantage abgebildet war. Die Halle war so riesig, daß die Stimmen der Mädchen darin hallten. Sie hatten sich in drei langen Schlangen angestellt, und wer in welcher Schlange stand, hing ausschließlich vom Anfangsbuchstaben des Nachnamens ab. In dem Moment, in dem ihr Blick auf die Menschenmenge fiel, begann Gisselle zu stöhnen.
»Ich kann nicht so hier sitzen und warten«, klagte sie laut genug, daß etliche Mädchen, die in der Nähe standen, sie hören konnten. »In unserer Schule in New Orleans brauchen wir das nicht zu tun! Ich dachte, du hättest gesagt, man wüßte hier Bescheid über mich und würde auf meine Probleme Rücksicht nehmen.«
»Einen Moment«, sagte Daddy leise. Dann wandte er sich an einen großen, dünnen Mann mit Anzug und Krawatte, der die Mädchen in die Schlangen einwies und einigen von ihnen half, die Formulare auszufüllen. Nachdem Daddy mit ihm gesprochen hatte, schaute der Mann in unsere Richtung, und im nächsten Moment gingen er und Daddy an den Schalter, auf dem das Schild A-H stand. Daddy sprach mit der Lehrerin hinter unserem Schalter, und kurz darauf reichte sie ihm zwei Materialmappen. Er bedankte sich bei ihr und dem Mann, und dann kehrte er eilig zu uns zurück.
»Alles in Ordnung. Ich habe eure Unterlagen. Man hat euch beide im Louella-Clairborne-Haus untergebracht.«
»Was ist denn das für ein Name für ein Wohnheim?« sagte Gisselle.
»Es ist nach Mr. Clairbornes Mutter benannt worden. Es gibt drei Wohnheime, und Daphne hat mir versichert, daß ihr im besten von den dreien untergebracht seid.«
»Na, toll.«
»Danke, Daddy«, sagte ich und nahm ihm meine Unterlagen ab. Ich fühlte mich schuldbewußt, weil Gisselle und ich bevorzugt behandelt wurden, und ich wich den neidischen Blicken der anderen Mädchen, die noch in der Schlange warteten, aus.
»Hier ist deine Materialmappe«, sagte Daddy. Als sie sie ihm nicht abnahm, legte er sie Gisselle auf den Schoß. Dann wendete er ihren Rollstuhl und schob sie aus dem Gebäude.
»Man hat mir gesagt, im Hauptgebäude gebe es einen Aufzug. Sämtliche Toiletten sind mit Einrichtungen für Behinderte versehen, und zwischen den Kursen braucht ihr normalerweise das Stockwerk nicht zu wechseln, daher wird es euch keine großen Schwierigkeiten bereiten, rechtzeitig von einem Kurs zum anderen zu gelangen«, sagte Daddy.
Widerstrebend schlug Gisselle ihre Mappe auf. Die erste Seite war ein Willkommensgruß von Mrs. Ironwood, in dem uns wärmstens empfohlen wurde, das Einführungsmaterial Blatt für Blatt gründlich durchzulesen und uns insbesondere mit der Hausordnung vertraut zu machen.
Zwei der Wohnheime befanden sich rechts hinter dem Haus, und das dritte, unser Wohnheim, lag links hinter dem Hauptgebäude. Als wir langsam um das Hauptgebäude herum zu unserem Haus fuhren, schaute ich den Hang hinunter und sah das Bootshaus und den See. Ein breiter Streifen von tropischer Wasserpest zog sich von einem Ufer zum anderen, die von grünen Blättern umgebenen lavendelfarbenen Blüten waren bleich, die innersten Blütenblätter gelb gesprenkelt. Das Wasser blinkte wie eine polierte Münze. Zu unserer Linken, direkt hinter dem Hauptgebäude, befanden sich die Sportplätze.
»Was für ein wunderschönes Gelände«, sagte Daddy, »und so gepflegt.«
»Hier fühlt man sich wie in einem Gefängnis«, gab Gisselle zurück. »Man muß Meilen zurücklegen, ehe man auf Zivilisation stößt. Wir sitzen in der Falle.«
»Ach, Unsinn. Ihr werdet jede Menge zu tun haben. Ihr werdet euch nicht langweilen, das versichere ich euch«, beharrte Daddy.
Gisselle schmollte wieder einmal, als unser Wohnheim in Sicht kam. Das Louella-Clairborne-Haus, das wie das Wohnhaus einer alten Plantage konstruiert war, wurde durch hohe Eichen und Weiden, deren Zweige sich ungehindert ausbreiteten, fast gänzlich abgeschirmt. Das aus Zypressenholz errichtete Gebäude hatte eine untere und eine obere Galerie mit Balustraden und eckigen Säulen, die bis zum Giebeldach reichten. Als wir näher kamen, sahen wir die Rampe, die seitlich neben der vorderen Galerie angelegt worden war. Ich wollte es nicht sagen, aber diese Rampe erweckte ganz den Anschein, als sei sie eigens für Gisselle gebaut worden.
»Okay«, sagte Daddy. »Dann wollen wir euch mal unterbringen. Ich sage der Heimleiterin nur kurz Bescheid, daß wir da sind. Sie heißt Mrs. Penny.«
»Mehr ist sie wahrscheinlich auch nicht wert«, bemerkte Gisselle und lachte über ihren eigenen Sarkasmus.
Daddy stieg eilig die Stufen vor dem Haus hinauf und verschwand im Innern.
»Dir ist doch klar, daß du mich jeden Tag den weiten Weg von diesem Wohnheim zum Unterricht schieben mußt«, drohte Gisselle.
»Du kannst deinen Rollstuhl mühelos selbst hinrollen, Gisselle. Der Gehweg scheint absolut eben zu sein.«
»Das ist zu weit!« schrie sie. »Ich wäre schon erschöpft, wenn ich dort ankomme.«
»Wenn du geschoben werden mußt, dann werde ich dich eben schieben«, versicherte ich ihr seufzend.
»So ein Blödsinn.« Sie verschränkte die Arme und schaute finster auf die Fassade des Wohnheims. Wenig später tauchte Daddy mit Mrs. Penny auf, einer kleinen, rundlichen Frau mit grauem Haar, das sie sich zu dicken Zöpfen geflochten und um den Kopf geschlungen hatte. Ihr untersetzter Körper steckte in einem blau-weißen Kleid. Als sie näher kam, sah ich, daß sie unschuldige blaue Augen hatte, fröhlich und strahlend lächelte und Pausbacken hatte, die so aufgeblasen waren, daß ihre kleine Nase fast darin unterging. Sie klatschte in die Hände, als ich aus dem Wagen stieg.
»Willkommen, meine Liebe. Willkommen in Greenwood. Ich bin Mrs. Penny.« Sie hielt mir ihre kleine Hand mit den dicken Stummelfingern hin, und ich schüttelte sie.
»Danke«, sagte ich.
»Du bist Gisselle?«
»Nein, ich bin Ruby. Das ist meine Schwester Gisselle.«
»Ist ja toll; sie weiß noch nicht einmal, wer von uns beiden wer ist«, murrte Gisselle, die noch im Wagen saß. Falls Mrs. Penny sie gehört hatte, ließ sie es sich nicht anmerken.
»Das ist einfach wunderbar. Ihr seid meine beiden ersten Zwillinge, und ich bin schon seit mehr als zwanzig Jahren Heimleiterin im Louella-Clairborne-Haus. Hallo, meine Liebe«, sagte sie und beugte sich vor, um den Kopf in den Wagen zu strecken.
»Ich hoffe, wir haben ein Zimmer im Erdgeschoß«, fauchte Gisselle.
»Aber selbstverständlich, meine Liebe. Ihr seid im ersten Quadranten untergebracht, im Quadranten A.«
»Quadranten?«
»Unsere Zimmer sind um einen zentralen Studienbereich herum angeordnet. Jeweils vier Schlafzimmer teilen sich zwei Bäder und das Wohnzimmer«, erklärte Mrs. Penny. »Alle anderen Mädchen bis auf einen Neuzugang«, fügte sie hinzu, und ihr Lächeln erlosch und erstrahlte dann wieder, »sind bereits da. Sie sind alle im letzten Studienjahr, wie ihr beide. Sie können es kaum erwarten, euch kennenzulernen.«
»Und wir sterben auch schon vor Neugier«, gurrte Gisselle sarkastisch, als Daddy wieder mit ihrem Rollstuhl ankam. Er half ihr hinein, und wir begaben uns ins Haus.
Das Wohnheim hatte einen großen Aufenthaltsraum mit zwei breiten Sofas und vier hochlehnigen Polsterstühlen, die an zwei langen dunklen Holztischen standen. Neben den Sofas und Stühlen standen Stehlampen, und in den Ecken des Raumes noch kleinere Tische. In einer Ecke befanden sich ein kleines Zweiersofa und ein weiterer hochlehniger Stuhl vor einem Fernsehgerät. Vor den Fenstern hingen weiße Baumwollgardinen und hellblaue Vorhänge, und auf dem Hartholzboden lag ein großer, ovaler blauer Teppich. Die Rückwand zierte ein enormes Porträt von einer elegant aussehenden älteren Frau. Es war das einzige Gemälde im ganzen Raum.
»Das ist ein Bild von Mrs. Edith Dilliard Clairborne«, sagte Mrs. Penny mit ehrerbietiger Stimme und nickte. »Natürlich war sie damals noch wesentlich jünger«, fügte sie hinzu.
»Sie sieht da schon alt aus«, sagte Gisselle. »Wie mag sie dann erst heute aussehen?«
Mrs. Penny ging nicht darauf ein. Statt dessen setzte sie ihre Beschreibung des Hauses fort.
»Die Küche ist hinten im Haus«, erklärte sie. »Wir haben feste Zeiten für Frühstück und Abendessen, aber ihr könnt euch jederzeit zwischendurch eine Kleinigkeit holen, wenn ihr wollt. Ich bemühe mich, das Haus so zu führen, als seien wir alle eine große glückliche Familie«, sagte sie zu Daddy. Dann sah sie auf Gisselle herunter. »Ich fahre dich herum und zeige dir alles, sowie ihr euch eingerichtet habt. Euer Quadrant liegt gleich dort drüben«, fügte sie hinzu und wies auf den Korridor zu unserer Rechten. »Ich zeige euch zuerst einmal, wo ihr untergebracht seid, und dann holen wir eure Sachen. Wie war die Fahrt?«
»Angenehm«, sagte Daddy.
»Langweilig«, fügte Gisselle hinzu, aber Mrs. Penny ging nicht auf sie ein und lächelte unermüdlich weiter. Es war, als könnte sie unangenehme Dinge weder sehen noch hören.
An den Wänden des kurzen Korridors hingen Ölgemälde, die Straßenszenen in New Orleans darstellten, und dazwischen Porträts, von denen ich mir ausmalte, daß es sich um Angehörige der Familie Clairborne handelte. Zwei Kronleuchter an der Decke sorgten für Licht. Am Ende des Flurs lag das Wohnzimmer, das Mrs. Penny uns beschrieben hatte. Es war ein kleiner Raum, in dem vier Polsterstühle von derselben Sorte wie im Aufenthaltsraum standen, ein ovaler Tisch aus dunklem Kiefernholz, vier Schreibtische an der Rückwand und Stehlampen. Gelächter lenkte unsere Aufmerksamkeit auf die erste Tür rechts.
»Nun, warum fangen wir eigentlich nicht gleich damit an, euch den anderen vorzustellen?« sagte Mrs. Penny. »Jacqueline ... Kathleen.«
Ein Mädchen von mindestens einem Meter achtzig trat als erste aus dem Zimmer. An ihrer gebeugten Haltung sah ich deutlich, daß sie wegen ihrer Größe gehemmt war. Sie hatte ein schmales Gesicht mit einer langen spitzen Nase über einem kleinen Mund mit dünnen Lippen, die zu bleichen Gummibändern wurden, wenn sie sie hämisch verzog. Ich sollte schon bald dahinterkommen, daß ein hämisches Grinsen ihre liebste Miene war. Ihre Bitterkeit drückte sich in den mißbilligenden braunen Augen, die kaum mehr als Schlitze waren, noch stärker aus. Sie wirkte wie ein ungeladener Gast, der eine Party besucht, die für weitaus glücklichere Menschen veranstaltet wird.
»Das ist Jacqueline Gidot. Jacqueline, ich möchte dir Gisselle und Ruby Dumas und ihren Vater vorstellen.«
»Hallo«, sagte Jacqueline und sah schnell von mir zu Gisselle. Ich nahm an, daß man die Mädchen in unserem Quadranten vorgewarnt hatte, Gisselle sitze in einem Rollstuhl, aber natürlich war es wesentlich beeindruckender, ihr tatsächlich gegenüberzustehen.
»Hallo«, erwiderte ich. Gisselle nickte nur, doch sie blickte interessiert auf, als Jacquelines Zimmergenossin auftauchte.
»Und das ist Kathleen Norton.«
Kathleen hatte ein wärmeres Lächeln. Sie war aschblond und hatte etwa unsere Größe, aber wesentlich breitere Hüften und Schultern.
»Alle nennen mich Kate«, teilte sie uns eilig mit und kicherte.
»Oder Chubs«, warf Jacqueline trocken ein. Kate lachte nur. Mir schien es, als lachte sie nach fast allem, was sie sagte, und auch als Reaktion auf fast alles, was irgend jemand je über sie sagte. Es war wohl eher eine nervöse Reaktion. Ihre blauen Augen wurden groß, und sie wirkte nahezu ehrfürchtig, als sie Gisselle ansah, und ich wußte, daß das Gisselle gar nicht gefallen würde.
»Chubs?« schnaubte Gisselle.
»Sie ißt alles, was ihr in die Finger kommt, und sie hortet in unserem Zimmer Süßigkeiten wie ein Eichhörnchen«, erklärte Jacqueline abfällig.
Kate lachte. Sie sog Jacquelines Sarkasmus in sich auf wie ein Schwamm, lächelte und tat so, als habe sie nichts gehört.
»Willkommen in Greenwood.«
»Danke«, sagte ich.
»Welches ist unser Zimmer?« erkundigte sich Gisselle ungeduldig.
»Hier entlang«, zeigte Mrs. Penny. Als wir uns umdrehten, standen wir einer entzückenden Rotblonden gegenüber, die in der Tür des Zimmers lehnte, das an unseres grenzte.
»Das ist Samantha«, sagte Mrs. Penny.
»Hallo«, begrüßte uns Samantha. Sie wirkte um Jahre jünger als wir.
»Du bist im letzten Studienjahr?« fragte Gisselle. Die winzige Samantha nickte.
»Samantha kommt eigentlich aus Mississippi«, erklärte Mrs. Penny, als sei Mississippi nicht lediglich der benachbarte Staat, sondern ein ganz anderes Land. »Samantha, das sind Gisselle und Ruby Dumas und ihr Vater.«
»Hallo«, wiederholte sie.
Als wir jemanden durch die Eingangshalle nahen hörten, wandten wir unsere Aufmerksamkeit wieder dem Korridor zu. Ein Mädchen, das fleißig und eifrig wirkte, kam eilig in unseren Quadranten gelaufen. Ihr dunkelbraunes Haar war kinnlang geschnitten, und sie trug eine Brille mit schwarzem Gestell und dicken Gläsern, die ihre braunen Augen stark vergrößerten. Sie hatte grobgeschnittene, harte Gesichtszüge und war so blaß, daß sie schon krank wirkte, aber sie hatte einen großen Busen, fast so groß wie der von Mrs. Penny, und eine Figur, von der Jacqueline uns später sagen sollte, sie sei bei diesem Pferdegesicht die reinste Vergeudung.
»Victoria. Du kommst gerade rechtzeitig, um unsere neuen Mitbewohnerinnen kennenzulernen, Ruby und Gisselle Dumas«, sagte Mrs. Penny. »Das ist Samanthas Zimmergenossin«, erklärte sie uns.
»Hallo«, sagte ich. »Ich bin Ruby.«
Victoria setzte die Brille ab, ehe sie mir ihre schmale Hand entgegenstreckte. Ich schüttelte sie.
»Ich komme gerade aus der Bibliothek«, bemerkte sie atemlos. »Mr. Warden hat bereits einen Aushang mit seiner Literaturliste für europäische Geschichte gemacht.«
»Vicki ist wild entschlossen, nach diesem Schuljahr die Abschlußrede zu halten«, erklärte Jacqueline, die noch in ihrer Tür stand. »Andernfalls wird sie Selbstmord begehen.«
»Werde ich nicht«, gab Vicki zurück. »Es ist nur einfach klug, sich einen Vorsprung zu verschaffen«, sagte sie zu mir. Und dann schaute sie auf Gisselle herunter, auf deren Gesicht ein hämisches Grinsen stand. »Willkommen.«
»Danke.«
»Welches Zimmer haben wir denn nun?« stöhnte Gisselle.
»Hier entlang, meine Liebe.« Mrs. Penny führte uns zu der offenstehenden Tür. In dem Moment, in dem Daddy sie in das Zimmer schob, begann Gisselle zu jammern.
Zwei Einzelbetten standen nebeneinander, durch einen Nachttisch getrennt. An der rechten und der linken Wand war jeweils ein Kleiderschrank. Neben den Betten standen Kommoden aus dunklem Holz, so angeordnet, daß genügend Platz für Gisselles Rollstuhl zwischen Bett und Kommode blieb. Rechts neben der Tür stand eine kleine Frisierkommode mit einem Spiegel. Er hatte ein Viertel der Größe, die die Spiegel in unseren Zimmern in New Orleans hatten. Vor den Fenstern, über den Kopfenden der Betten, hingen schlichte Baumwollgardinen. Die Wände waren mit einer geblümten Tapete tapeziert und ansonsten völlig schmucklos. Der Fußboden war aus Hartholz.
»Das Zimmer ist viel zu klein! Hier ist schon für meine Sachen nicht genug Platz, von Rubys Zeug ganz zu schweigen.«
»Es freut mich, daß jemand anderes das auch so sieht«, rief Jacqueline.
»Mach dir deshalb bloß keine Sorgen, meine Liebe«, beschwichtigte Mrs. Penny. »Ich habe Lagerraum, den ich dir zur Verfügung stellen kann.«
»Ich habe meine Sachen doch nicht mitgebracht, um sie hier einzulagern. Ich habe sie dabei, um sie zu benutzen.«
»Ach, du meine Güte«, sagte Mrs. Penny und blickte Daddy an.
»Das wird schon in Ordnung gehen«, versicherte er ihr. »Wir bringen zuerst das Allernotwendigste ins Haus und dann ...«
»Es ist alles absolut notwendig«, erklärte Gisselle erbarmungslos.
»Vielleicht kann sie auch in Abbys Zimmer noch ein paar Sachen unterbringen«, schlug Mrs. Penny vor. »Abby hat ein Zimmer für sich allein«, fügte sie hinzu.
»Wer ist Abby? Wo steckt sie?« erkundigte sich Gisselle unfreundlich.
»Sie ist noch nicht hier eingetroffen. Sie ist das andere neue Mädchen hier«, sagte Mrs. Penny und wandte sich direkt an Daddy, der nickte. »Wie dem auch sei, dein kleines Herzchen braucht sich nicht zu sorgen, denn die gute Mrs. Penny ist da, damit alles reibungslos abläuft und ihre Mädchen glücklich sind. Ich mache das schon seit langem«, sagte sie lächelnd.
Gisselle schmollte.
»Ich werde jetzt die Sachen reinbringen«, sagte Daddy.
»Soll ich dir helfen, Daddy?« fragte ich.
»Nein. Bleib du bei deiner Schwester«, antwortete er und zog die Augenbrauen hoch. Ich nickte, und er ging mit Mrs. Penny hinaus.
Jacqueline, Kate, Samantha und Vicki versammelten sich in unserer Tür.
»Warum hast du soviel mitgebracht?« fragte Vicki. »Hast du denn nicht gewußt, daß du keine große Garderobe brauchst? Wir tragen hier Schuluniformen.«
»Ich denke gar nicht daran, eine Schuluniform zu tragen!« schrie Gisselle.
»Das mußt du aber«, lachte Kate.
»Muß ich nicht. Ich kann es nicht. Ich habe meine speziellen Probleme«, erklärte Gisselle. »Ich bin sicher, mein Vater wird dafür sorgen, daß ich meine eigene Kleidung tragen darf, und in diesen Schränken ist einfach nicht genug Platz für all meine Sachen. Ich muß sie in den Koffern lassen, und die nehmen uns in dem kleinen Zimmer noch mehr Platz weg.«
Vicki zuckte die Achseln. »Allzuviel Zeit verbringt ihr ohnehin nicht in eurem Zimmer«, verkündete sie. »Meistens werdet ihr hier draußen sein und eure Arbeiten machen.«
»Du arbeitest die meiste Zeit«, sagte Jacqueline. »Wir nicht. Also, aus welchem Teil von Louisiana kommt ihr beiden?«
»Aus New Orleans«, sagte ich. »Aus dem Garden District.«
»Da ist es wunderschön«, warf die puppenhafte Samantha ein. »Mein Daddy ist letztes Jahr mit mir dort gewesen. Vielleicht bin ich sogar an eurem Haus vorbeigelaufen.«
Gisselle drehte ihren Rollstuhl um, damit sie die Mädchen genauer ansehen konnte.
»Und woher stammt ihr alle?«
»Ich komme aus Shreveport«, antwortete Jacqueline. »Chubs ist aus Pineville, und Vicki kommt aus Lafayette.«
»Mein Vater und ich leben in Natchez«, meinte Samantha.
»Was ist mit deiner Mutter?« fragte Gisselle.
»Sie ist vor zwei Jahren bei einem Autounfall umgekommen.« Sie biß sich auf die Unterlippe.
»Auf die Art bin ich zum Krüppel geworden«, sagte Gisselle zornig. Es war, als glaubte sie, an allen Unfällen seien nur die Autos und nie die Menschen schuld. »Wenn du aus Mississippi stammst, wie kommt es dann, daß du hier zur Schule gehst?« fragte sie.
»Mein Vater kommt aus Baton Rouge.«
»Sind eure Zimmer auch so klein?« fragte Gisselle und sah sich um.
»Ja«, bestätigte Jacqueline.
»Wie kommt es, daß diese Abby ein Zimmer für sich allein hat?« erkundigte sich Gisselle.
»Es hat sich eben so ergeben«, sagte Kate und lachte. »Vielleicht haben sie es ausgelost.«
»Vielleicht will sich aber auch niemand mit ihr ein Zimmer teilen. Wir kennen sie auch noch nicht«, fügte Jacqueline hinzu.
»Du glaubst doch nicht, daß sie ...« setzte Kate an.
»Nein«, sagte Jacqueline. »Die werden in Greenwood nicht aufgenommen, ganz gleich, wer dagegen protestiert. Das hier ist eine. Privatschule«, fügte sie nicht ohne Stolz hinzu.
»Sie sollte langsam mal kommen«, sagte Vicki. »In einer Stunde beginnt die Einführungsversammlung.«
»Was für eine Einführungsversammlung?« fragte Gisselle eilig.
»Hast du die erste Seite deiner Mappe denn noch nicht gelesen? Die Eiserne Jungfrau hält immer eine Versammlung ab, damit sie uns kennenlernt und wir sie.«
»Und auf dieser Versammlung liest sie uns die Leviten«, fügte Jacqueline hinzu. »Und spuckt Feuer und Schwefel.«
»Die Eiserne Jungfrau?« fragte ich.
»Wenn du sie erst einmal gehört und gesehen hast, wirst du wissen, warum wir sie so nennen«, erwiderte Jacqueline.
»All diese blöden Vorschriften, die hier aufgelistet sind, werden doch nicht etwa ernst genommen?« fragte Gisselle und hob ihre Mappe hoch.
»O doch, und du solltest dir genau durchlesen, wofür du einen Tadel bekommst. Chubs kann euch eine ganze Menge darüber erzählen«, sagte Jacqueline und wies mit einer Kopfbewegung auf Kate.
»Wieso?« fragte ich.
»Ich habe letztes Jahr zehn bekommen und mußte einen ganzen Monat lang das Bad und die Toiletten schrubben«, klagte sie. »Und laßt euch bloß von niemandem erzählen, Mädchen seien sauberer und ordentlicher als Jungen. Sie hinterlassen Bäder und Toiletten in einem ekelhaften Zustand. «
»Mich werdet ihr niemals Bäder und Toiletten schrubben sehen«, verkündete Gisselle.
»Ich bezweifle, daß sie dir diese Strafen auferlegen würde«, sagte Vicki.
»Warum?« fragte Gisselle mit scharfer Stimme. »Weil ich im Rollstuhl sitze?«
»Ja, natürlich«, sagte Vicki unerschrocken. Gisselle dachte einen Moment lang darüber nach, und dann lächelte sie. »Vielleicht ist das gar nicht einmal so schlecht. Vielleicht wird man mir viel mehr durchgehen lassen als euch.«
»Darauf würde ich mich nicht verlassen«, riet Jacqueline.
»Und warum nicht?«
»Wenn du der Eisernen Jungfrau erst einmal begegnet bist, wirst du wissen, warum.«
»So schlimm ist es nun auch wieder nicht«, sagte Samantha. »Das hier ist eben eine gute Schule. Und wir haben auch unseren Spaß.«
»Was ist mit Jungen?« erkundigte sich Gisselle. Samantha errötete. Sie schien auf der Grenze, die Kindheit und Pubertät voneinander trennt, stehengeblieben zu sein, jemand, der sich von der eigenen Sexualität schockieren und verwirren ließ. Später sollte ich dahinterkommen, daß sie von ihrem Vater in übertriebenem Maß beschützt und verwöhnt wurde.
»Was soll mit denen sein?« fragte Vicki.
»Trefft ihr jemals irgendwelche Jungen?« fragte Gisselle rundheraus.
»Ja, natürlich. Bei allen Veranstaltungen. Jungen aus einer reinen Jungenschule werden dazu eingeladen. Und einmal im Monat findet ein Tanzabend statt.«
»Das ist ja toll! Einmal im Monat, wie die Periode«, witzelte Gisselle.
»Wie was?« fragte Samantha. Kate kicherte, und Jacqueline grinste hämisch.
»Die Periode«, wiederholte Gisselle. »Du weißt doch, was das ist, oder hast du deine etwa noch nicht?«
»Gisselle«, rief ich aus, aber da war Samanthas Gesicht schon leuchtend rot angelaufen, und die anderen Mädchen lachten.
»Oh, das ist aber schön«, sagte Mrs. Penny. Sie folgte Daddy und unserem Fahrer, die mit ein paar von unseren Sachen kamen. »Die Mädchen kommen schon gut miteinander aus. Ich habe Ihnen ja gesagt, daß es keine Probleme geben wird.«