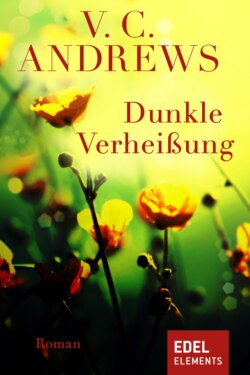Читать книгу Dunkle Verheißung - V.C. Andrews - Страница 8
3. Wir müssen miteinander auskommen
ОглавлениеEine halbe Stunde ehe wir uns alle auf den Weg zum Hauptgebäude machen mußten, um Mrs. Ironwoods Versammlung zu besuchen, traf Abby Tyler in Begleitung ihrer Eltern ein. Ich fand, sie sei die Hübscheste von uns allen. Sie hatte etwa meine Größe, aber sie war schlank und hatte ein zart geschnittenes Gesicht wie Audrey Hepburn, türkisfarbene Augen und dichtes Haar, so schwarz wie Ebenholz, das ihr bis auf die Schultern fiel. Ihr gesunder dunkler Teint war nahezu mockafarben und schien darauf hinzuweisen, daß sie weit mehr Zeit am Strand verbracht hatte als wir übrigen.
Sie redete mit einer melodischen Stimme, verschluckte Silben und sprach doch deutlich und mit einem leicht französischen Tonfall, den sie von ihrer Mutter haben mußte. Sie lächelte mich an, und ihre Freundlichkeit schien mir aufrichtig zu sein. Wie wir war sie unsicher und gehemmt, da sie neu in Greenwood war.
Nachdem sie allen Mädchen vorgestellt worden war, fragte Mrs. Penny sie, ob es sie stören würde, wenn Gisselle einige Sachen in ihrem Zimmer unterbrächte. Ich wußte, daß Gisselle nicht den Anschein erwecken wollte, jemanden um etwas zu bitten, aber Abby erwies sich als sehr entgegenkommend.
»Nein, natürlich habe ich nichts dagegen«, sagte sie und lächelte Gisselle an. »Komm einfach rein, und bring bei mir unter, soviel du willst.«
»Ich finde die Vorstellung abscheulich, daß ich mich von einem Zimmer ins andere begeben muß, um an meine eigenen Sachen zu kommen«, jammerte Gisselle.
»Du sagst mir einfach, was du willst, und ich hole es dir«, sagte ich.
»Ich bringe dir deine Sachen aber auch gern«, erbot sich Abby. Sie sah mich an, und ich fühlte mich augenblicklich mit diesem freundlichen dunkelhaarigen Mädchen verbunden.
»Dann muß ich also ständig darum betteln, daß andere Leute mir meine eigenen Sachen holen oder bringen«, fuhr Gisselle mit schriller Stimme fort. Ich sah sie schon einen ihrer Anfälle bekommen und Daddy in Verlegenheit bringen.
»Du brauchst nicht zu betteln. Wie kannst du nur so albernes Zeug reden. Wenn man jemanden um eine Gefälligkeit bittet, dann hat das noch lange nichts mit Betteln zu tun«, sagte ich.
»Mir macht es nichts aus, dir etwas zu bringen«, meinte Abby. »Wirklich nicht.«
»Und warum nicht?« fauchte Gisselle sie an, statt ihr dankbar zu sein. »Übst du etwa schon, weil du später einmal bei anderen Leuten Hausmädchen werden willst?«
Das Blut wich aus Abbys Gesicht.
»Gisselle! Warum kannst du nicht so gnädig sein, die Freundlichkeit anderer dankbar hinzunehmen?«
»Weil ich nicht von der Freundlichkeit anderer abhängig sein will«, schrie sie mich an. »Ich will mich auf meine eigenen Beine verlassen können.«
»Ach du meine Güte«, stöhnte Mrs. Penny und preßte sich die Handflächen auf die Pausbacken. »Ich will doch nur, daß alle glücklich sind.«
»Es ist schon gut, Mrs. Penny. Wenn Abby bereit ist, meiner Schwester in ihrem Zimmer Platz zur Verfügung zu stellen, dann wird sie wirklich froh darüber sein«, sagte ich und funkelte Gisselle wütend an.
Frustriert fiel sie über Daddy her, sobald unsere Dinge ins Haus gebracht worden waren; sie beklagte sich bei ihm darüber, daß sie eine Schuluniform tragen sollte, vor allem, nachdem sie sie gesehen hatte: ein graubrauner Rock, eine graubraune Hose und schwarze Schuhe mit plumpen Absätzen. Die Kleidungsvorschriften auf dem zweiten Blatt unserer Mappe besagten außerdem ausdrücklich, daß Schminke verboten war, sogar Lippenstift, ebenso wie allzu auffälliger Schmuck.
»Ich bin den ganzen Tag an diesen gräßlichen Rollstuhl gefesselt«, protestierte Gisselle, »und jetzt muß ich auch noch diese furchtbaren, unbequemen Kleider tragen. Ich habe den Stoff angefaßt. Er ist zu rauh für meine Haut. Und in diesen häßlichen Schuhen werden mir die Füße weh tun. Sie sind zu schwer für mich.«
»Ich werde jemanden finden, mit dem ich darüber reden kann«, sagte Daddy und verließ eilig unser Zimmer. Fünfzehn Minuten später kam er zurück, um Gisselle zu berichten, daß es ihr unter den gegebenen Umständen gestattet war, alles zu tragen, worin sie sich wohl fühlte.
Gisselle sank auf ihren Rollstuhl zurück und schmollte. Trotz all ihrer Bemühungen, die Dinge zu verkomplizieren und uns die Ankunft in Greenwood zu erschweren, fand immer wieder jemand eine Möglichkeit, sie zu beschwichtigen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.
Daddy wollte sich jetzt von uns verabschieden und aufbrechen.
»Ich weiß, daß ihr beide hier gut zurechtkommen werdet. Alles, worum ich euch bitte«, sagte er und schaute auf Gisselle herunter, »ist, daß ihr dieser Schule eine echte Chance gebt.«
»Ich hasse diese Schule jetzt schon«, schleuderte sie ihm entgegen. »Das Zimmer ist zu klein. Der Weg zum Unterricht ist zu weit. Was tue ich denn, wenn es regnet?«
»Was alle anderen auch tun, Gisselle. Du wirst einen Regenschirm aufspannen«, erwiderte er. »Du bist kein zerbrechliches Porzellanpüppchen, und du wirst nicht aufweichen.«
»Wir werden schon zurechtkommen, Daddy«, versprach ich ihm.
»Du vielleicht«, fauchte Gisselle. »Ich nicht.«
»Wir werden beide zurechtkommen«, beharrte ich.
»Ich muß jetzt gehen, und ihr beide habt auch zu tun«, sagte Daddy. Er beugte sich vor, um Gisselle einen Kuß zu geben und sie zu umarmen. Sie wandte sich ab. Ich sah, wie unglücklich das Daddy machte, und daher umarmte und küßte ich ihn liebevoller als sonst.
»Mach dir keine Sorgen«, flüsterte ich, während meine Arme noch um seinen Hals geschlungen waren. »Ich werde auf sie aufpassen und dafür sorgen, daß sie die Kartoffel nicht zu schnell fallen läßt«, fügte ich hinzu. Daddy wußte, daß das ein alter Ausdruck der Cajun für »aufgeben« war. Er lachte.
»Ich rufe euch in ein oder zwei Tagen an«, versprach er. Er verabschiedete sich von den anderen Mädchen und ging gemeinsam mit Abbys Eltern. Sowie sie weg waren, erklärte Vicki, wir müßten jetzt zur Versammlung im Hauptgebäude aufbrechen. Das löste bei Gisselle eine Schimpftirade über die große Entfernung aus, die sie vom Wohnheim zum Hauptgebäude zurücklegen mußte.
»Man müßte mir einen Wagen zur Verfügung stellen und mich zur Schule und wieder zurück fahren«, erklärte sie.
»So weit ist es nun auch wieder nicht, Gisselle.«
»Das kannst du leicht sagen«, entgegnete sie. »Du kannst rennen, wenn du willst.«
»Ich schiebe dich gern«, erbot sich Samantha.
Gisselle blitzte sie wütend an. »Ruby wird mich schieben«, sagte sie mit scharfer Stimme.
»Aber wenn es mal vorkommen sollte, daß Ruby dich nicht schieben kann, dann tue ich es eben«, erwiderte Samantha fröhlich.
»Und warum? Belustigt es dich?« schleuderte ihr Gisselle ins Gesicht.
»Nein«, sagte Samantha bestürzt. Sie sah schnell von einer zur anderen. »Ich meinte doch nur ... «
»Wir sollten jetzt gehen«, sagte Vicki und schaute nervös auf ihre Armbanduhr. »Zu einer von Mrs. Ironwoods Versammlungen kommt man nicht zu spät. Und wer es doch tut, den schreit sie vor der versammelten Schule an; das gibt einen doppelten Tadel.«
Wir machten uns auf den Weg; Abby lief neben mir und hinter Gisselle her.
»Weshalb bist du für dein letztes Schuljahr nach Greenwood gekommen?« fragte ich sie.
»Meine Eltern sind umgezogen, und die Schule, die ich ursprünglich hätte besuchen sollen, hat ihnen nicht gefallen«, erklärte sie, doch dabei wandte sie den Blick ab, und ich nahm zum erstenmal wahr, daß sie nicht durch und durch aufrichtig war. Ich dachte mir, daß ihre wahren Gründe, wie auch immer sie aussehen mochten, wahrscheinlich so schmerzlich waren wie unsere, und daher verfolgte ich das Thema nicht weiter.
»Das ist ein sehr hübsches Medaillon«, sagte sie, als sie sich wieder zu mir umwandte.
»Danke. Mein Freund hat es mir heute morgen geschenkt. Es ist ein Bild von ihm und eins von mir drin. Sieh es dir ruhig an«, sagte ich. Ich blieb stehen und beugte mich vor.
»Warum bleibt ihr stehen?« fragte Gisselle, obwohl sie unser Gespräch belauscht hatte und genau wußte, warum wir stehengeblieben waren.
»Nur für einen Moment. Ich möchte Abby das Bild von Beau zeigen.«
»Und weshalb das?«
Ich ließ das Medaillon aufschnappen, und Abby warf einen schnellen Blick auf die Bilder.
»Er sieht sehr gut aus«, bemerkte sie.
»Und genau deshalb ist er wahrscheinlich jetzt schon mit einem anderen Mädchen zusammen«, sagte Gisselle. »Ich habe ihr gleich gesagt, daß sie damit rechnen muß.«
»Hast du auch einen Freund zu Hause zurückgelassen?« fragte ich. Ich ignorierte Gisselle.
»Ja«, sagte Abby betrübt.
»Vielleicht kommt er ja her und besucht dich, vielleicht schreibt er oder ruft dich sogar an«, versuchte ich sie zu trösten.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das wird er ganz bestimmt nicht tun.«
»Warum nicht?«
»Er wird es eben nicht tun«, antwortete sie. Ich blieb stehen, aber sie beschleunigte ihre Schritte, um die anderen Mädchen einzuholen.
»Was hat sie bloß?« fragte Gisselle.
»Ich nehme an, sie hat Heimweh«, sagte ich.
»Das kann ich ihr nicht verdenken. Hier könnte sogar ein Waisenkind Heimweh bekommen«, fügte sie hinzu und lachte über ihre eigene Übertreibung. Ich lachte nicht. Ich war in dem Glauben hierhergekommen, ich sei diejenige mit der mysteriösesten Vorgeschichte und den meisten Geheimnissen, aber binnen weniger als einer Stunde hatte ich entdeckt, daß dem nicht so sein würde. Es schien, als könnten in Abbys Vergangenheit noch mehr Türen verschlossen sein als in meiner. Ich fragte mich, ob es mir je gestattet sein würde, das herauszufinden.
»Sieh zu, daß wir die anderen einholen«, ordnete Gisselle an. »Du schiebst mich wie eine alte Dame.«
Wir holten die anderen ein, und während wir unseren Weg zum Hauptgebäude fortsetzten, wandte sich unser Gespräch den Dingen zu, die wir in den Ferien taten, den Filmen, die wir gesehen hatten, den Städten, in denen wir gewesen waren, und den Sängern und Schauspielern, für die wir schwärmten.
Gisselle dominierte bei jedem dieser Themen das Gespräch und verlieh ihren Meinungen deutlichen Nachdruck, Meinungen, denen sich vor allem Samantha anschloß; sie hing an Gisselles Lippen, starrte sie verzückt an, kostete alles, was Gisselle sagte, genüßlich aus und öffnete sich wie eine kleine Blüte, die begierig auf die Wärme und das Licht der Sonne ist. Mir fiel auf, daß Abby sehr still war und daß ein sanftes Lächeln um ihre Lippen spielte, während sie den anderen zuhörte.
Als wir das Hauptgebäude erreicht hatten, beschlossen alle, Gisselle auf der Rampe in das Gebäude zu begleiten, und ich sah ihr an, daß ihr das gut gefiel. Sie wurde behandelt, als sei sie jemand ganz Besonderes.
Zwei Lehrer, Mr. Foster und Mr. Norman, standen an den beiden Eingängen zum Hörsaal und sorgten dafür, daß alles zügig ablief.
»Wir nehmen den linken Eingang«, bestimmte Vicki.
»Warum?« fragte Gisselle. Da sie sich jetzt mit der Tatsache abfinden mußte, hier in Greenwood zu sein, würde sie sich darauf verlegen zu fragen, warum etwas, das schwarz war, nicht weiß sein konnte.
»Dort sind die Plätze, die uns zugewiesen worden sind«, erwiderte Vicki. »Das wird alles in deiner Mappe erklärt. Hast du denn noch gar nicht darin gelesen?«
»Nein, ich habe noch gar nicht darin gelesen«, ahmte Gisselle Vickis herablassenden Tonfall nach. »Und überhaupt kann mir kein Sitzplatz zugewiesen worden sein. Ich sitze im Rollstuhl, oder ist dir das noch nicht aufgefallen?«
»Natürlich ist es mir aufgefallen. Trotzdem solltest du bei uns bleiben«, fuhr Vicki geduldig fort. »So organisiert Mrs. Ironwood nun einmal ihre Versammlungen. Die Plätze werden uns nach Wohnheimen und Quadranten zugewiesen.«
»Und was steht sonst noch in dieser tollen Mappe? Wann wir auf die Toilette gehen sollen?«
Vicki wurde bleich und ging voran. Wir begaben uns eine nach der anderen zu unseren Plätzen. Gisselle blieb im Gang auf ihrem Rollstuhl sitzen, und ich nahm den äußersten Sitzplatz, um an ihrer Seite bleiben zu können. Abby setzte sich neben mich. Um uns herum lachten die Mädchen und plauderten, und viele sahen interessiert in unsere Richtung. Aber ganz gleich, wer Gisselle anlächelte, sie weigerte sich zurückzulächeln. Als das Mädchen, das an der anderen Seite des Ganges saß, sich mehrfach nach ihr umsah, riß Gisselle ihr fast den Kopf ab.
»Was starrst du denn so? Hast du noch nie jemanden in einem Rollstuhl sitzen sehen?«
»Ich habe nicht gestarrt.«
»Gisselle«, sagte ich leise und legte eine Hand auf ihren Arm. »Mach keine Szene.«
»Und warum nicht? Was ändert das schon?« gab sie zurück.
Jacqueline winkte Freundinnen zu, und auch Vicki, Kate und Samantha machten anderen Zeichen. Dann begann Jacqueline uns auf einzelne Mädchen hinzuweisen und uns in Kurzform ihre Meinung mitzuteilen.
»Das ist Deborah Stewart. Sie ist so hochnäsig, daß sie jeden Tag Nasenbluten bekommt. Und das ist Susan Peck. Ihr Bruder ist in Rosedown; er sieht so gut aus, daß alle sich bei ihr einschmeicheln wollen, weil sie hoffen, daß sie sie ihrem Bruder vorstellen wird, wenn seine Schule zu einer unserer Veranstaltungen eingeladen wird. Oh, und da ist Camille Ripley. Es sieht ganz so aus, als hätte sie ihre Eltern dazu gebracht, ihr die Nasenoperation zu bezahlen, stimmt’s, Vicki?«
»Ich habe ganz vergessen, wie sie vorher ausgesehen hat«, sagte Vicki trocken.
Plötzlich senkte sich Schweigen über die Versammlung. Es setzte hinten ein und bahnte sich von einer Reihe zur nächsten seinen Weg nach vorn. Mrs. Ironwood stolzierte durch den Gang.
»Da ist die Eiserne Jungfrau«, flüsterte Jacqueline vernehmlich und wies mit einer Kopfbewegung in ihre Richtung. Wir sahen sie die wenigen Stufen zur Bühne vorn in der Aula hochsteigen.
Mrs. Ironwood schien nicht viel größer als eins fünfundsechzig zu sein. Sie war stämmig und hatte graues Haar, das sie streng zurückgebürstet und zu einem dicken Knoten aufgesteckt hatte. Um ihren Hals hing an einer silbernen Kette eine Brille mit Perlmuttgestell. Sie trug eine dunkelblaue Weste, eine weiße Bluse, einen knöchellangen Rock und schwarze Schuhe mit plumpen Absätzen. Mit zurückgezogenen Schultern und hocherhobenem Kopf ging sie energisch weiter, bis sie das Podium auf der Mitte der Bühne erreicht hatte. Als sie sich zu der Versammlung umdrehte, war kein Laut zu vernehmen.
»Wie kommt es, daß sie nicht auch diese häßliche Schuluniform tragen muß?« murrte Gisselle.
»Psst«, zischte Vicki.
»Guten Tag, Mädchen. Ich heiße euch in Greenwood zu einem Schuljahr willkommen, von dem ich erwarte, daß es für euch alle wieder einmal ein erfolgreiches sein wird.« Sie unterbrach sich, setzte die Brille auf und schlug ihren Ordner auf. Dann blickte sie auf, wandte sich in unsere Richtung und sah uns direkt an. Sogar auf diese Entfernung konnte ich sehen, daß ihre Augen kalt wie Stahl waren. Sie hatte dichte Augenbrauen, einen harten Mund und Kiefer, die aus Granit gemeißelt zu sein schienen.
»Zu Beginn möchte ich die Mädchen willkommen heißen, die neu bei uns sind. Ich weiß, daß ihr übrigen tun werdet, was ihr könnt, um ihnen die Ankunft zu erleichtern, daß ihr ihnen helfen werdet, sich mit unserer Schule vertraut zu machen und sich reibungslos hier einzuleben. Denkt immer daran: Ihr alle wart einmal neu hier. Als nächstes möchte ich drei neue Mitglieder des Lehrkörpers vorstellen. Mr. Rissel unterrichtet Englisch für Erstsemester«, sagte sie und sah nach rechts, wo ein Teil des Kollegiums saß.
Ein großer, schlanker, blonder Mann von etwa vierzig Jahren erhob sich und nickte der Versammlung zu.
»Monsieur Marabeau unterrichtet Französisch für Fortgeschrittene«, fuhr sie mit einem perfekten französischen Akzent fort. Ein kleingewachsener, stämmiger, dunkelhaariger Mann mit einem Schnurrbart stand auf und verbeugte sich vor der Versammlung.
»Und schließlich Miss Stevens, unsere neue Kunstlehrerin«, sagte sie, und aus ihrer Stimme war etwas mehr Strenge herauszuhören.
Eine attraktive Brünette, die nicht älter als achtundzwanzig oder neunundzwanzig sein konnte, stand auf. Sie hatte ein warmes, freundliches Lächeln, aber sie schien sich in ihrem Tweedkostüm und den hochhackigen Schuhen unwohl zu fühlen.
»Warte nur, bis sie von deinen Gemälden hört und dahinterkommt, wie begabt du bist«, spottete Gisselle. Sämtliche Mädchen in unserer Reihe drehten sich zu ihr um, aber Mrs. Ironwood wandte den Blick ebenfalls in unsere Richtung. Ich spürte den Stachel ihres stummen Vorwurfs.
»Psst«, warnte Vicki.
»Und jetzt wollen wir uns noch einmal unseren Vorschriften für das Betragen zuwenden«, fuhr Mrs. Ironwood fort und blickte weiterhin zu uns. Mein Herz pochte heftig, aber Gisselle sah Mrs. Ironwood nur finster an.
»Wie ihr wißt, erwarten wir von allen, daß sie ihre Arbeit ernst nehmen. Folglich ist ein Notendurchschnitt unter drei minus indiskutabel. Falls eine von euch unter diese Akzeptanzschwelle sinken sollte, verliert ihr all eure sozialen Privilegien, bis ihr euren Notendurchschnitt verbessert habt.«
»Was für soziale Privilegien?« fragte Gisselle, wieder ein wenig zu laut. Mrs. Ironwood blickte von ihrem Ordner auf und sah in unsere Richtung. »Ich erwarte, daß ihr still seid, solange ich rede. In Greenwood wird Respekt vor den Lehrern und den anderen Mitarbeitern verlangt. Wir haben keine Zeit für Gehorsamsverweigerung im Unterricht oder in unterrichtsähnlichen Situationen, und wir werden sie nicht dulden. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«
Ihre Worte hallten in der Totenstille des Saales wider. Mrs. Ironwood senkte zwar ihre Stimme, als sie fortfuhr, aber ihre Konsonanten blieben schneidend.
»Ich rate euch allen, euch Seite zehn in euren Einführungsmappen anzusehen und euch die Vorschriften einzuprägen, die dort aufgeführt sind. Wenn ihr diese Liste lest, werdet ihr feststellen, daß der Besitz von alkoholischen Getränken jeder Art und von Drogen eine sofortige Verweisung von der Schule nach sich zieht. Eure Eltern wissen, daß das eine Einbuße des Schulgeldes bedeutet, das sie für euch bezahlt haben. Laute Musik, Rauchen und jeder Akt von Vandalismus werden schwer bestraft. Letztes Jahr war ich, was die Kleidungsvorschriften angeht, etwas nachsichtiger, als ich es hätte sein sollen. Falls ihr nicht im voraus eine Sondergenehmigung eingeholt habt, werdet ihr eure Schuluniformen tragen und dafür sorgen, daß sie immer sauber und frisch gebügelt sind, und von Kosmetik ist abzusehen. Unter attraktivem Aussehen verstehen wir in Greenwood Reinlichkeit und ordentliche Kleidung und nicht etwa, daß ihr euch das Gesicht anmalt.«
Sie unterbrach sich und lächelte kalt.
»Es freut mich, euch mitteilen zu können, daß wir in diesem Jahr so viele Tanzveranstaltungen abhalten können wie im letzten Jahr. Es ist nur zu ein oder zwei Fällen von unangemessenem Benehmen gekommen, und dieser Missetäter konnten wir uns schnell annehmen, ehe sie allen anderen den Abend verdorben haben. Von euch wird erwartet, daß ihr euch anständig benehmt, wenn ihr an den Besuchstagen Gäste habt. Solange eure Gäste sich auf diesem Schulgelände aufhalten, haben sie sich an unsere Regeln und Vorschriften zu halten, als seien sie hier Schüler. Das gilt nicht nur für weibliche, sondern auch für männliche Besucher«, betonte sie. »Ich erinnere euch noch einmal daran«, fuhr sie bedächtig fort und zog die Schultern zurück, ehe sie zur Decke blickte, »daß ihr jetzt alle Greenwood-Schülerinnen seid, und Greenwood-Schülerinnen sind etwas ganz Besonderes. Den Neuankömmlingen empfehle ich, sich unseren Wahlspruch einzuprägen: Ein Greenwood-Mädchen sieht seinen Körper und seinen Geist als heilig an und weiß, daß alles, was es tut, auf uns alle zurückfällt. Seid stolz darauf, Greenwood-Mädchen zu sein, und laßt uns stolz darauf sein, euch zu uns zählen zu dürfen. Diejenigen, an die noch Schuluniformen und Schuhe ausgegeben werden müssen, begeben sich von hier aus direkt zur Ausgabestelle im Untergeschoß. Macht euch genauestens mit eurem Stundenplan vertraut und notiert euch die Zeiten, zu denen ihr zum Unterricht erscheinen müßt. Denkt immer daran: Eine einmalige Verspätung bringt euch in Punkten nur einen Tadel ein. Die zweite Verspätung wird mit vier Punkten bestraft, die dritte mit sechs.«
»Mich kann man nicht dafür tadeln, daß ich zu spät komme«, murrte Gisselle. »Nicht, wenn ich mich in diesem Rollstuhl durch die Gegend bewegen muß.«
Ein paar Mädchen schauten in ihre Richtung und sahen dann schnell wieder Mrs. Ironwood an, die wieder einmal den Blick auf uns gerichtet zu haben schien wie ein Würgervogel im Bayou. Die lange Pause, die sie einlegte, bewirkte, daß sichtliches Unbehagen sich unter den versammelten Mädchen ausbreitete. Ich kam mir vor, als säße ich auf einem Ameisenhügel, und ich konnte es kaum erwarten, daß Mrs. Ironwood in eine andere Richtung schaute. Endlich tat sie es.
»Die Gesamtzahl der bei uns Immatrikulierten ist gestiegen, aber unsere Klassen sind immer noch so klein, daß ihr alle die individuelle Betreuung und Unterweisung bekommt, die ihr braucht, wenn ihr erfolgreich sein wollt – vorausgesetzt, ihr schöpft eure Arbeitskapazität voll aus. Ich wünsche euch allen viel Glück«, schloß sie, und dann setzte sie die Brille ab und schlug den Ordner zu. Sie warf noch einen letzten finsteren Blick in unsere Richtung und stolzierte dann von der Bühne.
Niemand rührte sich vom Fleck, bis sie die Aula verlassen hatte. Dann begannen die Mädchen, von denen viele den Atem angehalten hatten, laut durcheinander zu reden. Nach und nach standen sie auf, um zu gehen.
»Vielen Dank«, sagte Gisselle, deren Augen Funken sprühten.
»Wofür?«
»Dafür, daß du mich in diese höllische Umgebung gebracht hast.« Sie kehrte ihren Stuhl selbst um und stieß andere Mädchen aus dem Weg. Dann sah sie sich um. »Samantha«, rief sie.
»Was ist?«
»Schieb mich zum Wohnheim zurück, während meine Schwester sich ihre hübschen neuen Kleider abholt«, befahl sie und lachte.
Samantha sprang auf, um ihrem Gebot Folge zu leisten; wir anderen folgten Gisselle, als sei sie soeben zur Königin ernannt worden.
Nachdem Abby und ich uns die Schuluniformen und die Schuhe abgeholt hatten, kehrten wir ins Wohnheim zurück. Auf dem Weg erzählte ich ihr die Geschichte von Gisselles Autounfall und der daher rührenden Lähmung. Sie hörte aufmerksam zu, und ihre dunklen Augen wurden feucht, als ich ihr Martins Begräbnis und Daddys tiefe Depression in den darauffolgenden Tagen schilderte.
»Dann kann man also nicht sagen, daß erst der Unfall sie so hat werden lassen«, sagte Abby.
»Nein. Leider war Gisselle schon lange vorher Gisselle, und ich fürchte, sie wird es noch lange bleiben.«
Abby lachte.
»Hast du keine Geschwister?« fragte ich sie.
»Nein.« Nach einer langen Pause fügte sie hinzu: »Ich hätte auch nicht geboren werden sollen.«
»Wie meinst du das?«
»Es war ein Unfall. Meine Eltern wollten überhaupt keine Kinder haben«, sagte sie.
»Und warum nicht?«
»Sie wollten eben keine«, erwiderte sie, aber ich ahnte, daß es tiefere und ernstere Gründe dafür gab, die sie kannte, aber nicht aussprechen konnte. Sie hatte jetzt schon mehr über sich erzählt, als sie vorgehabt hatte, was ich darauf zurückführte, daß wir so schnell so gut miteinander auskamen. Es lag auf der Hand, daß Abby und ich einander näherkommen wollten. Abgesehen von Gisselle waren wir die beiden einzigen Mädchen in unserem Teil des Wohnheims, die neu in Greenwood waren. Ich hatte das Gefühl, ihr irgendwann, später einmal, meine Geschichte erzählen zu können; sie wirkte auf mich wie jemand, bei der ich mich darauf verlassen konnte, daß sie mein Geheimnis für sich behielt.
Zurück im Wohnheim, probierten wir unsere Schuluniformen an. Trotz der Größenangaben auf dem Etikett waren sie viel zu weit. Ich war sicher, daß diese Kleidungsstücke dazu gedacht waren, unsere Weiblichkeit als Staatsgeheimnis zu bewahren. In unförmigen Blusen und Röcken, die uns bis auf die Knöchel reichten, trafen wir uns im Wohnzimmer wieder und brachen beide in hysterisches Gelächter aus. Gisselle schien erfreut zu sein. Unser Gelächter lockte die anderen Mädchen aus ihren Zimmern, wo sie ihre Sachen sortiert und Vorbereitungen für den Schulalltag getroffen hatten.
»Was ist denn hier so komisch?« fragte Samantha.
»Was hier so komisch ist? Sieh uns doch an«, sagte ich.
»Die Eiserne Jungfrau hat diese Schuluniformen persönlich entworfen«, erklärte Vicki. »Beschwert euch also nicht zu laut darüber.«
»Oder sie wird euch auf dem Scheiterhaufen verbrennen«, fügte Jacqueline hinzu.
»Zumindest können wir am Wochenende, bei Veranstaltungen und wenn wir bei Mrs. Clairborne zum Tee eingeladen sind, unsere eigenen Kleider tragen«, sagte Kate.
»Zum Tee bei Mrs. Clairborne?« bemerkte Gisselle. »Ich kann es kaum erwarten.«
»Oh, sie hat immer die allerbesten Kuchen für uns da«, sagte Kate. »Und Pralinen!«
»Und Chubs bringt es immer wieder fertig, ein paar Dutzend davon in ihre Handtasche zu stopfen und sie irgendwo in unserem Zimmer zu verstecken. Ich weiß nicht, warum wir noch keine Ratten haben«, sagte Jacqueline.
»Was genauer hat es mit diesem Tee auf sich?« fragte ich.
»Es ist nicht eine einmalige Einladung zum Tee. Diese Tees werden häufig veranstaltet, und es dürfen nur diejenigen hingehen, die persönlich eingeladen worden sind. Jeder weiß, wer eingeladen worden ist und wer nicht, und man genießt ein höheres Ansehen bei den Lehrern, wenn man mehr als einmal von Mrs. Clairborne eingeladen wird.«
»Nach dem dritten Mal ist man Teekönigin«, erklärte Jacqueline.
»Teekönigin?« Abby sah mich an, und ich zuckte die Achseln.
»Bei jeder Einladung behält man seinen Teebeutel und hängt ihn wie einen Preis oder eine Empfehlung in seinem Zimmer an die Wand«, erklärte Vicki. »Das ist in Greenwood Tradition, und es ist eine Ehre. Jacki hat recht. Diejenigen, die eingeladen werden, werden oft besser behandelt.«
»Das sagt sie, weil sie Teekönigin ist«, spottete Jacqueline. »Letztes Jahr wurde sie viermal eingeladen.«
»Und was ist mit euch?« fragte Gisselle.
»Ich nur einmal. Kate war zweimal da, Samantha auch zweimal.«
»Alle neuen Mädchen werden zum ersten Tee des Jahres eingeladen, aber das zählt nicht«, fuhr Vicki fort.
»Und wo finden diese Teenachmittage statt?« fragte Abby.
»In der Clairborne-Villa. Mrs. Penny wird euch hinbringen und euch die Geschichte des Hauses erzählen. Die Kenntnis dieser Geschichte ist hier fast so wichtig wie die Kenntnis von Fakten aus der Geschichte Amerikas und Europas«, sagte Jacqueline.
Vicki nickte.
»Ich kann es kaum erwarten«, sagte Gisselle. »Ich bin nur nicht sicher, ob ich diese Spannung aushalte.« Kate lachte, und Samantha lächelte, aber Vicki schien schockiert zu sein über das, was in Greenwood als Blasphemie galt.
»Und wann«, fuhr Gisselle fort, »findet die erste Veranstaltung statt, zu der die Jungen kommen?«
»Oh, erst in fast einem Monat. Hast du den Veranstaltungskalender in deiner Mappe denn noch nicht durchgelesen?« sagte Jacqueline.
»Erst in einem Monat? Ich habe Daddy doch gleich gesagt, daß es hier wie in einem Nonnenkloster zugeht«, jammerte sie. »Und was ist mit Ausflügen in die Stadt?« Die Mädchen sahen einander an.
»Wie meinst du das?« fragte Vicki.
»Ausflüge in die Stadt. Was ist daran so schwer zu verstehen. Du willst doch schließlich die Abschlußrede halten.«
Vicki wurde bleich.
»Ich ... äh ...«
»Niemand von uns hat je allein das Schulgelände verlassen«, erklärte Jacqueline.
»Und warum nicht?« erkundigte sich Gisselle. »Es muß doch Lokale in der Stadt geben, in denen man Jungen treffen kann.«
»Zuerst einmal mußt du ein Formular ausfüllen, damit du eine Genehmigung bekommst, das Schulgelände unbeaufsichtigt zu verlassen«, erklärte Vicki.
»Was? Soll das heißen, daß ich hier eine Gefangene bin?«
»Ruf doch einfach deine Eltern an, und laß sie das Formular ausfüllen«, sagte Vicki achselzuckend.
»Und was ist mit euch? Wollt ihr mir etwa sagen, daß keine von euch es je versucht hat?« Niemand sagte etwas. »Was seid ihr denn alle ... Jungfrauen?« rief Gisselle frustriert aus. Ihr Gesicht war rot wie eine gekochte Hummerschere.
Samanthas Mund stand offen. Kate starrte Gisselle mit einem Lächeln an, das belustigt und verwundert zugleich war. Vicki war weiterhin völlig ratlos, und Jacqueline wirkte beschämt. Abby und ich tauschten schnell einen Blick aus.
»Erzählt mir bloß nicht, daß ihr euch an all diese dämlichen Vorschriften gehalten habt«, fuhr Gisselle fort und schüttelte ungläubig den Kopf.
»Tadel können ...« setzte Vicki an.
»Sie können einem die Chance ruinieren, Teekönigin zu werden. Ich kapiere«, sagte Gisselle. »Es gibt wichtigere Dinge, die man sich an die Wand hängen kann, als benutzte Teebeutel«, fauchte sie und fuhr mit ihrem Rollstuhl auf Vicki zu, die einen Schritt zurücktrat. »Wie zum Beispiel Liebesbriefe. Hast du je einen bekommen?«
Vicki schaute sich um und sah, daß alle Augen auf sie gerichtet waren. Sie stammelte: »Ich ... ich muß jetzt ... anfangen, meine Texte über europäische Geschichte zu lesen. Wir sehen uns später.« Dann machte sie kehrt und ging schnell in ihr Zimmer.
Gisselle drehte sich um und richtete den Blick auf Jacqueline.
»Letztes Jahr wollten sich zwei Jungen aus Rosedown an einem Wochenende nachts heimlich in unser Zimmer schleichen«, enthüllte diese.
»Und?«
»Wir hatten nicht den Mut dazu«, gestand Jacqueline.
»Aber jetzt ist dieses Jahr, und dieses Jahr werden wir den Mut haben«, sagte Gisselle. Sie sah mich an. »Wir werden diesen Mädchen mal zeigen, wie Mädchen aus New Orleans eine Party feiern. Stimmt’s, Ruby?«
»Laß das sein, Gisselle. Bitte.«
»Was soll ich sein lassen? Das Leben? Du hättest wohl gern, daß ich ein gehorsames kleines Greenwood-Mädchen werde, stumm in meinem Rollstuhl umherfahre, den Mund halte, einen Haufen trockener alter Teebeutel auf dem Schoß habe und mir die Knie zusammenbinden lasse, was?«
»Gisselle, bitte ...«
»Wer hat eine Zigarette für mich?« erkundigte sie sich prompt. Kate riß die Augen auf. Sie schüttelte den Kopf. »Samantha?«
»Nein, ich rauche nicht.«
»Ihr raucht nicht. Ihr trefft euch nicht mit Jungen. Was tut ihr eigentlich? Lest ihr Fanzeitschriften und masturbiert dabei?«
Es war, als hätte ein Blitz in das Wohnheim eingeschlagen. Mir war dieser Ausbruch meiner Schwester derart peinlich, daß ich die Augen niederschlug und auf den Fußboden blickte.
»Schon gut«, fuhr Gisselle fort, »macht euch keine Sorgen. Jetzt bin ich ja hier. Jetzt werden sich die Dinge ändern, das verspreche ich euch. Rein zufällig«, lächelte sie, »habe ich selbst ein paar Zigaretten in die Schule geschmuggelt.«
»Gisselle, du wirst uns alle in Schwierigkeiten bringen, und das am ersten Schultag«, protestierte ich.
»Ihr kneift doch nicht etwa auch?« fragte sie Jacqueline, Kate und Samantha. »Gut«, sagte sie, als sie nichts erwiderten. »Kommt in mein Zimmer. Ihr könnt mir helfen, meine Platten zu sortieren, und dann rauchen wir zusammen eine Zigarette. Vielleicht besorge ich uns bald etwas Besseres«, fügte sie lächelnd hinzu. Sie wendete ihren Stuhl und fuhr zu unserem Zimmer. Niemand rührte sich vom Fleck. »Was ist?« fauchte sie. »Macht schon.«
Jacqueline setzte sich als erste in Bewegung, und dann folgten ihr Kate und Samantha.
»Macht die Tür zu«, befahl Gisselle, als alle in unserem Zimmer waren.
»Ich hätte nie geglaubt, daß Zwillingsschwestern derart verschieden sein können«, bemerkte Abby und begriff dann, was sie gesagt hatte. »Oh, es tut mir leid, ich wollte damit nicht ...«
»Schon gut. Ich hätte es auch nie geglaubt – bis ich ihr begegnet bin«, sagte ich und biß mir auf die Zunge. Aber es war zu spät.
»Bis du ihr begegnet bist?«
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte ich. »Ich dürfte sie eigentlich niemandem hier erzählen.«
»Ja, das verstehe ich«, sagte Abby. Aus ihrem Gesichtsausdruck konnte ich schließen, daß sie mich wohl wirklich verstand.
»Aber es macht mir nichts aus, sie dir zu erzählen«, fügte ich hinzu.
Sie lächelte. »Warum gehen wir nicht in mein Zimmer«, schlug sie vor. Ich warf noch einen Blick auf die geschlossene Tür, hinter der Gisselle mit ihren neuen Günstlingen Hof hielt. Das war eine Szene, mit der ich im Moment nichts zu tun haben wollte.
»Eine gute Idee«, sagte ich. »Während wir miteinander reden, räume ich den Kram von Gisselle auf, den du bei dir unterbringen mußtest. Außerdem sollte ich mir einige ihrer Sachen genauer ansehen.« Ich warf noch einen Blick zurück auf unser Zimmer. »Man kann nicht wissen, was sie sonst noch auf das Schulgelände geschmuggelt hat.«
Nach einer guten Stunde kam Mrs. Penny in unseren Quadranten, um nachzusehen, ob wir zurechtkamen. Falls sie in unserem Zimmer Rauch gerochen hatte, ließ sie es sich nicht anmerken. Es konnte ihr nicht entgangen sein; der Gestank haftete an der Kleidung der Mädchen und hing in der Luft, obwohl sie die Fenster geöffnet hatten.
»Ich bin auch hier, um Mrs. Clairbornes Einladung an Abby, Gisselle und Ruby zum Tee offiziell zu überbringen, in ihrem Haus am Samstagnachmittag um zwei«, sagte sie. »Ihr könnt anziehen, was ihr wollt, aber ihr solltet euch angemessen herrichten«, fügte sie mit einem Zwinkern hinzu. »Schließlich handelt es sich um eine förmliche Einladung.«
»Oh, nein, und ich habe mein kleines Schwarzes zu Hause gelassen«, sagte Gisselle.
»Wie bitte, meine Liebe?«
»Schon gut«, sagte Gisselle lächelnd. Ich sah, wie Samantha und Kate hinter Mrs. Pennys Rücken grinsten. Jacki hatte das gewohnte hämische Grinsen im Gesicht, aber ihnen war deutlich anzusehen, daß alle drei noch in Ehrfurcht vor meiner Schwester erstarrt waren.
»Gut. Also dann, in einer Viertelstunde ist es Zeit für das Abendessen«, flötete Mrs. Penny. »Mädchen, die neu bei uns sind, sind bis zur zweiten Woche von den Haushaltspflichten befreit«, fügte sie hinzu und entfernte sich dann.
»Was soll denn das schon wieder heißen?« erkundigte sich Gisselle und fuhr ihren Rollstuhl mitten ins Wohnzimmer. »Was für Haushaltspflichten?«
»Wir helfen alle im Eßzimmer mit. Wir bekommen unseren Dienst zugeteilt und können einem Aushang am Schwarzen Brett entnehmen, wann wir dran sind«, erklärte Jacqueline. »Diese Woche müssen Vicki, Samantha, Chubs und ich die Tische abräumen. Wir tragen das schmutzige Geschirr und Besteck in die Küche, nachdem alle gegessen haben. Die Mädchen von B und C servieren das Essen, und die Mädchen von D decken den Tisch.«
»Was?« Gisselle drehte ihren Rollstuhl zu mir um. »Davon hast du mir nichts gesagt.«
»Ich wußte es bis eben selbst nicht, Gisselle. Was ist schon dabei?«
»Was schon dabei ist? Ich erledige doch nicht die Arbeiten einer Hausangestellten.«
»Ich bin sicher, von dir wird niemand etwas erwarten, weil ...«, setzte Vicki an, unterbrach sich aber mitten im Satz.
Gisselle sah sie wütend an. »Weil ich verkrüppelt bin? Das wolltest du doch sagen, oder nicht?«
»Ich wollte sagen: ›Weil du im Rollstuhl sitzt.‹ Man kann nicht von dir erwarten, daß du Geschirr in die Küche trägst.«
»Sie kann den Tisch decken«, sagte ich und lächelte meine Schwester an. Sie erdolchte mich mit Blicken.
»Was ich tun kann und was ich tun werde, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wenn all diese Idioten einen Haufen Geld dafür bezahlen wollen, daß sie in eine Privatschule gehen und gleichzeitig als Hausmädchen arbeiten, dann sollen sie es von mir aus ruhig tun«, sagte sie.
»Alle Mädchen in allen Wohnheimen helfen bei diesen Arbeiten mit, vor allem in den beiden großen Wohnheimen«, sagte Samantha. Gisselle bedachte sie mit einem Blick, der die Wirkung einer Ohrfeige hatte. Samantha biß sich auf die Unterlippe und wich einen Schritt zurück. »Es ist aber wirklich so«, murmelte sie mir und Abby zu.
»Weshalb sollten wir uns vor ein wenig Hausarbeit fürchten?« sagte ich.
»Das ist mal wieder typisch für dich. Du ...« Gisselle unterbrach sich gerade noch rechtzeitig, um nicht meine Cajun-Abstammung zu verraten. Sie sah zwischen den anderen hin und her. »Ich habe Hunger. Laßt uns gehen. Samantha«, schrie sie, und Samantha sprang vor, um Gisselles Rollstuhl zu schieben.
Im Speisesaal trafen wir die anderen Mädchen aus unserem Wohnheim. Mit denen aus dem oberen Stockwerk waren wir insgesamt vierundfünfzig. Drei lange Tische standen in dem großen Raum, der von vier enormen Kronleuchtern in helles Licht getaucht wurde. Sämtliche Wände waren mit dunklem Holz getäfelt und in regelmäßigen Abständen mit gerahmten Drucken geschmückt, auf denen Szenen auf Plantagen und im Bayou abgebildet waren. Alle plapperten aufgeregt durcheinander, als wir kamen, doch Gisselles Anblick ließ manche Mädchen verstummen. Sie erwiderte die Blicke mit einem Ausdruck glühender Mißbilligung, was bewirkte, daß eine nach der anderen sich abwandte. Vicki führte uns zu unseren Plätzen. Aufgrund ihres Rollstuhls bekam Gisselle den Platz an der Stirnseite unseres Tisches zugewiesen, was sie genoß und schnell zu ihrem Vorteil nutzte. Es dauerte nicht lange, und sie bestimmte die Gesprächsthemen, und ordnete an, dies oder jenes weiterzureichen.. Dazu erging sie sich in. ausführlichen Schilderungen ihres Lebenswandels zu Hause in New Orleans.
Die Mädchen schienen fasziniert von ihr. Manche, die mir besonders snobistisch erschienen, schauten sie an, als sei sie ein vom Friedhof der schlechten Manieren auferstandener Geist, doch Gisselle war nicht zu bremsen. Sie drohte den Mädchen, die uns das Essen servierten, als seien sie bezahltes Personal; sie stellte Forderungen und beschwerte sich und sagte nicht ein einziges Mal danke.
Das Essen war gut, wenn auch nicht annähernd so köstlich wie die Gerichte, die Nina uns zu Hause zubereitete. Als wir die Mahlzeit beendet hatten und die Mädchen aus unserem Quadranten begannen, die Tische abzuräumen, befahl mir Gisselle, sie in unser Zimmer zurückzubringen. »Ich denke gar nicht daran, auf die anderen zu warten, sagte sie. »Das sind absolute Vollidioten.«
»Nein, das sind sie nicht, Gisselle«, entgegnete ich. »Sie tragen lediglich ihren Teil zu unserer Gemeinschaft bei. Das macht Spaß: Es gibt einem das Gefühl, wirklich hier zu wohnen, fern der Heimat ein Zuhause gefunden zu haben.«
»Ich fühle mich hier nicht zu Hause. Für mich ist das der reinste Alptraum«, sagte sie. »Bring mich ins Zimmer. Ich will Platten hören und Briefe an meine Freundinnen schreiben, die bestimmt alles über diese erbärmliche Institution erfahren wollen«, sagte sie so laut, daß alle in unserer Nähe es hören konnten. »O Jacki«, rief sie dann. »Wenn ihr mit euren Hausarbeiten fertig seid, könnt ihr in mein Zimmer kommen und euch meine Platten anhören, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was man heute so hört.«
Ich schob sie aus dem Raum, so schnell ich konnte. Sie schrie, wenn ich so weitermache, würde ich sie noch gegen eine Wand fahren, und genau das war es, was ich mir in diesem Moment erhoffte. Abby folgte uns. Wir hatten bereits beschlossen, daß sie und ich nach dem Abendessen einen Spaziergang zum See machen würden. Ursprünglich hatte ich Gisselle fragen wollen, ob sie mitkommen wollte, aber da sie bereits andere Pläne hatte, sprach ich das Thema gar nicht erst an.
»Wohin geht ihr beiden?« fragte sie, nachdem ich sie in unser Zimmer gebracht hatte.
»Wir gehen raus und machen einen Spaziergang. Möchtest du mitkommen?«
»Ich kann nicht laufen, oder hast du das vergessen?« sagte sie barsch und schloß die Tür.
»Es tut mir leid«, sagte ich zu Abby. »Ich fürchte, ich werde mich mein Leben lang für meine Schwester entschuldigen müssen.«
Sie lächelte und schüttelte den Kopf.
»Ich habe geglaubt, ich hätte ein Kreuz zu tragen und allen Grund, mich selbst zu bemitleiden, aber nachdem ich gesehen habe, womit du fertig werden mußt ...«, sagte sie, als wir das Wohnheim verließen.
»Was meinst du, wenn du sagst, du dachtest, du hättest ein Kreuz zu tragen? Was für ein Kreuz könntest du zu tragen haben? Deine Eltern schienen sehr nett zu sein.«
»Ja, das sind sie. Ich habe sie sehr lieb.«
»Was hast du dann gemeint? Leidest du vielleicht an einer Krankheit oder dergleichen? Du wirkst gesund wie ein junger Alligator.«
Abby lachte. »Nein, ich bin Gott sei Dank gesund und munter.«
»Und noch dazu hübsch.«
»Danke. Das bist du aber auch.«
»Also? Welches Kreuz hast du zu tragen?« hakte ich nach. »Ich habe dir meine Geschichte anvertraut.«
Sie blieb stumm. Wir schlugen den Weg zum See ein. Sie hielt den Kopf gesenkt. Ich sah zu der Mondsichel auf, die über einer Wolke herausschaute. Die silbrigen Strahlen warfen ihr kühles Licht in die warme Nacht und ließen unsere neue Welt ätherisch erscheinen wie die Kulisse eines Traumes, den wir alle träumten. In den beiden anderen Wohnheimen brannten alle Lichter, und hier und da sahen wir andere Mädchen, die spazierengingen oder einfach nur in kleinen Gruppen zusammenstanden und redeten.
Als wir uns dem Wasser näherten, konnten wir die Ochsenfrösche, die Zikaden und andere Tiere hören, die mit ihrer ritualisierten Nachtmusik zum Leben erwachten, einer Symphonie des Krächzens und Schnalzens, des Zirpens, Klapperns und der leisen Pfiffe.
Da wir so weit von jeder Autobahn entfernt waren, drang der Lärm des Verkehrs nicht zu uns herüber, aber in der Ferne sah ich die roten und grünen Positionslampen der Öltanker auf dem Mississippi und malte mir den Klang von Nebelhörnern und die Stimmen der Passagiere auf Flußdampfern aus. Manchmal wurden in Nächten wie dieser menschliche Stimmen mehr als eine Meile weit über das Wasser getragen, und wenn man die Augen schloß und lauschte, konnte man entweder die eigene Bewegung oder die der anderen wahrnehmen, wenn sich die Schiffe langsam entfernten.
Der See hatte einen metallischen Schimmer angenommen. Er lag so still, daß an den Ruderbooten, die an dem kleinen Landesteg neben dem Bootshaus vertäut waren, kaum ein Auf und Ab wahrzunehmen war. In der Mitte des relativ großen Sees befand sich eine kleine Insel. Wir hatten den Bootssteg fast erreicht, als Abby wieder das Wort ergriff.
»Ich will nicht geheimnistuerisch erscheinen«, sagte sie. »Ich mag dich, und ich rechne es dir hoch an, daß du mir deine Geschichte anvertraut hast. Ich zweifle nicht im geringsten daran«, fügte sie mit Bitterkeit hinzu, »daß die meisten dieser Mädchen auf dich herunterschauen würden, wenn sie wüßten, daß du von einer armen Cajun-Familie abstammst, aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu mir.«
»Was? Wieso denn das?« sagte ich. »Was ist an deiner Herkunft auszusetzen?«
Wir standen jetzt auf dem Bootssteg und schauten auf den See hinaus.
»Du hast mich heute morgen gefragt, ob ich einen Freund hätte, und ich habe ja gesagt, und du wolltest mich trösten, als du sagtest, er würde mir bestimmt schreiben oder mich anrufen. Ich habe dir gesagt, daß er das ganz bestimmt nicht tun wird, und du hast dich bestimmt gefragt, warum ich mir da so sicher bin.«
»Ja«, sagte ich. »Das habe ich mich allerdings gefragt.«
»Er heißt William. William Huntington Cambridge. Er ist nach seinem Ururgroßvater benannt worden«, sagte sie mit derselben Bitterkeit, die ich schon vorher aus ihrer Stimme herausgehört hatte. »Und der war zufällig ein Held der Konföderation, worauf die Cambridges sehr stolz sind«, fügte sie hinzu.
»Ich vermute, wenn man alle hier näher unter die Lupe nimmt, wird man feststellen, daß die meisten Vorfahren haben, die für. den Süden gekämpft haben«, sagte ich behutsam.
»Ja, ich bin sicher. Das ist ein weiterer Grund dafür, daß ich ... « Sie drehte sich abrupt zu mir um, und in ihren Augen standen Tränen. »Ich habe meine Großeltern väterlicherseits nie kennengelernt. Meine Familie hat ihre Identität geheimgehalten, und deshalb wollten meine Eltern mich auch nicht haben«, erklärte sie. Sie unterbrach sich, als erwartete sie von mir, daß ich alles verstand, aber ich konnte ihr nicht folgen und schüttelte den Kopf.
»Mein Großvater hat eine Schwarze geheiratet, eine Frau von Haiti; mein Vater ist also ein Mulatte, der aber doch weiß genug ist, um als Weißer durchzugehen.«
»Und deshalb wollten deine Eltern niemals Kinder haben? Sie hatten Angst, sie ...«
»Angst, daß ich, der Nachwuchs eines Mulatten und einer Weißen, dunkelhäutiger geboren werden könnte«, sagte sie und nickte. »Dann haben sie mich doch bekommen, und ich bin, wie du bestimmt weißt, eine Terzeronin. Wir sind oft umgezogen, in erster Linie, weil überall, wo wir lange genug gelebt haben, irgendwer irgendeinen Verdacht geschöpft hat.«
»Und dein Freund William ...«
»Seine Familie hat es herausgefunden. Sie betrachten sich als blaublütig, und sein Vater achtet sorgsam darauf, soviel wie möglich über jeden in Erfahrung zu bringen, mit dem eines seiner Kinder sich einläßt.«
»Das tut mir leid«, sagte ich. »Es ist ungerecht und dumm.«
»Ja, das macht es noch nicht leichter, damit zu leben. Meine Eltern haben mich in der Hoffnung hierher geschickt, daß es auf mich abfärben wird, von der Crème de la crème umgeben zu sein, und daß ich, ganz gleich, wohin ich von hier aus gehe, in allererster Linie als ein Greenwood-Mädchen angesehen werde, das von einer guten Familie aus der Oberschicht abstammt und etwas ganz Besonderes ist und daher niemals in den Verdacht gerät, eine Terzeronin zu sein. Ich wollte nicht herkommen, aber sie wünschen sich so sehr, daß ich von Vorurteilen verschont bleibe, und sie fühlen sich so schuldig, weil sie mich überhaupt bekommen haben, daß ich es ihnen zuliebe getan habe. Verstehst du das?«
»Ja«, sagte ich. »Und ich danke dir.«
»Wofür?« fragte sie lächelnd.
»Für dein Vertrauen.«
»Du hast mir auch vertraut«, erwiderte sie. Wir wollten einander gerade umarmen, als hinter uns die laute Stimme eines Mannes ertönte.
»He«, rief er. Eine Tür des Bootshauses fiel hinter ihm ins Schloß. Als wir uns umdrehten, sahen wir einen großen dunkelhaarigen Mann näher kommen, der nicht älter als vierundzwanzig oder fünfundzwanzig war. Er trug kein Hemd, und sein muskulöser Oberkörper schimmerte im Mondschein. Er trug enge Jeans und war barfuß. Sein Haar reichte ihm bis über die Ohren und bedeckte fast gänzlich seinen Nacken.
»Was habt ihr hier unten zu suchen?« fragte er. Er näherte sich uns so weit, daß wir seine dunklen Augen und seine hohen indianischen Backenknochen erkennen konnten. Seine Gesichtszüge waren markant, er hatte ein festes Kinn und einen schmalen Mund. Während er uns musterte, wischte er sich die Hände an einem Lappen ab.
»Wir wollten nur einen Spaziergang machen«, setzte ich an, »und ...«
»Wißt ihr denn nicht, daß ihr nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr hier sein dürft? Wollt ihr mich in Schwierigkeiten bringen? Es gibt immer einige unter euch, die sich hierher vorwagen, um mich in die Enge zu treiben, und das tut ihr nur zu eurer eigenen Unterhaltung«, sagte er grob. »Jetzt nehmt die Beine in die Hand und lauft, oder ich setze Mrs. Ironwood auf euch an, kapiert?«
»Es tut mir leid«, sagte ich.
»Wir sind nicht hergekommen, um irgend jemandem Schwierigkeiten zu machen«, fügte Abby hinzu. Sie trat aus der Dunkelheit heraus. Als er sie ansah, wurde er augenblicklich freundlicher.
»Ihr zwei seid neu hier, was?«
»Ja«, sagte sie.
»Habt ihr denn diese Vorschriften nicht gelesen?«
»Noch nicht vollständig«, erwiderte sie.
»Seht mal«, sagte er. »Ich will keine Scherereien haben. Mrs. Ironwood hat mir klare Anweisungen erteilt. Nach Anbruch der Dunkelheit darf ich noch nicht einmal mit einer von euch reden, wenn kein Mitglied des Lehrkörpers anwesend ist, versteht ihr? Und schon gar nicht hier unten!« fügte er hinzu und sah sich um, weil er sich vergewissern wollte, daß niemand lauschte.
»Wer sind Sie?« fragte ich.
Er zögerte einen Moment lang, ehe er antwortete: »Ich heiße Buck Dardar, aber jetzt verschwindet, und zwar pronto, weil ich sonst großen Ärger kriege.«
»In Ordnung«, sagte Abby.
»Los«, befahl er uns und wies auf den Hügel.
Wir faßten einander bei den Händen und rannten los, unser Gelächter hallte über den See. Als wir oben auf dem Hügel angekommen waren, blieben wir stehen, schnappten nach Luft und sahen uns nach dem Bootshaus um. Er war fort, aber er löste immer noch prickelnde Phantasien in uns aus, wie etwas Verbotenes es kann.
Wir waren aufgeregt, und unsere Herzen pochten, als wir zum Wohnheim zurückeilten; neue Freundinnen, durch die Geheimnisse ihrer Vergangenheit und durch geheime Hoffnungen, die jede für sich, aber auch für die andere hegte, miteinander verbunden.