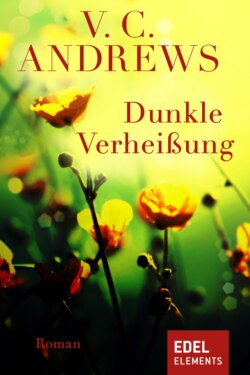Читать книгу Dunkle Verheißung - V.C. Andrews - Страница 9
4. Die Hüterin meiner Schwester
ОглавлениеAm ersten Schultag schien sich das Leben in Greenwood nicht allzusehr von dem in anderen Schulen zu unterscheiden, natürlich abgesehen davon, daß in den Korridoren und Klassenzimmern keine Jungen zu sehen waren. Ich war allerdings beeindruckt davon, wie sauber und neu alles wirkte. Die Marmorböden in den Korridoren schimmerten, unsere Schreibtischplatten hatten so gut wie keine Kratzer, und im Gegensatz zu den meisten anderen Schulen waren in die Möbel weder kryptische Graffiti noch Ausbrüche von Wut oder Enttäuschung geritzt.
Unsere Lehrer stellten den Grund dafür sogleich deutlich klar. Jeder einzelne begann mit einem kurzen Vortrag darüber, wie wichtig es sei, daß unsere Schule weiterhin einen sauberen und neuen Eindruck erweckte. Ihre Stimmen dröhnten, als wollten sie sich vergewissern, daß Mrs. Ironwood ihre Ermahnungen auch ganz bestimmt hörte. Fast jeder Lehrer betonte, daß er für den Zustand seines Klassenzimmers persönlich verantwortlich sei und diese Verantwortung zu übernehmen gedenke.
»Wenn sie es nicht schaffen«, flüsterte Jacki mir zu, »läßt die Eiserne Jungfrau sie auspeitschen.«
Die Vorträge langweilten Gisselle, doch selbst sie war beeindruckt zu sehen, wie gehorsam die gesamte Schülerschaft war, wenn es darum ging, das Gebäude in einem makellosen Zustand zu erhalten. Jedesmal, wenn eine Schülerin ein Stück Papier auf dem Boden liegen sah, blieb sie stehen, bückte sich und hob es auf. Und in der Cafeteria wurde ebensosehr auf Sauberkeit geachtet. Es war zwar noch zu früh, um sich ein Urteil darüber zu bilden, doch es schien, als hafteten dem schulischen Leben in Greenwood in einem Maß Anstand und Ordnung an, daß unsere Schule in New Orleans – auch wenn es eine der besseren war – wie ein potentielles Tollhaus anmutete.
Mein Stundenplan sah vor, daß ich nach den beiden ersten Unterrichtsstunden eine Stunde Zeit zum Lernen hatte. Gisselle, die im letzten Jahr in Algebra durchgefallen war, mußte dieses Fach in Greenwood wiederholen. Als wir am Morgen im Hauptgebäude eingetroffen waren, hatte ich sie von unserem Klassenzimmer zu den Kursen geschoben, aber nach der zweiten Stunde tauchte fast wie auf eine Absprache hin Samantha auf und erbot sich, sich um sie zu kümmern.
»Nach dieser Pause haben wir die nächsten drei Kurse gemeinsam«, sagte Samantha. Gisselle freute sich offensichtlich über ihr Angebot.
»In Ordnung«, sagte ich. »Aber paß auf, daß du nicht wegen meiner Schwester zu spät zum Unterricht kommst.«
»Wenn ich zu spät komme, weil ich für alles, was ich tun muß, länger brauche, dann werden sie das eben verstehen müssen«, meinte Gisselle. Ich sah, daß sie fest entschlossen war, in den Toiletten herumzutrödeln, vielleicht sogar eine Zigarette zu rauchen.
»Sie wird dich in Schwierigkeiten bringen, Samantha«, warnte ich, aber ich hätte meine Worte ebensogut an eine Wand richten können. Irgendwie hatte meine Schwester dieses naive Mädchen schnell zu ihrer zuverlässigen Dienerin gemacht. Mir tat Samantha leid; sie machte sich keine Vorstellung von dem, was ihr bevorstand. Und eines Tages würde Gisselle ihrer überdrüssig sein.
Ich ließ die beiden stehen und eilte in mein Studierzimmer. Aber als ich mich daran machte, mein neues Arbeitsmaterial durchzusehen, teilte mir der Lehrer, der die Aufsicht führte, mit, daß Mrs. Ironwood mich zu sprechen wünsche.
»Wenn du durch den Korridor zu deiner Rechten läufst und dann ein paar Stufen hinaufsteigst, kommst du direkt in ihr Büro«, erklärte er mir. »Schau nicht so besorgt«, fügte er mit einem Lächeln hinzu. »Sie bestellt oft Schülerinnen zu sich, die neu in Greenwood sind.«
Dennoch war ich wider Willen nervös. Mein Herz pochte heftig, als ich durch den leisen Gang eilte und die Treppe hinaufstieg. Eine kleine, rundliche Frau mit Binokularbrille in einem grauen Gestell stand vor einem Aktenschrank und drehte sich zu mir um, als ich das Vorzimmer betrat. Auf dem Namensschild auf ihrem Schreibtisch stand MRS. RANDLE. Sie sah mich einen Moment lang an und ging dann zu ihrem Schreibtisch und nahm ein Blatt Papier in die Hand.
»Du bist Ruby Dumas?«
»Ja, Ma’am.«
Sie nickte, und ihr Gesicht behielt seinen förmlichen ernsten Ausdruck bei, als sie zur Tür des Büros ging. Nachdem sie leise angeklopft hatte, öffnete sie die Tür und meldete mich an.
»Führen Sie sie herein«, hörte ich Mrs. Ironwood anordnen.
»Hier entlang, Ruby.« Sie trat zur Seite, und ich ging in Mrs. Ironwoods Büro.
Es war ein relativ großer, aber sehr karger Raum mit dunkelgrauen Vorhängen, einem hellgrauen Teppich, einem großen dunkelbraunen Schreibtisch, zwei Holzstühlen, die unbequem aussahen, und einem kleinen Sofa, das an der rechten Wand stand und den Eindruck erweckte, als seien die Polster hart. Darüber hing das einzige Bild im ganzen Raum, ein weiteres Porträt von Edith Dilliard Clairborne, und wie auf allen anderen trug sie auch auf diesem ein hochgeschlossenes Kleid für offizielle Anlässe; auf sämtlichen Porträts saß sie entweder in einem Garten oder auf einem hochlehnigen Stuhl in einem Arbeitszimmer. Über die anderen Wände waren Gedenktafeln und Urkunden verteilt, Preise, die Greenwood-Schülerinnen für alles Erdenkliche verliehen worden waren, von Debattierkursen bis Rhetorikwettbewerben.
Auf dem Schreibtisch stand zwar eine große Vase mit roten und rosa Rosen, doch das Zimmer roch wie eine Arztpraxis, in der große Mengen von Desinfektionsmitteln versprüht worden sind. Das Büro wirkte peinlich sauber, sogar die Fenster waren so blank, daß man hätte meinen können, sie stünden weit offen.
Mrs. Ironwood saß aufrecht hinter ihrem Schreibtisch. Sie setzte die Brille ab und sah mich lange an, sog mich in sich auf, als wolle sie sich mein Gesicht und meine Figur bis in alle Einzelheiten einprägen. Falls irgend etwas ihre Zustimmung fand, dann zeigte sie es nicht. Ihre Augen blieben kalt und analytisch, ihre Lippen fest zusammengekniffen.
»Setz dich, bitte«, wies sie mit einer Kopfbewegung auf einen der harten Holzstühle. Ich ging eilig darauf zu, setzte mich und legte meine Bücher auf meinen Schoß.
»Ich habe dich zu mir bestellt«, begann sie, »damit wir möglichst schnell zu einer Einigung gelangen.«
»Zu einer Einigung?«
Ihr rechter Mundwinkel senkte sich. »Das hier ist deine Akte«, erklärte sie. »Darunter liegt die Akte deiner Schwester. Ich habe mir beide sorgsam durchgelesen. Außer deinen Schulzeugnissen enthält die Akte wesentliche persönliche Informationen. Ich sollte dir wohl sagen«, fuhr sie fort und lehnte sich zurück, »daß ich mit deiner Stiefmutter ein langes informatives Gespräch über dich geführt habe.«
»Oh«, sagte ich.
Sie zog die dichten dunklen Augenbrauen zusammen. Da sie Daphne als meine Stiefmutter und nicht als meine Mutter bezeichnet hatte, stand fest, daß Daphne ihr von meinem Leben als Cajun erzählt hatte.
»Sie hat mir von den ... von den unseligen Umständen berichtet und ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, daß es ihr mißlungen ist, bei dir jene Veränderungen zu bewirken, die erforderlich wären, damit du dich nach einem reichlich rückständigen Leben zivilisierteren Gegebenheiten anpassen kannst.«
»Mein Leben ist nie rückständig gewesen, und es gibt einiges in meiner heutigen Situation, was ziemlich unzivilisiert ist«, sagte ich mit fester Stimme.
Ihre Augen wurden klein und die Lippen ein wenig blasser, als sie sie fester zusammenkniff. »Nun, ich kann dir versichern, daß das Leben in Greenwood in keinster Weise unzivilisiert ist. Wir haben eine stolze Tradition; wir dienen den besten Familien unserer Gesellschaft, und ich gedenke, diese Tradition fortzusetzen«, sagte sie mit scharfer Stimme. »Die meisten unserer Mädchen haben eine entsprechende Herkunft und wissen bereits, wie man sich in Gesellschaft benimmt und bewegt. Also dann«, sie setzte die Brille auf und öffnete meine Akte, »deinen Schularbeiten kann ich entnehmen, daß du eine ausgezeichnete Schülerin bist. Das ist vielversprechend für dich. Ich stelle außerdem fest, daß du mit Talent gesegnet bist. Ich freue mich schon darauf mitanzusehen, wie du es hier weiterentwickeln wirst. Dennoch nutzt dir all das überhaupt nichts, wenn dein gesellschaftliches Auftreten und deine persönlichen Angewohnheiten zu wünschen übrig lassen.«
»Sie lassen nichts zu wünschen übrig«, sagte ich eilig. »Ganz gleich, was Sie über die Welt denken mögen, in der ich aufgewachsen bin, und ganz gleich, was meine Stiefmutter Ihnen alles erzählt haben mag.«
Sie schüttelte den Kopf und feuerte Worte wie Kanonenkugeln auf mich ab: »Was deine Stiefmutter mir erzählt hat, bleibt innerhalb dieser vier Wände. Ich habe dich zu mir bestellt, damit du dir darüber klar wirst. Es liegt bei dir, diese Dinge unter Verschluß zu halten. Ungeachtet der näheren Umstände deiner Geburt und deiner Kindheit stammst du jetzt aus einer achtbaren Familie und bist dem Namen dieser Familie verpflichtet. Was du vor deinem Leben in New Orleans auch an Gewohnheiten gehabt haben, wie du dich benommen haben magst – nichts von alledem darf hier in Greenwood aus dir ausbrechen und durchscheinen. Ich habe deiner Stiefmutter versprochen, dich genauer im Auge zu behalten als die anderen Mädchen. Ich wollte, daß du dir darüber im klaren bist.«
»Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan, wofür ich es verdient hätte, anders behandelt zu werden als die anderen«, beklagte ich mich.
»Ich bin entschlossen, es dabei zu belassen. Wenn ich einem Elternteil einer meiner Schülerinnen ein Versprechen abgebe, dann werde ich alles tun, um dieses Versprechen zu halten. Was mich auf deine Schwester zu sprechen bringt«, sagte sie und schlug Gisselles Akte auf. »Ihre schulischen Leistungen sind enttäuschend, um es milde auszudrücken, wie des öfteren auch ihr früheres Benehmen. Mir ist klar, daß sie jetzt mit einer ernstlichen Behinderung zu kämpfen hat, und ich habe mich zu einem gewissen Entgegenkommen bereit erklärt, um ihr das Leben hier so bequem wie möglich zu machen und ihr eine Erfolgschance zu geben, aber ich will, daß du weißt, daß ich dich für ihre Erfolge und ihr Benehmen zur Verantwortung ziehen werde.«
»Und warum?«
Sie ließ ihren steinernen Blick kurz über mich gleiten. »Weil du deine Gliedmaßen uneingeschränkt benutzen kannst, und weil dein Vater so fest an dich glaubt«, erwiderte sie. »Und weil du deiner Schwester nahestehst und mehr Einfluß auf sie hast als jeder andere, wenn es darum geht, ihr Ratschläge zu erteilen.«
»Gisselle nimmt keine Ratschläge von mir an und hört äußerst selten auf mich. Sie hat ihren eigenen Kopf, und was ihre Behinderung angeht, so zieht sie den größtmöglichen Nutzen daraus«, sagte ich. »Sie braucht keine Vorzugsbehandlung, sondern strenge Disziplin.«
»Ich denke, solche Entscheidungen liegen bei mir«, erwiderte Mrs. Ironwood. Sie unterbrach sich, starrte mich einen Moment lang an und nickte dabei vor sich hin. »Ich sehe, was deine Stiefmutter gemeint hat: Du hast einen Hang zur Unabhängigkeit, diese Sturheit der Cajuns, eine Wildheit, die es im Zaum zu halten gilt. Nun – hier wird sie bestimmt im Zaum gehalten«, drohte sie und beugte sich vor. »Ich will, daß du deine guten schulischen Leistungen weiterhin erbringst; ich will, daß die Leistungen deiner Schwester sich verbessern; ich will, daß ihr beide euch benehmt und unsere Vorschriften buchstabengetreu befolgt. Ich möchte, daß eure Mutter zum Jahresende beeindruckt feststellt, welche Veränderungen sich an deinem Charakter vollzogen haben.«
Sie unterbrach sich und wartete meine Reaktion ab, doch meine Lippen blieben vor Furcht versiegelt; ich wollte mir nicht einmal ausmalen, was heraussprudeln könnte, wenn ich den Mund aufmachte.
»Das Benehmen deiner Schwester während der Einführungsversammlung war abscheulich. Ich habe mich nur deshalb entschlossen, darüber hinwegzusehen, weil wir dieses erste kurze Gespräch noch nicht miteinander geführt hatten. Wenn sie sich das nächstemal schlecht benimmt, werde ich euch beide zusammenstauchen, hast du mich verstanden?«
»Sie meinen, ich werde auch für Dinge bestraft, die meine Schwester anstellt?«
»Du bist jetzt für deine Schwester verantwortlich, bist ihre Hüterin, ob es dir paßt oder nicht.«
Tränen brannten hinter meinen Lidern. Eine Art Lähmung befiel mich, als ich daran dachte, wie sehr Daphne es genießen mußte zu wissen, was sie hier in Greenwood für mich vorbereitet hatte. Es schien, als sei sie entschlossen, mir mein. Leben lang Hindernisse in den Weg zu stellen, ganz gleich, wo oder wie. Obwohl ich eingewilligt hatte, diese Schule zu besuchen, damit sie mich und Gisselle nicht mehr zu sehen brauchte, gab sie sich nicht zufrieden. Sie wollte sichergehen, daß sie mir das Leben zur Qual machte.
»Hast du noch irgendwelche Fragen?« unterbrach Mrs. Ironwood meine Gedanken.
»Ja«, sagte ich. »Wenn ich aus einer rückständigen Welt komme, warum bin ich dann diejenige, die zur Verantwortung gezogen wird?«
Die Frage schien sie für einen Moment aus der Fassung zu bringen. Ich sah sogar für den Bruchteil einer Sekunde Bewunderung für meine Geistesgegenwart in ihren Augen aufblitzen.
»Trotz deiner Herkunft«, erwiderte sie bedächtig, »scheinst du aus besserem Rohmaterial gemacht zu sein und über ein größeres Potential zu verfügen. An diesen Aspekt deiner Person wende ich mich. Im Moment leidet deine Schwester noch unter den Folgen des Unfalls und unter der Beeinträchtigung. Sie ist noch nicht reif für Gespräche dieser Art.«
»Gisselle wird nie reif für Gespräche dieser Art sein. Vor ihrem Unfall war sie es auch nicht«, sagte ich.
»Dann wird es eben ein Teil deiner Last sein, sie dahin zu bringen, daß sie reif dafür ist, meinst du nicht auch?« entgegnete Mrs. Ironwood mit einem kühlen Lächeln und stand auf. »Du darfst jetzt wieder in dein Studierzimmer gehen.«
Ich erhob mich und verließ das Büro. Mrs. Randle blickte kurz zu mir auf, als ich an ihrem Schreibtisch vorbeikam. Trotz meiner tapferen Fassade zitterte ich innerlich so sehr, daß ich kaum laufen konnte. Ich war sicher, daß Daddy nichts von dem Fundament wußte, daß Daphne hier in Greenwood gelegt hatte. Hätte er davon gewußt, hätte er uns wahrscheinlich nicht hierhergebracht. Ich war versucht, ihn anzurufen und ihm davon zu erzählen, aber ich konnte mir ausrechnen, daß Daphne eine Möglichkeit finden würde, mir die Schuld zuzuschieben und mir Undankbarkeit vorzuwerfen, weil ich diese Gelegenheit nicht ergriff; außerdem würde sie mich bezichtigen, Gisselle diese Chance einer Besserung verpatzt zu haben.
Frustriert und im Schatten einer schwarzen Wolke der Verzweiflung ließ ich mich an meinem Schreibtisch nieder. Obwohl alles sehr aufregend war und die meisten meiner neuen Lehrer mir Freundlichkeit entgegenbrachten, blieb ich für den Rest des Morgens und den größten Teil des Nachmittags in der finsteren Stimmung, in die mich die Eiserne Jungfrau versetzt hatte, und meine Laune besserte sich erst, als ich zur letzten Unterrichtsstunde in Rachel Stevens’ Klasse kam.
Mein Verdacht, daß Miss Stevens sich in dem förmlichen Tweedkostüm und den hochhackigen Schuhen bei der Versammlung unwohl gefühlt hatte, erwies sich als richtig. Jetzt, im Kunstunterricht, erweckte sie eher den Eindruck einer Künstlerin und schien sich bei weitem wohler zu fühlen; sie hatte ihr Haar gelöst und trug es offen, und über ihrem kürzeren Rock und einer grellrosafarbenen Bluse trug sie einen Malerkittel. Dieser Kunstunterricht war ein reines Wahlfach und wurde folglich von weniger Schülerinnen besucht als die Pflichtkurse. Wir waren nur zu sechst, und darüber freute sich Miss Stevens.
Ich hatte keine Ahnung, daß Daddy – wie Daphne mit der Schule und Mrs. Ironwood Kontakt aufgenommen hatte, um meine Vergangenheit zu enthüllen – dafür gesorgt hatte, daß die Schule und meine Kunsterzieherin von meinen kleinen Erfolgen wußten. Miss Stevens war so freundlich, mich damit nicht vor den anderen Schülerinnen in Verlegenheit zu bringen, aber nachdem sie uns erklärt hatte, was sie in diesem Schuljahr mit uns vorhatte, und alle Mädchen mit Lehrbüchern versorgt waren, in denen sie herumstöbern konnten, kam sie auf mich zu und erzählte mir, was sie bereits wußte.
»Ich finde es wirklich aufregend, daß jetzt schon einige von deinen Bildern in einer Galerie hängen«, sagte sie. »Was zeichnest und malst du am liebsten? Tiere? Die Natur?«
»Ich weiß es nicht. Vermutlich ja«, sagte ich.
»Ich auch. Weißt du, was ich gern mit dir machen würde, falls du magst? Wir könnten an einem Samstag zum Fluß hinuntergehen und nach Motiven Ausschau halten. Was hältst du davon?«
»Das täte ich liebend gern.« Ich spürte, wie der Vorhang der Depression sich hob. Miss Stevens war außer sich vor Aufregung. Ihre Begeisterungsfähigkeit steckte mich an und ließ mein Verlangen, mich durch Zeichnungen und Gemälde auszudrücken, wieder aufleben. In der letzten Zeit hatte sich in meinem Leben so vieles getan, was meine Aufmerksamkeit von der Kunst abgelenkt hatte. Vielleicht konnte ich jetzt mit mehr Energie und zielstrebiger als früher zur Kunst zurückkehren.
Während die anderen weiterhin in den Schulbüchern blätterten, ließ Miss Stevens sich Zeit, mit mir zu reden; schnell wurde sie diejenige unter all meinen Lehrerinnen, zu der ich am ehesten einen persönlichen Kontakt fand.
»In welchem Wohnheim bist du untergebracht?« fragte sie. Ich sagte es ihr, und ich erzählte ihr auch, daß Gisselle im Rollstuhl saß. »Zeichnet und malt sie auch?«
»Nein.«
»Ich wette, sie ist stolz auf dich. Ich wette, deine ganze Familie ist stolz auf dich. Dein Vater ist es ganz bestimmt, soviel weiß ich«, sagte sie lächelnd. Sie hatte unglaublich warme, freundliche blaue Augen und auf beiden Wangen helle, kleine Sommersprossen. Ihre Lippen waren fast orange, und im Kinn hatte sie ein winziges Grübchen.
Statt etwas Unerfreuliches über Gisselle oder Daphne zu sagen, nickte ich nur.
»Ich habe genauso angefangen«, erzählte sie. »Ich bin in Biloxi aufgewachsen, und daher habe ich eine Menge Seebilder gezeichnet und gemalt. Eins davon habe ich über eine Galerie verkauft, als ich noch im College war«, berichtete sie stolz, »aber seitdem habe ich nichts mehr verkauft.« Sie lachte. »Das hat mir klar gemacht, daß ich mich besser dem Lehrberuf zuwende, wenn ich etwas essen und ein Dach über dem Kopf haben will.«
Ich fragte mich, warum eine Frau, die so hübsch, so reizend und talentiert war, nicht eine Heirat als eine weitere Alternative ins Auge faßte.
»Wie lange sind Sie schon Kunsterzieherin?« fragte ich. Das Hüsteln der anderen Schülerinnen zeigte mir, daß sie neidisch darauf waren, wieviel Zeit unsere neue Lehrerin mir widmete.
»Erst seit zwei Jahren. Ich habe an einer staatlichen Schule unterrichtet. Aber das hier ist ein wunderbarer Job. Hier kann ich meinen Schülerinnen viel mehr individuelle Betreuung zukommen lassen.«
Sie wandte sich den anderen zu. »Wir werden viel Spaß miteinander haben«, erklärte sie. »Ich habe nichts dagegen, wenn ihr Musik mitbringen wollt, die wir bei der Arbeit hören können; wir dürfen sie nur nicht zu laut spielen und andere Klassen damit stören.«
Sie lächelte mich noch einmal herzlich an und schilderte dann ihre Ziele für unseren Kurs, erklärte, daß sie uns erst das Zeichnen beibringen und dann zur Aquarell- und zur Ölmalerei übergehen wolle. Sie beschrieb das Arbeiten mit Ton, den Gebrauch der Brennöfen und die Kunstwerke, von denen sie hoffte, daß wir sie hervorbringen würden. Sie war so begeistert und mitreißend, daß ich enttäuscht war, als die Glocke zum Ende des Schultags läutete, aber ich wußte, daß ich nicht trödeln durfte. Gisselle würde mich schon in ihrem Klassenzimmer erwarten, damit ich sie zum Wohnheim zurückfuhr. Wir hatten keine anderen Abmachungen getroffen.
Als ich ankam, war sie jedoch bereits fort. Abby winkte mir vom Ende des Korridors zu und kam mir eilig entgegen. »Suchst du Gisselle?«
»Ja.«
»Ich habe gesehen, wie Samantha sie geschoben hat, und Kate und Jacki sind den beiden gefolgt. Wie war dein Tag?«
»Prima, wenn man von einem Gespräch absieht, das ich mit der Eisernen Jungfrau hatte.« Auf dem Weg zum Wohnheim berichtete ich ihr mehr.
»Wenn ich in ihr Büro bestellt würde, hätte ich fürchterliche Angst und würde damit rechnen, daß das nur eins bedeuten kann: Sie hat etwas über meine familiären Hintergründe in Erfahrung gebracht.«
»Selbst wenn es so wäre, würde sie es nicht wagen ...«
»Das ist mir schon passiert«, sagte Abby wissend, »und bestimmt wird es mir noch öfter passieren.«
Ich hätte ihr gern etwas Optimistisches gesagt und sie getröstet, aber die Eiserne Jungfrau hatte auch mich in eine düstere Stimmung versetzt. Auf unserem weiteren Weg zum Wohnheim waren wir beide stumm, bis wir das Geräusch eines Traktors hörten, uns umwandten und Buck Dardar sahen. Er sah uns auch und drosselte das Tempo, um in unsere Richtung zu schauen.
»Erinnerst du dich noch an den Abend?« fragte Abby. Wir mußten lächeln, und wir bewegten uns beschwingter und mit mehr Energie voran. Obwohl wir wußten, daß wir damit einen Verweis riskierten, winkten wir ihm zu. Er nickte, und selbst auf diese Entfernung sahen wir das Weiß seiner Zähne, als er lächelte. Lachend faßten wir einander bei den Händen und legten den Rest des Weges zum Wohnheim im Dauerlauf zurück.
Wir trafen nur etwa zehn Minuten nach Gisselle und den anderen dort ein, doch Gisselle tat so, als sei ich eine Stunde nach ihr gekommen.
»Wo warst du?« beklagte sie sich, sowie ich unser Zimmer betrat.
»Wo ich war? Warum bist du nach der letzten Stunde so schnell verschwunden? Ich habe dir doch gesagt, daß ich dich abhole.«
»Du hast mich ewig warten lassen. Was glaubst du denn, wie ich mich fühle, wenn ich in diesem blöden Rollstuhl sitze, während alle anderen verschwinden? Man kann mich doch nicht einfach abstellen und stehen lassen wie ein Möbelstück.«
»Ich bin direkt nach dem Läuten gekommen. Ich habe nur noch einen Moment mit meiner Lehrerin geredet.«
»Erzähl mir bloß nicht, es sei nur eine Minute gewesen. Und ich mußte dringend zur Toilette! Du kannst jederzeit einfach aufstehen und hingehen, wenn du willst. Du weißt doch, welche Schwierigkeiten ich jetzt mit den einfachsten Dingen habe. Du weißt es, und trotzdem trödelst du mit deiner Kunsterzieherin herum«, sagte sie und schüttelte mißbilligend den Kopf.
»Schon gut, Gisselle«; sagte ich, denn ich hatte ihr ständiges Meckern satt. »Es tut mir leid.«
»Was für ein Glück, daß ich jetzt andere Freundinnen habe, die sich um mich kümmern. Was für ein Glück.«
»Okay, schon gut.«
Die Wahrheit war, daß ich nie begriffen hatte, wie glücklich ich in New Orleans dran gewesen war, denn dort hatte ich mein eigenes Zimmer gehabt, mit Wänden, die uns voneinander trennten. »Wie waren deine Kurse?« fragte ich, um das Thema zu wechseln.
»Gräßlich. Die Klassen hier sind so klein, daß die Lehrer ständig hinter einem stehen und einen bei der kleinsten Kleinigkeit beobachten. Hier kann man sich einfach vor nichts drücken!«
Ich lachte.
»Was ist daran so komisch, Ruby?«
»Wahrscheinlich werden sich deine schulischen Leistungen hier gegen deinen eigenen Willen stark verbessern«, sagte ich.
»Ach, vergiß es. Es ist zwecklos, mit dir zu reden«, erwiderte sie. »Jetzt setzt du dich wahrscheinlich auch noch hin und machst dich gleich an deine Hausaufgaben, stimmt’s?«
»Abby und ich machen jetzt gleich unsere Hausaufgaben, damit wir es hinter uns haben.«
»Na, toll. Ihr werdet bestimmt bald zu den besten Schülerinnen von Greenwood zählen und Dutzende von Teegesellschaften besuchen«, höhnte sie und rollte zur Tür hinaus, um Jacki und Kate zu besuchen.
Mrs. Ironwood hatte gesagt, sie würde mich für Gisselle und ihr Benehmen zur Verantwortung ziehen? Ebensogut könnte ich versuchen, die Gewohnheiten einer Bisamratte zu ändern oder einen Alligator zu zähmen, dachte ich.
Unsere erste Woche in Greenwood verging wie im Fluge. Am Dienstagabend schrieb ich Briefe an Paul und Onkel Jean und schilderte ihnen alles genauestens. Am Mittwochabend rief Beau an. Das Telefon im Korridor direkt vor unserem Quadranten stand uns zur Verfügung. Jacki kam in unser Zimmer, um mir zu sagen, daß jemand mich sprechen wollte.
»Wenn es Daddy ist, dann will ich ihn auch sprechen«, verlangte Gisselle, die darauf versessen war, ihren Strom von Klagen nicht versiegen zu lassen.
»Es ist nicht euer Vater«, sagte Jackie. »Es ist ein gewisser Beau.«
»Danke«, sagte ich und eilte zum Telefon, ehe Gisselle in Jackis Gegenwart eine ihrer abscheulichen Bemerkungen machen konnte.
»Beau!« rief ich in die Sprechmuschel.
»Ich dachte, ich lasse dir erst mal einen Tag Zeit, damit du dich dort eingewöhnen kannst«, sagte er.
»Es ist so schön, deine Stimme zu hören.«
»Und ich finde es schön, dich zu hören. Wie läuft es?«
»Es ist ziemlich hart. Seit dem Augenblick unserer Ankunft hier macht mir Gisselle das Leben schwer.«
»Ich könnte nicht gerade behaupten, daß mir das nicht gelegen käme«, sagte Beau lachend. »Wenn sie es fertigbringt, daß ihr beide rausgeschmissen werdet, dann bist du wenigstens wieder hier.«
»Verlaß dich bloß nicht darauf. Wenn sie uns nicht hier behalten, dann findet meine Stiefmutter bestimmt eine andere Schule, in die sie uns schicken kann, und die ist dann vielleicht doppelt so weit weg von New Orleans. Wie läuft es bei dir mit der Schule?«
»Ohne dich ist es langweilig, aber ich suche mir Beschäftigung – mit dem Footballteam und dergleichen. Wie ist es dort, wo ihr jetzt seid?«
»Es ist eine schöne Schule, und die meisten Lehrer sind nett. Die Rektorin kann ich nicht leiden. Sie ist eine Tyrannin, kalt wie Stein, und Daphne hat sie bereits mit Geschichten über meine Cajun-Herkunft versorgt. Sie hält mich für ein Ungeheuer.«
»Wer?«
»Diese flachbrüstige Mädchenschinderin.« Ich lachte. »Sie glaubt eben, ich könnte einen schlechten Einfluß auf ihre ach so vollkommenen jungen kreolischen Damen haben.«
»Oh.«
»Aber der Unterricht macht mir Spaß, vor allem der Kunstunterricht.«
»Und was ist mit ... Jungen?«
»Hier gibt es keine, Beau, hast du das vergessen? Wann kommst du? Ich vermisse dich.«
»Ich versuche, es so hinzukriegen, daß ich am übernächsten Wochenende kommen kann. Mit diesem Training an den Wochenenden ist das ziemlich schwierig.«
»Oh, bitte, versuch es, Beau. Wenn du nicht kommst, werde ich vor Einsamkeit durchdrehen.«
»Ich komme ... irgendwie läßt es sich schon einrichten«, sagte er. »Natürlich muß ich es heimlich tun, sag also niemandem etwas ... am allerwenigsten Gisselle. Es sähe ihr wirklich ähnlich, dafür zu sorgen, daß meine Eltern davon erfahren.«
»Ich weiß. Seit dem Unfall hat sich ihre gemeine Ader nur noch verstärkt. Ach ja, ich habe mich mit einem der Mädchen in meinem Wohnheim angefreundet, aber ich bin nicht sicher, ob ich möchte, daß du sie kennenlernst.«
»Was? Warum denn das?«
»Sie ist sehr hübsch.«
»Ich habe nur Augen für dich, Ruby«, sagte er. »Begehrliche Blicke«, fügte er leise hinzu.
Ich lehnte mich an die Wand und schmiegte den Hörer an mein Ohr, als preßte ich ein süßes kleines Baby an die Wange. »Ich vermisse dich, Beau. Du fehlst mir wirklich.«
»Ich vermisse dich, Beau. Du fehlst mir wirklich«, hörte ich Gisselle, die mich nachäffte, und als ich mich umdrehte, sah ich sie mit Samantha und Kate direkt hinter mir im Korridor stehen. Sie grinsten.
»Verschwindet!« schrie ich. »Das ist ein Privatgespräch.«
»Es verstößt gegen die Vorschriften, in unseren Wohnheimen am Telefon anzügliche Dinge zu sagen«, höhnte Gisselle. »Lies Seite vierzehn, Paragraph drei, die zweite Zeile in unserer Informationsmappe.«
Kate und Samantha lachten.
»Was geht da vor?« fragte Beau.
»Es ist nur Gisselle, sie führt sich auf wie immer«, sagte ich. »Ich kann jetzt nicht weiterreden. Sie ist wild entschlossen, mir dieses Gespräch zu verderben.«
»Es ist ohnehin qualvoll, mit dir zu reden und dich nicht sehen zu können. Ich rufe dich sobald wie möglich wieder an«, sagte er.
»Versuch herzukommen, Beau. Bitte.«
»Ich werde mein Bestes tun«, versprach er. »Ich liebe und vermisse dich.«
»Mir geht es genauso«, sagte ich und warf einen wütenden Blick auf Gisselle und die Mädchen. »Tschüs.«
Ich knallte den Hörer auf die Gabel und drehte mich zu ihnen um.
»Warte nur ab. Warte nur ab, bis du einmal ungestört sein willst«, sagte ich zu ihr und stolzierte an den dreien vorbei.
Es nützte wenig, auf Gisselle wütend zu sein. Wenn es überhaupt etwas bewirkte, dann, daß sie es genoß, wenn ich mich ärgerte. Es war besser, sie schlichtweg zu ignorieren. Das störte sie nicht; sie hatte die Mädchen aus unserem Quadranten, die in den Zeiten vor dem Unterricht, zwischen den Schulstunden und in der Cafeteria anscheinend nur zu gern ihre Zeit in ihrer Gegenwart verbrachten. Von Samantha geschoben und Kate und Jacki neben sich, entwickelte sich Gisselle mit ihrem Gefolge schnell zu einer separaten Einheit, einer Clique, die so eng aufeinander klebte, daß es ganz den Eindruck erweckte, als würden sie von unsichtbaren Drähten zusammengehalten, die von Gisselles Rollstuhl ausgingen.
Der Rollstuhl machte eine Metamorphose durch und wurde zu einem rollenden Thron, von dem aus Gisselle ihre Wünsche und Befehle äußerte und ihr Urteil über andere Schülerinnen, Lehrer und Aktivitäten verhängte. Nach der Schule folgten die drei Mädchen Gisselle gehorsam zum Wohnheim, wo sie weiter hofhielt; sie unterrichtete sie in schlechtem Benehmen, schilderte ihnen ihre Eroberungen und animierte sie, Zigaretten zu rauchen und ihre Hausaufgaben zu vernachlässigen.
Nach und nach brachte Gisselle die anderen Mädchen gegen Vicki auf. Sogar die arme kleine Samantha verbrachte immer weniger Zeit mit ihrer Zimmergenossin und begann, Gisselles Verachtung nachzuahmen, vor Vickis Augen. Am Donnerstagabend brachte Gisselle Samantha dazu, Vicki ihren ersten Forschungsbericht zur europäischen Geschichte zu stehlen, einen Bericht, auf den sie sehr stolz war, da sie sich gleich an die Arbeit gemacht hatte und eine Woche vor dem Termin fertig geworden war. Das arme Mädchen war außer sich.
»Ich weiß, daß er bei meinen Büchern im Schrank gelegen hat«, beharrte sie; sie zog sich an den Haaren und biß sich auf die Lippen. Gisselle und die Mädchen saßen im Wohnzimmer und hörten sich ihre aufgewühlten, fassungslosen Klagen an. Immer wieder versuchte sie nachzuvollziehen, was sie damit getan haben, wo sie den Bericht versehentlich verlegt haben könnte. Ein Blick in Samanthas Gesicht genügte, und mir wurde klar, wozu sie sich von Gisselle hatte überreden lassen.
»Ich hatte nur diese eine Ausfertigung. Ich habe stundenlang daran gesessen, stundenlang!«
»Wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich ohnehin alles auswendig gelernt«, sagte Gisselle. »Schreib ihn doch einfach noch mal.«
»Aber ... meine Quellen ... meine Zitate ...«
»Ach, die Zitate habe ich ganz vergessen«, sagte Gisselle. »Hat jemand irgendwelche Zitate?«
Ich zog Samantha zur Seite, indem ich sie grob in den Oberarm kniff.
»Hast du Vicky den Bericht weggenommen?« fragte ich.
»Es ist doch nur ein kleiner Scherz. Wir geben ihn ihr bald wieder zurück.«
»Es ist überhaupt nicht komisch, jemanden solche Qualen ausstehen zu lassen und sich darüber lustig zu machen. Gib ihn ihr sofort zurück«, befahl ich.
»Mein Arm! Du tust mir weh.«
»Tu es, oder ich hole Mrs. Penny, die Mrs. Ironwood benachrichtigen müssen wird.«
»In Ordnung.« In ihren Augen standen Tränen des Schmerzes, aber das war mir gleich. Wenn sie Gisselles kleine Sklavin sein wollte, dann würde sie auch dafür büßen.
Vicki ging wieder in ihr Zimmer, um noch einmal alles zu durchwühlen.
»Das war überhaupt nicht komisch, Gisselle«, sagte ich. Sie sah Samantha an und dann mich. »Was war nicht komisch?«
»Samantha anzustacheln, daß sie Vicki den Bericht wegnimmt.«
»Ich habe sie zu nichts angestachelt. Sie ist von allein auf die Idee gekommen. Stimmt’s, Samantha?«
Gisselles fester Blick genügte. Samantha nickte.
»Gib ihn ihr augenblicklich zurück«, sagte ich. Samantha griff unter das Sofa, um den Bericht hervorzuziehen. Auf ihrem Gesicht malte sich Entsetzen. Sie kniete sich hin und suchte.
»Er ist nicht da«, sagte sie erstaunt. »Aber dort habe ich ihn doch hingetan.«
»Gisselle.«
»Ich weiß von nichts«, sagte meine Schwester selbstgefällig.
Plötzlich drang ein Schrei aus dem Zimmer von Vicki und Samantha. Wir eilten hin und sahen Vicki auf dem Bett sitzen. Auf dem Schoß hielt sie ihren Bericht, er war klatschnaß.
»Was ist passiert?«
»Ich habe ihn so unter der Kommode gefunden«, schrie sie. »Jetzt muß ich alles noch einmal abschreiben.« Sie sah Samantha haßerfüllt an.
»Das war ich nicht«, sagte Samantha. »Wirklich nicht.«
»Jemand muß es doch gewesen sein.«
»Vielleicht warst du es selbst, und jetzt versuchst du, einer von uns die Schuld zuzuschieben«, warf Gisselle ihr vor.
»Was? Weshalb sollte ich so etwas tun?«
»Einfach nur, um anderen Schwierigkeiten zu machen.«
»Das ist lachhaft. Vor allem, wenn man bedenkt, daß ich jetzt alles noch einmal abschreiben muß!«
»Dann solltest du anfangen, ehe die Tinte ganz verlaufen ist«, schlug Gisselle vor. Sie machte kehrt, und die Mädchen folgten ihr aus dem Zimmer.
»Abby und ich werden dir helfen, Vicki«, sagte ich.
»Danke, aber ich mache es lieber selbst.« Sie wischte sich die Tränen von den Wangen.
»Manchmal bringt man ja doch noch Korrekturen an, wenn man etwas noch einmal abschreibt«, sagte Abby.
Vicki nickte. Dann richtete sie den Blick kühl auf mich. »Solche Dinge sind hier früher nie vorgekommen«, sagte sie.
»Es tut mir leid«, sagte ich. »Ich werde mit Gisselle reden.«
Am späteren Abend hatten wir eine Auseinandersetzung. Gisselle beharrte darauf, daß sie den Bericht nicht in die Toilette getunkt habe, und sie gab sich sogar verletzt, weil ich ihr etwas Derartiges unterstellte. Aber ich glaubte ihr nicht.
Am nächsten Tag überraschte Gisselle mich mit einem Vorschlag.
»Vielleicht sollten wir doch nicht in einem Zimmer wohnen«, sagte sie. »So gut kommen wir nun auch wieder nicht miteinander aus, und wir können nicht wirklich andere Leute kennenlernen, wenn wir die meiste Zeit nur zusammen sind.«
»Wir sind doch kaum zusammen. Ich habe dich die ganze Woche über so gut wie nie zu sehen bekommen«, sagte ich. »Aber das ist nicht meine Schuld.«
»Das habe ich auch nicht behauptet. Ich denke mir nur, es könnte besser sein, wenn du dir ein Zimmer mit Abby teilst, mit der du dich angefreundet hast, und wenn ich mir das Zimmer mit jemand anderem teile.«
»Mit wem?«
»Mit Samantha«, sagte sie.
»Du meinst, Vicki will sich das Zimmer nicht mehr mit ihr teilen, seit ihr ihr diesen Streich gespielt habt, stimmt’s?«
»Nein. Samantha hält es einfach nicht mehr mit Vicki aus; die ist derart in ihre Schularbeiten vertieft, daß sie sogar die Körperhygiene vernachlässigt.«
»Was soll denn das schon wieder heißen?«
»Samantha sagt, Vicki hat vor zwei Tagen ihre Periode bekommen, hat sich aber immer noch nicht die Zeit genommen, sich Binden zu besorgen. Sie stopft sich Toilettenpapier in die Unterhose«, erwiderte Gisselle und schnitt eine Grimasse.
»Das glaube ich nicht.«
»Weshalb sollte ich lügen? Frag sie doch selbst. Geh doch hin, und frag sie, was sie in der Unterhose hat. Geh schon!« kreischte sie.
»Gisselle. Schon gut, beruhige dich. Ich glaube dir ja.«
»Schieb bloß nicht Samantha die Schuld an allem zu«, sagte sie. »Also, was ist?«
»Womit?«
»Willst du bei Abby einziehen und Samantha hier wohnen lassen oder nicht?«
»Aber was ist mit der Sonderbehandlung, die du brauchst?«
»Samantha ist bereit, alles für mich zu tun«, sagte Gisselle.
»Ich weiß nicht recht. Daddy paßt das vielleicht ganz und gar nicht.«
»Natürlich paßt es ihm. Solange es mich glücklich macht«, fügte sie lächelnd hinzu.
»Ich weiß nicht, wie Abby dazu steht«, sagte ich leise und begeisterte mich insgeheim für diese Idee.
»Sie wird sich freuen. Ihr beide seid wie ... wie Schwestern«, sagte Gisselle und sah mich scharf an. War das, was ich in ihren Augen sah, Eifersucht oder Neid, oder war es nur blanker Haß?
»Ich werde mit Abby darüber reden«, antwortete ich. »Ich nehme an, ich könnte immer noch hierher zurückziehen, wenn es sich nicht bewährt. Aber was ist mit all deinen Sachen, die du unbedingt mitnehmen wolltest? Im Moment dürfte in Abbys Zimmer nicht genug Platz für meine Sachen sein.«
»Ich werde einiges von Mrs. Penny einlagern lassen«, erwiderte Gisselle eilig. Offensichtlich war sie bereit, jedes Hindernis zu überwinden, um zu bekommen, was sie wollte. »Und du hast ohnehin nicht viel mitgenommen.«
»Ich weiß, warum du mich loswerden willst«, sagte ich streng. »Du willst nicht, daß ich dich dränge, deine Hausaufgaben zu machen. Aber daß ich in ein anderes Zimmer ziehe, heißt noch lange nicht, daß ich nicht versuchen werde, dafür zu sorgen, daß du deine Sache gut machst, Gisselle.«
Sie stieß einen tiefen Seufzer aus.
»Also, gut. Ich verspreche dir, daß ich mich anstrengen werde. Samantha ist nun einmal zufällig eine gute Schülerin, verstehst du. Sie hat mir jetzt schon viel in Mathe geholfen.«
»Was du damit sagen willst, ist, daß sie die Hausaufgaben für dich gemacht hat. Das hilft dir auch nicht, den Stoff zu lernen.«
Gisselle verdrehte die Augen.
Ich hatte ihr nichts von meinem Gespräch mit Mrs. Ironwood erzählt. Ich dachte, wenn sie wüßte, was bei diesem Anlaß gesagt worden war und daß man mir die Verantwortung für sie übertragen hatte, würde sie einen Wutausbruch bekommen und darauf bestehen, nach Hause zurückzugehen. Aber jetzt war ich versucht, ihr davon zu berichten.
»Wenn du schlechte Noten schreibst, bekomme ich irgendwie auch die Schuld daran zugeschoben«, sagte ich.
»Warum? Du wirst deine Sache schon gut machen. Du hast schon immer gute Noten bekommen«, murrte sie.
»Von mir wird das erwartet«, sagte ich und kam damit einer Schilderung meines Gesprächs mit Mrs. Ironwood noch näher. Natürlich verstand Gisselle kein Wort.
»Also, ich erwarte es nicht von dir! Siehst du, wie du ständig an mir herumnörgelst? Ich brauche meine Ruhe. Ich muß auch mit anderen Menschen zusammensein.«
»In Ordnung, Gisselle. Beruhige dich. Die anderen Mädchen werden dich hier besuchen.«
«Wirst du mit Abby reden?«
»Ja«, sagte ich. Vielleicht hätte ich nicht so leicht nachgeben sollen, aber die Aussicht, ihr zu entkommen, war einfach zu verlockend. Ich sprach mit Abby über Gisselles Vorschlag, und sie war sehr erfreut.
Am selben Abend zogen wir um. Vicki war keineswegs beleidigt, sondern offensichtlich froh, ein Zimmer für sich allein zu haben. Sie half Samantha sogar, ihre Sachen rüberzutragen. Natürlich mußten wir Mrs. Penny Bescheid geben; sie wirkte anfangs besorgt, änderte ihre Haltung aber schnell, als sie sah, wie froh Gisselle war.
»Solange ihr alle miteinander auskommt, nehme ich an, spielt es keine Rolle, wie ihr die Dinge regelt«, schloß sie. »Aber vergiß eins nicht, Gisselle: Du, deine Schwester und Abby, ihr drei geht morgen zum Tee zu Mrs. Clairborne. Wir werden pünktlich um zehn vor zwei das Wohnheim verlassen. Mrs. Clairborne legt Wert auf Pünktlichkeit.«
»Ich kann es kaum erwarten«, sagte Gisselle. Sie klapperte mit den Lidern und zog eine Schulter vor. »Ich habe schon mein bestes Nachmittagskleid und passende Schuhe herausgelegt. Ist Hellblau eine akzeptable Farbe?«
»Ja, da bin ich ganz sicher«, sagte Mrs. Penny. »Ist es nicht wunderbar? Ach, ich wünschte, ich wäre noch einmal ein junges Mädchen, für das alles gerade erst anfängt und das so viele neue Erfahrungen sammelt. Ich vermute, deshalb liebe ich meine Arbeit. Sie gibt mir Gelegenheit, auf dem Umweg über euch immer wieder eine junge Frau zu sein.«
Sowie sie außer Hörweite war, klatschte Gisselle in die Hände und begann, sie nachzuahmen.
»Ach, ich wünschte, wieder Jungfrau zu sein«, rief sie, »damit ich die Liebe immer wieder neu erleben kann.«
Gisselles Fanclub, wie ich ihn schon bald zu nennen begonnen hatte, lachte und spornte sie an. Dann schleppte sie alle in das Zimmer, das bisher unser gemeinsames gewesen war, um vor ihrem getreuen Publikum eine weitere Geschichte über Promiskuität auszuspinnen. Ich war froh, daß ich die Tür schließen und mich in die Stille von Abbys Zimmer zurückziehen konnte, das jetzt auch meines geworden war.
In jener Nacht lagen wir stundenlang wach und erzählten einander Geschichten aus unserer Kindheit. Sie begeisterte sich für alles, was ich ihr über Grandmère Catherine und ihre Arbeit als Heilerin erzählte. Ich erklärte ihr, welchen Rang eine Heilerin bei den Cajun einnahm und welchen Zauber Grandmère hatte wirken können, um Leute von ihren kleinen Leiden zu heilen und von ihren Ängsten zu befreien.
»Du hast das große Glück gehabt, eine Großmutter zu haben«, sagte Abby. »Ich habe meine Großeltern nie kennengelernt. Da wir so schrecklich oft umgezogen sind, habe ich zu niemandem in meiner Familie viel Kontakt gehabt. Gisselle weiß gar nicht, wie glücklich sie dran ist«, fügte sie nach einem Moment hinzu. »Ich wünschte, ich hätte eine Schwester.«
»Jetzt hast du eine«, sagte ich.
Sie schwieg lange und schluckte die Tränen herunter – ebenso wie ich meine Tränen zurückhielt.
»Gute Nacht, Ruby. Ich bin froh, daß wir jetzt Zimmergenossinnen sind.«
»Gute Nacht. Ich auch.«
Ich war froh, sehr froh. Ich fürchtete nur, Daddy würde außer sich sein und alle würden mir vorwerfen, ich sei zu egoistisch. Aber irgendwie rechnete ich damit, daß Samantha Gisselle ohnehin bald nicht mehr gewachsen sein würde, und dann würde sie darum bitten, wieder in ihr früheres Zimmer ziehen zu dürfen. Das Beste wird sein, ich genieße die Situation, solange es geht, dachte ich mir, und zum erstenmal seit unserer Ankunft schlief ich zufrieden ein.