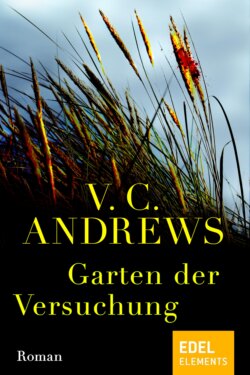Читать книгу Garten der Versuchung - V.C. Andrews - Страница 10
ОглавлениеKAPITEL VIER
Verborgene Vergangenheit
Geraldine rief mich nicht zum Essen, und ich verließ mein Zimmer erst um neun Uhr. Ich wusste, sie würde dann entweder Musik hören, eines ihrer Erweckungspredigerprogramme im Fernsehen schauen oder einfach in ihrem Sessel dösen. Überrascht stellte ich fest, dass sie bereits ins Bett gegangen war. Ich begrüßte die Stille und machte mir eine heiße Schokolade.
Während ich dort saß, dachte ich darüber nach, wie die Mädchen auf mein Geheimnis und meine Unkenntnis über meine Vergangenheit reagiert hatten. Vielleicht sollte ich Jades Auftrag ernster nehmen. Ich lauschte eindringlich, ob ich irgendwelche Geräusche hörte, dass Geraldine sich in ihrem Zimmer bewegte, aber ich hörte nichts. Also stand ich auf, stellte Tasse und Untertasse leise in den Geschirrspüler und ging in die Speisekammer. Dort knipste ich das Licht an und schaute hoch.
Es gab einen Stauraum, den man durch eine kleine quadratische Tür in der Decke der Speisekammer erreichte. Ich hatte gelegentlich gehört, wie Geraldine davon sprach, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie jemals die kleine Tür geöffnet hätte und dort hinaufgeklettert wäre, um irgendetwas zu holen.
Jetzt starrte ich dort hinauf und überlegte. In keinem anderen Raum des Hauses außer dem Schlafzimmer meiner Eltern konnte irgendetwas wie alte Dokumente, Fotos, was auch immer, aufbewahrt werden. Ich hatte nie in Geraldines Schränke geschaut, aber mein Verdacht richtete sich auf diesen Speicherraum. In der Garage hatten wir eine Trittleiter. Ich ging hinaus und holte sie so leise wie möglich ins Haus. Es war nicht einfach, die Leiter durch die Türen zu befördern, und so stieß ich damit gegen den Pfosten der Küchentür.
Mir blieb das Herz stehen. Langsam begann es wieder zu schlagen, während ich lauschte, ob Geraldine irgendetwas gehört hatte und aufgestanden war, um nachzuschauen. Sie horchte oft, während sie schlief, mit einem Ohr, ob Einbrecher kämen, denn wir besaßen kein Alarmsystem. Das Haus knarrte, als Sturmböen vom Meer hereinpeitschten, aber ich hörte keinerlei Schritte oder das Öffnen von Türen.
Da ich mich sicher fühlte, setzte ich den Weg zur Speisekammer fort, stellte die Leiter auf und kletterte zur Decke hinauf. Die Tür des Speicherraumes schien festzuklemmen. Wie ich vermutet hatte, war sie sehr lange, vielleicht seit Jahren, nicht mehr geöffnet worden. Es war schwierig, dagegen zu drücken, ohne ein Geräusch zu machen; einmal rutschte ich fast von der Leiter.
Schließlich gab die kleine Tür meinen Anstrengungen nach und sprang auf. Man musste sie zur Seite schieben. Zentimeter für Zentimeter bewegte ich die Tür und versuchte dabei, auch das geringste Geräusch zu unterdrücken. Als ich hochschaute, wurde mir klar, dass es dort kein Licht gab. Deshalb musste ich die Leiter wieder hinunterklettern und die Taschenlampe aus dem Schrank unter der Spüle holen. Als ich sie anknipste, waren die Batterien leer. Alles in diesem Haus schien sich gegen mich verschworen zu haben und versuchte mich davon abzuhalten, irgendwelche Spuren meiner eigenen Vergangenheit zu finden. Glücklicherweise zahlte sich aus, dass Geraldine davon besessen war, alles im Haushalt zu inventarisieren. In der Schublade, die für Werkzeuge bestimmt war, fand sich ein Vorrat an frischen Batterien. Rasch setzte ich die Taschenlampe in Gang und kehrte zur Leiter zurück. Auf dem Weg nach oben schlich ich praktisch auf Zehenspitzen.
Der Lichtstrahl enthüllte eine Wand aus Spinnweben auf jeder Seite der Öffnung. Der Staub war so dicht, dass er wie eine zweite Holzschicht wirkte. Aber zu meiner Rechten sah ich eine Reihe von Kartons, die mit dicker Kordel zusammengeschnürt waren. Keiner von ihnen trug ein Schild. Noch einmal stieg ich die Leiter herunter, diesmal, um mir ein Messer zu holen, mit dem ich die Kordeln durchschneiden konnte. Ich kletterte wieder hoch und stemmte mich in den Speicher, ohne auf Spinnweben und Staub zu achten. Auf Händen und Knien krabbelte ich zu den Kartons.
Einen Augenblick saß ich dort, am ganzen Körper zitternd, und lauschte noch einmal, ob ich nicht entdeckt worden war. Es war sehr still. Selbst das Knarren im Haus schien aufgehört zu haben, als hielte das Gebäude selbst den Atem an. Ich schnitt mit dem Messer die Kordeln des ersten Kartons auf. Dann öffnete ich ihn und leuchtete mit der Taschenlampe hinein.
Ordentlich zusammengepackt, jedes Teil in Zellophan gehüllt, lagen dort alte Spielsachen, Spielzeug für ein kleines Mädchen: Püppchen, Puppenkleider, Teetassen und Teller, Spielzeugmöbel und ein Puppenhaus, das sorgfältig auseinander genommen worden war. Behutsam hob ich jedes Teil heraus und inspizierte es. Jemand hatte Tränen auf die Wangen einiger Puppen gemalt. Dass sie aufgemalt waren, erkannte ich daran, dass die Tränen ungleichmäßig waren. Das Gesicht einer Puppe war zertrümmert, als wäre jemand mit einem Hammer darauf losgegangen.
Waren das einmal meine Puppen? Keine von ihnen kam mir bekannt vor. Waren sie von Geraldine? Warum waren sie hier versteckt? Als ob jemandes Kindheit geheim gehalten oder für immer begraben werden sollte.
Ich wandte mich dem Karton zu meiner Rechten zu und zerschnitt die Kordeln. Wieder öffnete ich ihn langsam und richtete den Strahl der Lampe auf Gegenstände, die in Zellophan verpackt waren, nur handelte es sich diesmal um Kleidung. Ich holte ein Teil aus der Verpackung und hielt es hoch: ein hellgelbes Kleidchen für ein Kleinkind. Ich schaute mir das nächste Kleidungsstück an und das nächste, holte jedes heraus und untersuchte es mit dem gleichen Ergebnis: Kleidungsstücke für ein sehr kleines Kind. Alle wirkten neu, ungetragen. Wessen Kleidung war das? Meine? Geraldines? Warum wurden sie hier aufgehoben, statt verschenkt oder sogar weggeworfen zu werden, was Geraldine für gewöhnlich mit alten, abgetragenen Sachen machte?
Ich drehte mich um und glitt nach links, um den nächsten Karton zu öffnen, indem ich die Kordeln zerschnitt und die Deckel aufriss. Hier fand ich Erinnerungsstücke: Schnipsel von hübschen Bändern, juwelenbesetzte Kämme, Amulettarmbänder für winzig kleine Handgelenke, ein paar vergoldete Babyschuhe, eine Zigarrenkiste voller alter Bilder und ein handbemaltes Schmuckkästchen, das auch eine Spieluhr war. Als ich es öffnete, fing sie jedoch nicht an zu spielen, weil sie nicht aufgezogen war. Ich war froh darüber. Die Musik hätte Geraldine möglicherweise aufgeweckt. Auch in der Kiste war alles ordentlich in Zellophan eingepackt. Wessen Sachen waren das?
Mit noch größerer Beklommenheit wandte ich mich dem letzten Karton zu, zerschnitt die Kordeln und öffnete ihn langsam. Oben lag eine Decke aus einem Babybettchen mit einem Stück duftender Seife darauf. Ich nahm sie behutsam heraus und legte sie beiseite. Darunter lag ein kleiner Packen Briefumschläge, die mit einem dicken Gummiband zusammengeschnürt waren, und sonst nichts. Die Gummis zerfielen, noch bevor ich versuchte, sie abzustreifen. Auf keinem der Umschläge stand eine Adresse oder ein Name. Ursprünglich waren sie rosa gewesen, im Laufe der Zeit aber verblasst zu einer hellen Cremefarbe. Alle waren geöffnet worden.
Ich holte den Brief aus dem obersten Umschlag und faltete ihn auseinander.
Er begann »Liebe Cathy«. Ich schnappte nach Luft. Wer hatte mir geschrieben?
»Ich weiß, dass du meine Briefe erst lesen wirst, wenn du viel älter bist als jetzt. Meine Tochter Geraldine hat mir versprochen, dass sie dir die Briefe geben wird, wenn du alt genug bist, sie zu verstehen. Wenn du sie bekommst, wirst du auch die Wahrheit über deine Geburt erfahren.
Was für eine seltsame Art für eine Mutter, sich ihrem eigenen Kind vorzustellen, aber dazu sind diese Briefe da. All die Jahre, bevor du diese Briefe in Händen hältst, wirst du an mich als deine Großmutter denken. Ich kann dir gar nicht sagen, was für ein seltsames Gefühl es für mich ist, dass du mich Großmutter nennst und ich so tue, als seist du meine Enkelin und nicht meine Tochter. Ich hoffe, du kannst schließlich begreifen, warum das so sein musste.
Das Wunderbarste, was eine Mutter ihrer Tochter geben kann, sind ihre eigenen Erfahrungen. Dies ist wirklich das einzige Erbe, das zählt. Ich bin mir sicher, dass Geld kein Problem für dich ist, deshalb ist mein Schmuck oder der Treuhandfonds, der dir an deinem achtzehnten Geburtstag übergeben wird, nur ein Bettel, wenn es darum geht, was eine Mutter einer Tochter geben kann.«
Treuhandvermögen? Geraldine hatte mir gegenüber nie ein Treuhandvermögen erwähnt. Wann wollte sie das tun? Es dauerte nur noch ein Jahr bis zu meinem achtzehnten Geburtstag. Ich kehrte wieder zu dem Brief zurück.
»Anfangen möchte ich damit, dass ich dir die erste aufrichtige Information mitteile, seit du die Wahrheit über dich selbst erfahren hast. Ich habe nie eine gute und glückliche Ehe geführt. Ich heiratete aus den falschen Gründen. Meine Mutter stolzierte immer um mich herum, wenn ich mich für eine Party anzog, und hämmerte mir ein: ›Denk daran, Liebes, man kann sich genauso leicht in einen reichen Mann verlieben wie in einen armen.‹ Sie ließ mich glauben, dass man das Verlieben völlig unter Kontrolle hatte und man seine tiefsten Gefühle in jede beliebige Richtung lenken konnte, wann immer man wollte. Sie lachte bei der bloßen Vorstellung, dass die Liebe sich auf wundersame Weise ereignete, dass Glocken in deinem Kopf oder in deinem Herzen läuteten, dass du quer durch ein Zimmer schauen, einen völlig Fremden sehen und plötzlich spüren konntest, dass deine Seele vor Glück erblühte. All das sei nur Quatsch. Das war ihr Lieblingswort für die meisten Dinge, die sie bestritt oder nicht glaubte: Quatsch. Es war ein Ausdruck ihres Vaters. Ich hasste es, hasste es, dieses Wort zu hören, sagte es ihr aber nie ins Gesicht.
Ein gehorsameres Kind als mich konntest du kaum finden. Ich wuchs in einem Haushalt auf, der eher an eine kleine Monarchie als an alles andere erinnerte. Mein Vater war der König, meine Mutter die Königin und ich bloß einer der Untertanen. Wenn der eine oder die andere etwas verkündete, krachte diese Last mit göttlichem Gewicht auf meine kleinen Schultern. Mein Vater glaubte, zuerst käme die Furcht und dann, quasi als nachträglicher Einfall, die Liebe. Er wollte, dass ich Angst vor ihm hatte, und er bekam, was er wollte.
All dies ist eine Vorbereitung für meine Erklärung, warum ich tat, was du nur schwer verstehen kannst … warum ich dich weggab. Ich gab dich ja nicht wirklich weg, sondern verschob dich an einen anderen Platz in unserer Familie. Ich wusste, dass ich dich nicht als meine Tochter aufziehen konnte. Dennoch konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dass du bei völlig Fremden leben solltest. Ich wollte dich sehen können, wann immer ich wollte und so oft ich wollte. So zu tun, als sei ich deine Großmutter, gab mir die Gelegenheit, dir Liebe und Zuneigung zu beweisen, etwas, das mir sonst nie möglich gewesen wäre. Ich hoffe, ich werde das noch sehr lange tun können und eines Tages, nachdem du meine Briefe gelesen hast, können wir uns hoffentlich einmal treffen, nur wir beide, und ich kann dich umarmen, so wie eine Mutter ihre Tochter umarmt, und du lernst vielleicht, mich so zu umarmen, wie eine Tochter ihre Mutter umarmt. Vielleicht ist das nur eine Fantasie. Uns ist nicht klar, wie kostbar und selten Fantasien werden können, wenn wir älter werden und gezwungen sind, die kalte Realität anzuerkennen.
Ein weiterer Grund, warum ich dich Geraldine gab, ist, dass Geraldine meinem Mann und mir eine gehorsamere Tochter ist, als ich meinen Eltern war. Ich wusste, sie würde alles tun, was man ihr sagte und genau wie man es ihr sagte. Mein Mann und ich waren wohl keine besseren Eltern als meine und führten unsere Familie ebenso wie die kleine Monarchie, in der ich aufwuchs. Zumindest benahmen wir uns so zueinander.
Geraldine ist ganz anders als ich. Sie gleicht eher meinem Mann, aber manchmal glaube ich, sie ist besser dran, so wie sie ist, weil ich auf eine Weise leide, die sie nie kennen lernen wird. Sie hat nie wirklich leidenschaftlich geliebt und diese Liebe verloren.
Ich habe das, und wenn du diesen Brief liest, bist du vermutlich alt genug, um daraus, noch bevor ich es dir sage, zu schließen, dass der Mann, den ich liebte, wirklich leidenschaftlich liebte, dein leiblicher Vater war.
Ich schaue jetzt auf die Uhr und sehe, wie viel Zeit es gebraucht hat, diese Gedanken niederzuschreiben. Ich muss jetzt aufhören. Der Mann, den du als deinen Großvater kennst, ruft mich. Wir sind auf dem Weg zu einem seiner Geschäftsessen, und die sind immer so wichtig, dass wir keine Minute zu spät kommen dürfen. Ich hätte wohl früher anfangen sollen, dies zu schreiben, aber (vielleicht findest du das amüsant oder interessant) ich betrachtete mich im Spiegel und sah plötzlich dich. Ich sah mich in deinem Gesicht, und ich dachte, wenn nun die Zeit vorübergeht und wir einander nie ehrlich anschauen? Das gab meinem Herzen einen Stich der Angst, ich setzte mich sofort hin und begann zu schreiben.
Natürlich werde ich immer wieder schreiben. Jetzt muss ich diesen Brief verstecken, genau wie ich meine wahren Gefühle verstecken musste. Meine Finger zittern, während ich diesen Brief unterschreibe.
In Liebe
Mutter«
Ich saß einen Moment mit dem Brief in der Hand da und schaute dann zu den anderen Kartons. All das mussten Sachen sein, die sie mir gegeben hatte, aber ich erkannte nichts davon. Geraldine hatte sie mir vorenthalten. Bestimmt war das so, aber warum sollte sie mir Spielsachen und Decken, Kämme und Schmuck vorenthalten?
Plötzlich hörte ich unten ein Geräusch, ein lautes Klappern von Holz. Mein Herz machte einen Satz. Ich drehte mich um und schaute durch die Speichertür nach unten. Meine Leiter! Sie war weg! Ich hörte, wie sie davongetragen wurde.
»Mutter!«, schrie ich. »Mutter!«
Sie hatte die Leiter in die Garage zurückgebracht. Ein paar Minuten später tauchte sie in der Speisekammer auf. Sie trug ihren Morgenmantel und Pantoffeln und schaute zu mir hoch.
»Warum hast du die Leiter fortgenommen?«
»Wer hat dir gesagt, du sollst dort hinaufgehen?«, erwiderte sie stattdessen.
»Ich wollte sehen, was hier oben war«, sagte ich. »Wie soll ich jetzt hinunterkommen?«
»Seit wann schnüffelst du so in unserem Haus herum? Seit wann tust du etwas, ohne mich zuerst zu fragen? Ich kann dir sagen seit wann. Seit du mit dieser Psychotherapeutin angefangen hast und diesen bösen Mädchen. Du gehorchst mir einfach nicht, gehst schwimmen und tust wer weiß was, und dann kommst du nach Hause und fängst an herumzuschnüffeln. Glaubst du, das sei alles ein Zufall? Hm? Ich nicht. Ich habe dir gesagt, dass das passieren würde. Ich habe dich gewarnt.«
»Bring bitte die Leiter zurück«, bettelte ich. »Wie soll ich denn hier herunterkommen?«
»Du wolltest dort oben sein. Dann bleib auch dort«, sagte sie und wandte sich ab.
»Es ist unheimlich hier oben. Ich kann doch nicht hier bleiben. Hör auf«, rief ich.
Sie blieb in der Tür stehen und schaute zu mir hoch.
»Du hast dir dein Bett für die Nacht bereitet. Jetzt schlaf auch dort«, sagte sie.
»Warte«, rief ich. »Was ist mit all diesen Sachen? Warum hast du mir diese Briefe nie gegeben?«
Sie drehte sich wieder um, und ohne mir zu antworten drehte sie das Licht in der Speisekammer aus, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich.
»Mutter!«, rief ich, dann schaute ich hinunter auf den Brief in meinen Händen und schrie: »Geraldine!«
Ich wartete, aber sie kehrte nicht zurück. Dadurch, dass ich alle Kartons geöffnet und in diesem winzigen Stauraum herumgekrochen war, hatte ich dicken Staub aufgewirbelt. Davon musste ich husten und niesen und fühlte mich am ganzen Körper dreckig. Ich beugte mich über die Einstiegsluke und richtete die Taschenlampe nach unten. Es sah aus, als seien es mindestens drei Meter bis zum Boden. Ich musste mich vorsichtig herunterlassen, mit den Händen festhalten und dann versuchen, auf die Füße zu fallen. Wie dumm. Was glaubte sie eigentlich, was ich tun würde, bis zum Morgen hier bleiben?
Ich steckte die Briefe in den Karton zurück und schloss ihn. Dann ging ich an der Tür des Speicherraumes in Position. Es war unmöglich, gleichzeitig die Taschenlampe festzuhalten. Ich überlegte mir, ob ich sie unten auf den Boden fallen lassen sollte, aber vermutlich würde sie dabei zerbrechen. Deshalb stopfte ich sie in meine Bluse. Danach begann ich, mich durch die jetzt sehr dunkle Öffnung herabzusenken. Mein Herz klopfte so heftig, dass ich Angst hatte, keine Luft mehr zu bekommen und zu fallen. Meine Finger waren anscheinend nicht kräftig genug, um mich an den Seiten festzuhalten. Das ist so verrückt, dachte ich ständig. Warum hat sie das getan?
Ich drehte meinen Körper und ließ mich mit zitternden Beinen durch die Öffnung hinunter. Als das volle Gewicht meines Körpers auf Händen und Handgelenken ruhte, rutschten meine Finger ab und ich riss mir Splitter ein. Ich verlor mit der rechten Hand den Halt. Schreiend stürzte ich nach unten und stieß unbeholfen auf dem Boden auf. Mein linker Fuß traf zuerst auf, drehte sich unter meinem Körper und wurde darunter eingequetscht. Ich hörte, wie der Knochen knackte.
Mit dem Kopf stieß ich so hart auf den Boden auf, dass ich Sternchen sah und ein schneidender Schmerz mir durch Hals und Schultern fuhr. Ich bekam keine Luft mehr, keuchte und zog mein linkes Bein unter mir hervor, aber die Schmerzen waren so stark, dass ich nicht schnell genug atmen konnte. Ich muss ein paar Sekunden oder sogar eine ganze Minute das Bewusstsein verloren haben. Als ich die Augen wieder öffnete, herrschte um mich herum nur Dunkelheit. Mein Knöchel schien einen eigenen Mund zu haben und seinen Schmerz in das Bein hinauf zu schreien. »Mutter!«, rief ich. »Hilf mir!«
Weinend zog ich mich vorwärts. Ich versuchte es, konnte aber auf dem Gelenk nicht stehen. Ich griff in meine Bluse und zog die Taschenlampe heraus. Dann schleppte ich mich in Richtung Tür. Nachdem ich halb kriechend, halb rutschend hindurchgelangt war, hievte ich mich an der Arbeitsplatte der Küche hoch und schrie immer wieder nach ihr. Vor Schmerz traten mir heiße Tränen in die Augen, die mir über die Wangen strömten.
Schließlich ging im Flur das Licht an. Ich hörte ihre Schritte auf der Treppe, und wenige Augenblicke später erschien sie finster dreinblickend in der Küchentür, die Hände in die Hüften gestemmt.
»Weshalb heulst du so?«
»Ich bin gefallen«, rief ich. »Ich bin gefallen und habe mir, glaube ich, den Knöchel gebrochen!«
Sie schaute rasch hinunter auf meinen Fuß.
»Blödsinn«, herrschte sie mich an.
»Nein, das ist kein Blödsinn. Ich hörte es knacken. Warum hast du die Leiter weggenommen?«, brüllte ich sie an. »Wie konntest du so etwas tun? Mein Fuß fühlt sich an, als würde er aufgeblasen wie ein Ballon.«
Sie schüttelte den Kopf und ging zum Kühlschrank.
»Du brauchst nur etwas Eis darauf«, meinte sie, ohne auch nur einen Blick auf den Fuß zu werfen.
Sie holte einige Eiswürfel heraus und schaufelte sie in einen Plastikbeutel.
»Hier«, sagte sie und warf ihn mir zu. »Leg das darauf und geh schlafen. Das kommt davon, wenn man ungehorsam ist. Vielleicht hörst du ja jetzt und hältst dich von diesen bösen Mädchen fern, die dich vergiftet haben.«
Sie drehte sich um und wollte weggehen.
»Er ist nicht nur geschwollen, sage ich dir. Er ist gebrochen. Ich hörte es knacken.«
Sie drehte sich nicht wieder um.
»Mal sehen, wie es morgen früh aussieht«, vertröstete sie mich. »Wenn du nicht nach oben gehen kannst, schlaf auf dem Sofa im Wohnzimmer.«
Ich hörte ihre Schritte auf der Treppe, dann war alles still, abgesehen von dem Klingeln in meinen Ohren und den Schreien, die mir in der Kehle stecken blieben. Hopsend und humpelnd machte ich mich auf den Weg ins Wohnzimmer, wo ich mich aufs Sofa fallen ließ. Ich zog meine Schuhe aus und legte das Eis auf meinen Knöchel, aber der Schmerz wurde dadurch nicht erleichtert. Die ganze Nacht stöhnte und weinte ich, bis ich gegen Morgen einschlief. Als ich die Augen öffnete, stand sie vor mir und starrte auf meinen Knöchel. Er war dunkelrot und angeschwollen.
»Vielleicht ist er tatsächlich gebrochen«, entschied sie. »Setz dich hin, ich helfe dir dann ins Auto. Wir müssen wohl in die Notaufnahme des Krankenhauses. Das ist ja eine ganz tolle Sache, um einen neuen Tag zu beginnen«, murmelte sie, »und das alles nur, weil du dich mit kranken Menschen abgibst.«
Ich hatte zu starke Schmerzen und war zu müde, um mit ihr zu streiten. Ich stützte mich auf sie, als wir uns zum Auto schleppten. Sobald ich drinnen saß, schloss ich die Augen und lehnte mich gegen die Tür. Auf dem ganzen Weg zum Krankenhaus murmelte sie eine Litanei von Klagen vor sich hin. Als wir ankamen, ging sie zuerst hinein; ein Krankenpfleger kam dann mit einem Rollstuhl für mich. Es dauerte fast eine Stunde, bis jemand nach mir schaute, dann wurde ich zum Röntgen geschickt, und es vergingen weitere zwei Stunden, bis ein Arzt kam, um mich zu untersuchen. Die ganze Zeit über saß Geraldine mit mir im Wartezimmer und schüttelte den Kopf über die Zeitschriften, die auf den Tischen ausgelegt waren.
»Wenn nun ein Kind hier hereinkommt? Es könnte eine von diesen Zeitschriften lesen oder anschauen. Schau dir nur das Bild dieser Schauspielerin im Nachthemd an. Genauso gut könnte sie nackt sein. Man kann völlig hindurchschauen und sehen, was sie zum Frühstück gegessen hat.«
Ich hatte immer noch zu große Schmerzen, um ihr richtig zuzuhören oder etwas zu erwidern, aber ich sah, wie die anderen Patienten sie anstarrten, als sie hörten, was sie sagte. Daraufhin tuschelten alle miteinander.
Schließlich ließ die Krankenschwester mich ins Behandlungszimmer zurückkommen, wo der Arzt meine Röntgenaufnahmen auf einem Leuchtschirm hängen hatte.
»Es ist ein Bruch«, stellte er fest. »Hast du versucht, mit diesem Fuß zu gehen, nachdem du dich verletzt hattest?« »Ja«, sagte ich.
»Hmm. Die Drehbewegung ist instabil«, sagte er, während er meinen Fuß untersuchte. »Du brauchst einen Oberschenkelgipsverband und musst regelmäßig geröntgt werden, um zu verhindern, dass eine katastrophale Fragmentverschiebung zu spät entdeckt wird.«
Geraldine stöhnte, als passierte das alles ihr und nicht mir. »Ärzte und Medizin«, murmelte sie.
»Wie bitte?«, fragte der Arzt.
»Schon gut«, murmelte sie und wandte sich mir zu. »Das kommt davon, wenn du irgendwo hingehst, wo du nichts verloren hast.«
»Oh. Wie ist das denn passiert?«, erkundigte er sich.
»Ich stürzte, als ich versuchte, vom Speicher herunterzukommen«, log ich.
Er nickte.
»Es kommt alles wieder in Ordnung«, tröstete er mich und rief die Schwester, um meinen Gips vorzubereiten. Nach weiteren drei Stunden waren wir auf dem Nachhauseweg. Ich hatte jetzt einen Gips und Krücken. Sie hatten mir auch etwas gegen die Schmerzen gegeben. Ich spürte, wie ich immer wieder eindöste.
Entweder hatte Geraldine aufgehört, sich über Dr. Marlowe, die Mädchen und mich zu beklagen, oder ich hörte es einfach nicht mehr. Die Medizin tat ihre Wirkung, schaltete Augen, Ohren, ja selbst meine Gedanken ab.
Als wir nach Hause kamen, musste sie mir aus dem Auto helfen. Die Treppe hinauf in mein Zimmer zu gehen war eine einzige Tortur, besonders weil ich mich so benommen fühlte. Sie hatte nicht genug Kraft, um mich zu stützen; ich schwankte und sie schrie auf. Irgendwie schafften wir es, und ich ging ins Bett. Fast im gleichen Augenblick, als mein Kopf das Kissen berührte, schlief ich ein. Als ich aufwachte, war schon fast die Abenddämmerung hereingebrochen. Mein Magen knurrte, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Ich stöhnte und versuchte mich aufzusetzen, da ich den Gips ganz vergessen hatte. Rasch wurde ich daran erinnert, dass dies kein Traum war. Wie üblich war die Tür zu meinem Zimmer geschlossen. Ich warf mein Bein mit dem Gips über die Bettkante und drehte mich um, während ich nach den Krücken griff. Als ich wieder Luft bekam, humpelte ich zur Tür und öffnete sie.
»Mutter!«, rief ich. Einen Augenblick später stand sie am Fuß der Treppe.
»Was ist?«
»Ich bin hungrig und durstig«, sagte ich.
»Fein. Jetzt darf ich auch noch das Dienstmädchen spielen. Geh ins Bett zurück. Ich bringe dir dein Abendessen nach oben«, sagte sie.
»Hat jemand für mich angerufen?«, rief ich hinter ihr her. »Nein«, rief sie.
Sie würde es mir nicht sagen. Warum machte ich mir überhaupt die Mühe, sie zu fragen?
Etwas später kam sie die Treppe herauf. Jeder Schritt klang schwerer als der vorherige. Sie wirkte außer Atem, ja bleich, als sie mit dem Tablett in mein Zimmer kam.
»Ich kann zum Essen nach unten kommen«, sagte ich. Sie nickte.
»Nächstes Mal wirst du das machen müssen. Ich bin wohl nicht mehr so jung, wie ich einmal war. Ärger kann einen binnen Minuten um Jahre altern lassen«, sagte sie und schaute mich mit einem scharfen kalten Blick an.
Sie stellte das Tablett auf meinem Schreibtisch ab. Ich humpelte hinüber und setzte mich. Auf dem Tablett standen zwei gekochte Eier, Marmelade und Toast, ein Glas Pflaumensaft und etwas Götterspeise. Normalerweise kochte sie Hühnchen oder Fisch.
»Das sieht aus wie Krankenhausessen«, stellte ich fest.
»Du beklagst dich? Du solltest froh sein, überhaupt etwas zu bekommen. All das ist dein Fehler. Vergiss das nicht«, sagte sie und drohte mir mit ihrem langen dünnen Finger. »Wieso ist das denn mein Fehler, Mutter? Du hast doch die Leiter weggenommen. Das war grausam und dumm.«
Sie straffte ihre Schultern.
»Wage es ja nicht, mich grausam und dumm zu nennen!«, schrie sie, machte eine Pause, presste die Lippen aufeinander und kniff ihre Augen hasserfüllt zusammen. »Nach dem, was du getan hast, verdientest du es, bestraft zu werden.«
»Was habe ich denn so Schreckliches getan?«, rief ich, die Arme fragend erhoben.
»Dort herumzuschnüffeln, als ich dir den Rücken gekehrt hatte«, erwiderte sie.
»Warum hast du mir denn nie diese Briefe gegeben? Und warum sind all diese Dinge dort oben in Kartons versteckt? Diese Sachen waren doch alle für mich, oder? Du hast mir nie etwas davon gegeben, nicht wahr?«
»Nein, und ich hatte Recht, das nicht zu tun. Das sah ihr ähnlich, ihre Fehler wieder gutzumachen, indem sie dir Sachen kaufte«, fauchte sie. Mit einem kalten Lächeln fuhr sie fort: »Sie hoffte, deine Liebe zu erkaufen, versuchte dich zu bewegen, dass du sie mehr mochtest als mich. Es hat ihr stets Sorge bereitet, du könntest sie nicht so gern haben wie mich. Ich wusste, das war eine ständige Angst, die an ihr nagte. Geschieht ihr recht«, sagte sie mit einem befriedigten Lächeln.
»Du hasstest deine eigene Mutter?«
»Nein. Ich hasste sie nicht. Ich bemitleidete sie wegen ihrer Schwächen«, sagte sie. Schlagartig erlosch das Lächeln auf ihrem Gesicht.
»Warum hast du mir nie erzählt, dass ich ein Treuhandvermögen besitze?«, hakte ich weiter nach, während ich aß.
»Warum? Du darfst es ein weiteres Jahr nicht anrühren«, erwiderte sie.
»Dennoch hättest du es mir sagen sollen«, beharrte ich. »Wie viel ist es denn?«
»Oh, jetzt machst du dir also Sorgen, wie viel Geld du hast?«
»Nein, aber ich möchte es gerne wissen. Ist das etwa falsch?«, fragte ich. Eisern hielt ich die Tränen zurück, die mir heiß unter den Lidern brannten.
»Wenn die Zeit kommt, wirst du es erfahren«, kündigte sie an. »In der Zwischenzeit kümmere ich mich um deine Finanzen.«
»Kannst du mir nicht mehr darüber erzählen, was passiert ist?«, bat ich. Ich erinnerte mich daran, was Jade mir aufgetragen hatte auszuforschen. »Wo wurde ich zum Beispiel geboren? War es hier in Los Angeles, oder ging sie irgendwo anders hin, um mich zu bekommen?«
Sie presste die Lippen fest aufeinander, als wollte sie ihre Zunge davon abhalten, eine Antwort zu geben.
»Es war ein widerliches Chaos. Es hat keinen Zweck, die schmutzige Vergangenheit wieder aufzuwühlen und dies Monate, Wochen und Tage noch einmal erleben zu müssen. Außerdem, was ändert das denn schon? Du bist jetzt, wer du bist, du bist jetzt hier, und damit hat sich der Fall.« Sie holte tief Luft, als ob ihre Lunge ihr von alleine nicht genug Luft geben würde. Dann nickte sie zu meinem Tablett hin. »Ich komme später das Geschirr holen.«
»Es ist meine Vergangenheit«, drängte ich sie. »Ich habe ein Recht, es zu wissen.«
Sie blieb stehen, drehte sich auf dem Absatz um und starrte mich an.
»Recht? Du hast ein Recht? Wer gibt dir Rechte? Ich gebe dir deine Rechte. Wer musste wegen all dem am meisten leiden? Ich bin diejenige, die am meisten leiden musste, nicht du. Für dich wurde doch gut gesorgt, oder? Kein Waisenhaus für dich, obwohl du außerehelich geboren wurdest. Keine fremde Pflegefamilie. Du hattest von Anfang an ein Zuhause mit einer Familie, oder?«
»Familie«, murmelte ich bitter. »Eine schöne Familie.«
»Ich lasse mir nicht die Schuld an dem geben, was er getan hat. Du hättest früher zu mir kommen können.«
»Aber natürlich«, höhnte ich. »Du hast doch nie zugehört bei allem, das auch nur das Geringste damit zu tun hatte. Du hast mir ja nicht einmal geholfen, als ich zum ersten Mal meine Periode hatte. Er war der Einzige, der jemals so getan hatte, als machte er sich etwas aus mir. Deshalb ist das alles ja passiert.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Du warst noch nie so respektlos. Bestimmt sind das diese Mädchen. Sie sind wie eine Krankheit. Wehe, wenn du auch nur noch einmal mit ihnen redest, hörst du?«
»Sie sind meine Freundinnen«, beharrte ich.
»Wir werden sehen«, sagte sie. Sie wollte hinausgehen, blieb aber noch einmal stehen, um zu mir zurückzuschauen. »Wir werden sehen.«
Sie schloss die Tür. Mir hatte sich der Hals zugeschnürt, ich würgte an einem Stück Toast herum. Ich trank einen Schluck Saft und stieß die Teller beiseite. Ich werde nichts essen, dachte ich. Das werde ich tun. Ich werde fasten, bis sie mich mit den Mädchen sprechen lässt.
Eine Stunde später kam sie herein und sah, dass ich mein Abendessen kaum angerührt hatte.
»Was soll denn diese Verschwendung von Lebensmitteln?«, wollte sie wissen. »Du müsstest doch hungrig sein. Du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen.«
»Und ich werde auch nichts essen«, sagte ich, »keinen einzigen Bissen, bis du mich mit Misty oder Jade oder Star reden lässt, wenn eine von ihnen anruft.«
Sie starrte mich einen Moment mit einem fast amüsierten Ausdruck in den Augen an.
»Tatsächlich?« Sie nahm das Tablett und ging zur Tür. Dort drehte sie sich um. »Du bist genau wie sie«, stellte sie fest, »egoistisch und halsstarrig. Sie hat bekommen, was sie verdiente, und du wirst auch bekommen, was du verdienst. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe dir die richtigen Sachen beigebracht. Wenn du nicht hören willst, hörst du eben nicht.
Ich werde dir nichts mehr zu essen hochbringen. Wenn du etwas essen möchtest, geh nach unten und hol es dir. Wenn nicht …«, sie zuckte die Achseln, »dann nicht.«
Sie schloss die Tür wieder, und es war still bis auf ihre schweren Schritte, als sie die Treppe hinunterstieg.
Ich umarmte mein Kissen. Die Schmerzen waren wiedergekommen. Sie hämmerten in meinem Bein und trugen so zu meinem riesengroßen Elend bei.
Ich hätte die Briefe aus dem Speicherraum mit nach unten bringen sollen. Jetzt würde es einige Zeit dauern, bis ich wieder dort hinaufkam und endlich den Unterschied zwischen all den Lügen und der Wahrheit kennen lernte. Falls Geraldine sie nicht vorher vernichtete.
Ich lehnte mich zurück und rief mir den ersten Brief in Erinnerung zurück. Ich hatte das ganze Dokument in meinem Gedächtnis gespeichert. Jetzt ließ ich es wieder ablaufen. Sie hörte sich so bedauernd, so reuevoll an, so erpicht darauf, dass ich sie liebte. Warum hatte sie mich nicht selbst großziehen können? Die Welt wäre völlig anders für mich gewesen. Ich hätte nicht diesen Vater gehabt, der mir solche Dinge antat. Ich hätte Geraldine nicht gehabt, die mich mit ihrer Wut und ihrem Hass quälte. Die Schatten würden verschwinden.
Was hatte ich getan, um so etwas zu verdienen, außer geboren zu werden? Wenn man mir jetzt Gelegenheit gegeben hätte, mich zu entscheiden, hätte ich gesagt, nein danke. Lasst mich, wo ich bin. Behaltet eure Welt, eure Erde, eure Luft, Wasser, Bäume und Blumen. Lasst mich hier bleiben hinter einer Wolke und auf eine andere Gelegenheit warten, die Chance, jemandes Tochter zu sein und nicht jemandes Fehltritt.
Mein erster Schrei würde Lächeln hervorzaubern statt Tränen und Sorgen.
Vor allem hätte ich von Anfang an gewusst, wer ich war, statt den größten Teil meines Lebens damit zu verbringen, Hinweise zu verfolgen, durch die Dunkelheit, hinter verschlossenen Türen, bis in die Gruft, in der mein Name hinter Schloss und Riegel gehalten wurde.