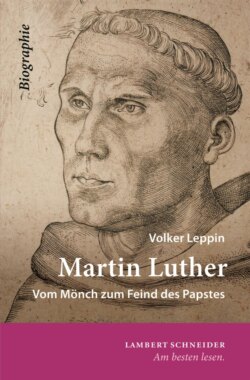Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. KAPITEL Der junge Professor
ОглавлениеAls Luder nach Wittenberg kam, bestand die dortige Universität erst wenige Jahre, seit 1502. Die Theologieprofessur von Staupitz dürfte er gern angenommen haben. Dass er gelegentlich berichtet, er sei mit ihrer Übernahme dem Drängen seines Vorgängers und geistlichen Begleiters gefolgt,1 lässt sich wohl als ein Bescheidenheitstopos erklären, zu dessen Entstehung noch beitrug, dass Luder nach Ausflüchten gegenüber der Erfurter Fakultät suchte, die ihm vorwarf, mit der Promotion an einem anderen Ort einen ihnen gegenüber abgelegten Eid verletzt zu haben.2 Wie vorsichtig man damit sein muss, dergleichen für bare Münze zu nehmen, zeigt der Umstand, dass Luther ganz ähnliche Gespräche mit Staupitz auch über seine Furcht vor dem Predigtamt berichtete.3 Seine Promotion erfolgte dann, finanziert durch den Kurfürsten,4 den hoch angesehen Friedrich den Weisen, am 18./19. Oktober 1512 unter dem Vorsitz Andreas Karlstadts – dieser Vorsitz war eine sehr formale Aufgabe, die wenig mit dem modernen »Doktorvater« zu tun hat.
Wohl 1513 begann Luder mit seinen Vorlesungen, in denen er sich ganz auf die Aufgabe der Auslegung der biblischen Bücher konzentrierte: In der ersten, ab 1513,5 behandelte er die Psalmen, dann folgte ab Frühjahr 1515 der Römerbrief, vom 27. Oktober 15166 bis zum 13. März 15177 der Galaterbrief, danach der Hebräerbrief und ab Anfang 1519 noch einmal die Psalmen. Irgendwann in dieser Zeit hat er nach seiner eigenen Erinnerung auch eine Vorlesung über den Titusbrief gehalten,8 die aber nicht erhalten ist; umgekehrt gibt es eine Mitschrift einer Vorlesung über das Richterbuch,9 die in etwa in diese Zeit zu fallen scheint, obwohl Luther sie später nicht erwähnt. Von diesem eher historischen Buch abgesehen, konzentrierte sich Luders Arbeit also einerseits auf diejenigen Texte des Alten Testamentes, die im monastischen Leben in fortwährendem liturgischen Gebrauch waren, und andererseits auf die theologisch wichtigsten Texte des Apostels Paulus. Die gute Überlieferungslage für die frühen Vorlesungen mit eigenen Aufzeichnungen Luders wie auch studentischen Mitschriften hat die Forschung immer wieder dazu gebracht, in diesen Texten nach Spuren jener reformatorischen Wende zu suchen, von der Luther in seinem späten Rückblick schreibt, in ihr sei ihm ein neues, befreiendes Verständnis der Gerechtigkeit Gottes aufgegangen. Man schwankte hier zwischen der insbesondere von Karl Holl und seinen Schülern vertretenen Frühdatierung, die die Anfänge der reformatorischen Theologie schon in der ersten Vorlesung zu den Psalmen beziehungsweise in der über den Römerbrief wiederfinden wollte, und einer im Gefolge von Ernst Bizer vertretenen Spätdatierung in die Zeit ab etwa 1518, wonach die frühen Arbeiten noch weitgehend von einer monastischen humilitas-(Demuts-)Theologie geprägt waren. Methodisch bringt der eine wie der andere Ansatz eine Fülle von Schwierigkeiten mit sich: Zum einen hängt die Definition »des« Reformatorischen ihrerseits wiederum von bestimmten Vorannahmen ab, die sich nicht klar aus den Quellen selbst ergeben. Zum anderen aber kann die teleologische Suche nach »dem« Reformatorischen dazu verführen, allzu rasch Aussagen von späteren Entwicklungen her zu deuten statt aus ihrem ursprünglichen Kontext, in dem sie für die Zeitgenossen und auch den Autor Luder selbst vielleicht noch gar nicht so neu klangen – zumal in vielen Fällen schon allein eine einfache Wiedergabe des Paulustextes selbst Formulierungen enthalten muss, die in Luthers späterer, an der Rechtfertigungslehre orientierten Theologie eine prononcierte Bedeutung besäßen, aber zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen besonderen Akzent besitzen mussten. Vor allem aber wird man sich fragen müssen, ob die Suche nach einer reformatorischen Wende, nach einem punktuellen psychologisch greifbaren Durchbruch in Luders Entwicklung überhaupt geeignet ist, dem tatsächlichen Geschehen nahezukommen, und nicht vielmehr einer Stilisierung folgt, die Luther selbst in der bewussten Formung seiner Erinnerungen vorgenommen hat (s.u.). Schon lange neigt man daher dazu, den Gedanken einer reformatorischen Wende in eine länger anhaltende Entwicklung einzuordnen. Vermutlich wird man ihn sogar ganz aufgeben müssen. Was man allerdings als markante Entwicklung beobachten kann, ist Luders Transformation der mittelalterlichen Hermeneutik. Deren Lehre vom vierfachen Schriftsinn spitzte Luder zu einer Doppelperspektive zu: Maßgeblich war für ihn einerseits der auch im Mittelalter als grundlegend betrachtete wörtliche Sinn, andererseits eine Dimension des Textes, die er in der Formel des pro nobis oder pro me zusammenfassen konnte: der Text als unmittelbare Ansprache an den Gläubigen. Diese Ebene des Schriftverständnisses formte den moralischen Sinn des Mittelalters um, vielfach unter Aufnahme der eschatologischen Perspektive, die im Mittelalter ebenfalls eine eigene Sinnebene ausgemacht hatte. Und auch der typologische Sinn des Mittelalters, der insbesondere im alttestamentlichen Text bereits die Heilstatsachen des Christentums sah, wirkte bei Luther im historischen Schriftsinn fort, insofern für ihn selbstverständlich unter die historische Auslegung auch die Deutung der Psalmen auf Jesus Christus fiel. Dass Luder seine Bibelauslegung ganz auf die Bedeutung für den Glaubenden ausrichtete, war nichts völlig Neues – dergleichen konnte man in den Predigten des späten Mittelalters, zumal im Kontext der deutschsprachigen Dominikanermystik des frühen 14. Jahrhunderts erfahren, wie sie Luder aus einem Druck der Predigten Johannes Taulers bekannt war. Neu aber war die Verbindung aus dem akademischen Anliegen wissenschaftlicher Schriftauslegung und der predigthaften Ansprache an den glaubenden Menschen. Schon die Schriftauslegung im Hörsaal sollte dem Zweck der Erbauung dienen. Luder verschränkte also unterschiedliche Aussagemodi, die im Mittelalter der Sache nach streng voneinander unterschieden waren. Für ihn war der Schriftausleger immer zugleich Wissenschaftler und Prediger. Diese hermeneutische Konzeption entsprach ganz und gar seiner Lebensrealität, denn der Professor Luder war auch Prediger. Diese Aufgabe hatte er, möglicherweise sogar schon in Erfurt,10 im Mönchkonvent versehen.11 In Wittenberg übernahm Luder spätestens 1514 die vom Rat gestiftete Prädikantenstelle an der Wittenberger Stadtkirche.
Lutherhaus (bis 1996 »Lutherhalle« genannt). Es diente den Augustinermönchen im Ordensstudium als Bildungsort, aber auch als Wohn- und Schlafstätte.
Zur spirituell prägenden Figur wurde ihm in dieser Zeit immer mehr Johann von Staupitz. Er wurde ein Helfer in eben jenen Nöten der Anfechtung, die zwar wohl nicht das ganze monastische Leben Luders bestimmten, aber gleichwohl eine wichtige Rolle für seine geistliche Entwicklung spielten. Zunehmend empfand Luder eine Diskrepanz zu den Normen seines selbst gewählten Lebens als Mönch, das Bewusstsein, dessen Normen und darin letztlich Gott nicht Genüge tun zu können. Die verheißene via securior gewährte ihm offenkundig gerade keine Sicherheit und Gewissheit – ehe sich ihm durch Staupitz eine Deutung erschloss, die eine grundlegende Bejahung dieses Lebensweges ermöglichte. Trotz einiger Hinweise, dass auch Staupitz Luders Anfechtungserfahrungen hilflos gegenüberstand,12 überwiegen die positiven Erinnerungen, die Staupitz als tröstenden und aufbauenden Beichtvater erkennen lassen. Aus den Gesprächen, die beide führten, ragen drei Themen hervor: das Erschrecken vor dem Sakrament, das Ringen um die eigene Begierde, die concupiscentia, und die Prädestinationsfurcht. In allen drei Feldern wird die Lösung, die Staupitz immer und immer wieder vortrug, sehr deutlich erkennbar: die Hinwendung zu Christus. Besonders tief haftet in Luthers Gedächtnis sein Erschauern über die Gegenwart Christi in einer Fronleichnamsprozession in seiner Geburtsstadt Eisleben im Jahre 1516.13 Angesichts dieses frommen Erschauerns gab Staupitz ihm den Hinweis: »Es ist nicht Christus, was dich erschreckt hat, weil Christus nicht erschreckt, sondern tröstet.«14 Schon hier blitzt auf, was die Beichtratschläge von Staupitz an Luder durchziehen wird: die Korrektur eines wohl aus dem Elternhaus mitgebrachten Christusbildes, das Schrecken in Christus hineinprojiziert, durch ein tröstendes, beruhigendes Christusbild.
Zu dieser Zeit war Staupitz schon sein vertrautester Gesprächspartner. Trotz der bald einsetzenden häufigen Abwesenheit von Wittenberg besaß der Ordensgeneral offenbar einen gewaltigen Einfluss auf den jungen Mitbruder, der sich in diesen Situationen auch brieflich mit seinen Nöten an ihn wandte15 – ein menschlich und theologisch hochinteressantes Miteinander bahnte sich an: auf der einen Seite Staupitz, der einen jungen Mann protegierte, auf der anderen Seite der in den ersten Jahren seines vierten Lebensjahrzehntes stehende Mönch, der Karriere machte, schwerlich ganz von Ehrgeiz frei war, aber offenbar auch von Selbstzweifeln belastet, in denen er sich in besonderer Weise an den Förderer wandte. Dieser war zugleich Ordensleiter und Beichtvater und damit in der intimsten spirituellen Position gegenüber Luder, die im späten Mittelalter überhaupt denkbar ist. So hat Luder ihm seine Sorgen wegen des monastischen Lebens ausführlich dargelegt. Offenkundig machte ihm zu schaffen, dass er die concupiscentia, nach Augustin der eigentliche Ausdruck der Erbsünde im Menschen, in sich spürte – nach allem, was er berichtet, nicht sosehr in Gestalt sexueller Begierde,16 sondern als Ichbezogenheit, die es ihm unmöglich machte, den Brüdern nur mit jenem Wohlwollen zu begegnen, das er von sich erwartete.17 In dieser Situation hat Staupitz ihn immer wieder mit dem Hinweis auf Christus als den, der die Sünden vergibt, zu trösten versucht.18 So gestaltete sich, was später als Solus Christus zu einer reformatorischen Zentralformel wurde: Wohl schon 1514 betont Luder, er predige immer Christus.19 Mit dem Verweis auf den Heiland wollte Staupitz ihn auch in seiner Angst wegen der Prädestination, jenes unerforschlichen Willens Gottes, nach dem dieser einige zum Heil bestimmt hatte, andere aber dem Unheil überließ, trösten. Er warnte Luder vor aller müden Spekulation und verwies ihn auf den Glauben an Jesus Christus:
»Ich führte einmal bei meinem Staupitz Klage über die Erhabenheit der Prädestination. Er antwortet mir: In den Wunden Christi versteht und findet man die Prädestination, nirgendwo anders, denn es ist geschrieben: ›Diesen hört!‹ Der Vater ist zu hoch, aber der Vater hat gesagt: Ich werde euch einen Weg geben, um zu mir zu gelangen, freilich Christus. Geht, glaubt, hängt euch an Christus, so wird es sich wohl finden, wer ich bin, zu seiner Zeit. Das tun wir nicht, daher ist Gott für uns unbegreiflich, undenkbar; er wird nicht begriffen, außerhalb Christi will er nicht erfasst sein.«20
Mit Staupitz, aber auch mit anderen geistlichen Beratern, setzte damit eine Wandlung in Luders Christusbild ein, die allzu oft vereinfachend als Weg von »dem« spätmittelalterlichen zum reformatorischen Bild von Christus gezeichnet wird. Tatsächlich handelte es sich um zwei Alternativen innerhalb des breiten mittelalterlichen Spektrums: Das liebevolle Christusbild, auf das Staupitz Luders Blick lenkte, löste diesen offenbar von den viel härteren, bedrohlicheren Vorstellungen seines Elternhauses. In diesem Sinne gilt tatsächlich, was Luther Jahre später zuspitzend sagte: »Staupicius hat die doctrinam angefangen.«21 Noch kurz vor seinem Tod bilanzierte der Reformator, Staupitz sei sein »Vater ynn dieser lere« gewesen und habe Luther »ynn Christo geborn:«22 ein höchst aufschlussreiches Bild, das einerseits mit der gängigen mittelalterlichen Vorstellung vom »Beichtvater« oder »geistlichen Vater« spielt, andererseits aber doch auch noch einmal jenen, im Konflikt mit Hans Luder vollzogenen Weg ins Kloster in gebrochener Form neu deutet. Sowenig die Alternative zum zurückgelassenen leiblichen Vater ausdrücklich benannt ist, so sehr schwingt sie doch in dieser Äußerung mit.
Staupitz war in Luders ersten Wittenberger Jahren nicht nur direkter Lehrer, sondern führte ihn auch zum Umgang mit anderen Glaubensquellen aus Schrift und Tradition, vor allem zur Bibel, deren Lektüre im Orden Staupitz propagierte und förderte, und eben zu dem oben schon erwähnten Johannes Tauler. Nirgendwo im deutschen Sprachraum wurde Anfang des 16. Jahrhunderts dieser Mystiker in so großer zeitlicher Dichte gelesen und diskutiert wie in Wittenberg und Erfurt. Neben Luder selbst war insbesondere Andreas Karlstadt hieran beteiligt, daneben auch Johannes Lang und Justus Jonas. Es spricht viel dafür, dass Spiritus rector dieser Taulerbegeisterung Johannes Staupitz war. Die wesentlichste Erkenntnis, die Luder hieraus gewann, war die, dass Buße eine das ganze Leben eines Christen bestimmende Haltung sein sollte – also genau die Überzeugung, die ihn später in den Konflikt um den Ablass bringen sollte (s.u.). So konnte er noch fast ein halbes Jahr nach der Versendung seiner Thesen gegen den Ablass, am 31. März 1518, an Staupitz schreiben: »Freilich bin ich der Theologie Taulers und jenes Büchleins gefolgt, das du neulich unserem Christian Goldschmied in den Druck gegeben hast.«23 Dieser Satz verweist auf beides: die Bedeutung von Staupitz und die tief greifende Prägekraft der spätmittelalterlichen Mystik, vor allem aber auf Luders noch nach Beginn des Konfliktes ungebrochenes Bewusstsein, in Kontinuität mit der spätmittelalterlichen Frömmigkeit zu stehen. Hierzu passt, dass die erste Veröffentlichung des Mönchs und Professors eben jenes Büchlein war, das er in seinem Schreiben erwähnt: die Theologia Deutsch, ein spätmittelalterlicher Traktat, den er für eine Art Zusammenfassung von Taulers Lehre hielt.24 Luders Neuanstoß war in seinen Wurzeln nicht eine Wendung gegen das Mittelalter, sondern er entsprang aus der spätmittelalterlichen Frömmigkeit und Mystik. Unterstützt wurde sein Neuerungsbewusstsein freilich durch die humanistische Bewegung. So verdankte Luder eine Vertiefung des neuen Bußverständnisses der Kenntnis des Novum Instrumentum, einer Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes, die Erasmus von Rotterdam 1516 vorlegte. Luder nutzte es sofort für seine Studien und vertiefte mit seiner Hilfe und einem genaueren Verständnis der griechischen Begrifflichkeit die an Tauler gewonnene Einsicht, dass Buße nicht ein einzelner sakramentaler Vorgang war, sondern eine grundlegende Sinneswandlung des Menschen.
Humanistischer Herangehensweise entsprach es auch, dass Luder sich – im Sinne der Forderung ad fontes – den grundlegenden Quellen zuwandte, der Bibel selbst wie den Kirchenvätern. Unter diesen lag einem Augustinereremiten nichts näher als eben Augustin selbst, der das ganze Mittelalter hindurch die maßgebliche theologische Autorität gewesen war; nur selten waren aber bei seiner Rezeption die antipelagianischen Schriften in den Vordergrund getreten, die so nach Augustins Gegner Pelagius genannt werden, welcher nach der Kritik des Kirchenvaters ein zu starkes Gewicht auf die moralischen Möglichkeiten des Menschen gelegt hatte. In Auseinandersetzung mit ihm, vor allem aber in Anknüpfung an Paulus entwickelte Augustin eine Theologie, die gegenüber allen menschlichen Möglichkeiten, das Heil zu erwirken, dessen vollständige Angewiesenheit auf die Gnade Gottes ins Zentrum rückte. Schon im späten Mittelalter waren diese Konzepte immer wieder im mystischen Kontext aufgegriffen worden. So geschah es nun auch bei Martin Luder. Angeleitet durch Augustin verstand er auch die paulinischen Schriften schärfer zu lesen. Bibel und Kirchenvater gingen ihm dabei Hand in Hand, ein Gegenüber von Schrift und Tradition, wie es später leitend wurde, war für Luder noch keineswegs gegeben. Das macht ein Schreiben deutlich, das er am 18. Mai 1517 – kein halbes Jahr vor der Versendung der Thesen gegen den Ablass – wiederum an seinen Ordensbruder Johannes Lang sandte:
»Unter Gottes Beistand machen unsere Theologie und Sankt Augustin gute Fortschritte und herrschen an unserer Universität. Aristoteles steigt nach und nach herab und neigt sich zum nahe gerückten ewigen Untergang. Auf erstaunliche Weise werden die Vorlesungen über die Sentenzen verschmäht, so dass niemand auf Hörer hoffen kann, der nicht über diese Theologie, d.h. über die Bibel, über Sankt Augustin oder über einen anderen Lehrer von kirchlicher Autorität lesen will. Gehab dich wohl und bete für mich.«25
Augustin gegen Aristoteles, so könnte man die hier aufgemachte Alternative plakativ zusammenfassen, und dies traf wiederum mit dem humanistischen Neuerungsansatz zusammen, zu dessen gängigen Feindbildern in der Tat die Dominanz der aristotelischen Philosophie an der Universität gehörte. Erstaunlich ist, in welchem Maße Luder selbst nun den Kirchenvater in seine Gegenwart hineinholt: »Unsere Theologie und Sankt Augustin« – als ginge beides in eins. Dabei ist »unsere Theologie« allerdings nicht als Majestätsplural zu verstehen, sondern bezieht sich darauf, dass Luder in seinen Reformbemühungen schon längst Mitstreiter gefunden hatte. Einer von ihnen war der Adressat des Briefes selbst, Johannes Lang, der von 1512 bis 1516 in Wittenberg Moralphilosophie gelehrt hatte. Ein anderer war Nikolaus von Amsdorff, und schließlich sogar der einstige Promotor Luders: Andreas Bodenstein von Karlstadt, der anfänglich Luders Augustindeutung überhaupt nicht zu folgen bereit war, sich dann aber durch eigene Einsicht in die Quellen eines Besseren belehren ließ. Luder war Teil einer ganzen Gruppe von Neuerern, die augustinisch-antischolastische Ideale verfolgten.
Ein »erster öffentlicher Vorstoß für Luthers Theologie«26 war ein halbes Jahr vor jenem Schreiben an Lang erfolgt: Am 19. oder 26. September 1516 disputierte Bartholomäus Bernhardi aus Feldkirch, dem aus dem Mittelalter herkommenden Brauch entsprechend, aus Anlass seiner Promotion zum Sententiar unter Luders Vorsitz über Thesen, die er aufgrund von dessen Vorlesungen weitgehend selbst zusammengestellt hatte.27 Auch wenn es sich also nicht um Originaläußerungen Luders handelt, sind die Thesen Zeugnis der von diesem angestoßenen akademischen Reformbewegung.
Schon die Fragestellung der Thesenreihe ist bemerkenswert: »Kann der Mensch … aus seinen natürlichen Kräften die Gebote Gottes, seines Schöpfers halten oder irgend etwas Gutes tun oder denken und mit der Gnade verdienen und das als Verdienst erkennen?«28 Hier verbanden sich treffend die von Staupitz kommenden Anstöße mit augustinischen Reflexionen. Mit eben demselben Recht, mit dem man im Blick auf diese Jahre in Wittenberg gelegentlich von »Augustinismus« spricht, könnte man auch von »Staupitzianismus« sprechen.
Die Disputation ist komplex aufgebaut, enthält drei Grundthesen mit Erläuterungen und einige Zusätze. Ihr Kern aber enthüllt sich aus den beiden Anfangsthesen:
»Der Mensch, der Seele nach Gottes Ebenbild und so zur Gnade fähig, unterwirft, allein auf seine natürlichen Kräfte gestellt, eine jede Kreatur, deren er sich bedient, der Eitelkeit. Er sucht nur das Seine und was des Fleisches ist.«29
So lautet die erste, und die zweite:
»Der Mensch kann unter Ausschluss der Gnade Gottes seine Gebote keineswegs halten noch sich, sei es gebührend oder angemessen, zur Gnade bereiten, sondern er bleibt notwendigerweise unter der Sünde.«30
Beide Thesen entfalten in knappster Form das Grundgerüst einer theologischen Anthropologie: Die natürlichen Kräfte des Menschen führen ihn unausweichlich in die Irre und das Verderben, er kann nichts Gutes tun, sich nicht einmal auf die Gnade Gottes vorbereiten. Diese allein, so ist der Umkehrschluss, bringt dem Menschen das Heil, denn, wie Bernhardi in Erläuterung der zweiten These sagt: »Der Mensch ohne die Gnade bleibt also notwendigerweise ein Kind des Zorns.«31 In diesen Thesen und ihren Ausführungen spiegelt sich wider, wie sich ganz allmählich der von Staupitz erlernte Grundsatz des Solus Christus zu einem Sola Gratia erweiterte: Allein die Gnade Gottes ermöglicht dem Menschen Heil. Wie eng Luder damit bei seinem geistlichen Begleiter bleibt, zeigt dessen wenig später im Druck erschienener Libellus de exsecutione aeternae praedestinationis, in dem es heißt:
»Daher ist den Erwählten nicht allein die Berufung geschuldet, sondern auch die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung, sage ich, durch die die Übertretung in den wahren Gehorsam Gottes zurückgebracht wird. Das geschieht dann, wenn durch die Gnade Gottes seine Augen wieder geöffnet werden, auf dass er durch den Glauben den wahren Gott erkenne, sein Herz entflammt werde, auf dass Gott ihm wohl gefalle. Beides ist reine Gnade und fließt aus den – vorhergesehenen und aufgezeigten – Verdiensten Christi, während unsere Werke dazu nichts tun oder tun können. Denn die Natur für sich allein hat weder Erkennen noch Wollen noch Gutes tun; für sie ist Gott selbst schrecklich.«32
Noch also pflegte man in Wittenberg einen ausgeprägten »Staupitzianismus«. Luder befand sich bei seinen Bemühungen um theologische Klärung ganz innerhalb des spätmittelalterlichen Rahmens von Theologie und Frömmigkeit. Charakteristisch für ihn war das Ineinander von Staupitz, Mystik, Augustin und Paulus: Alle diese Einflüsse, die sich nach und nach in seiner Entwicklung verifizieren lassen und die begleitet werden von einer Auseinandersetzung mit der scholastischen Theologie in der Fassung, wie er sie kennengelernt hat, stehen nicht in Konkurrenz zueinander; sie sind auch letztlich nicht klar hierarchisiert, sondern sie bilden zusammen den Stoff, aus dem Luder seine eigenen Überzeugungen gewinnt und nun forciert kritisch gegen hergebrachte Auffassungen an die – zunächst universitätsinterne – Öffentlichkeit bringt. Bald aber wurde aus der allmählichen, sehr organischen und harmonischen Entwicklung ein Angriff auf das Hergebrachte: Am 4. September 1517 kam es neuerlich zur Disputation über eine Thesenreihe, die nun eindeutig auf Luder zurückzuführen ist. Disputant war Franz Günther aus Nordhausen. Dieses Ereignis wird tradiert als die Disputatio contra scholasticam theologiam, die Disputation gegen die scholastische Theologie.
Nicht ganz zwei Monate vor den Thesen zum Ablass sammelt Luder hier die Ergebnisse seines bisherigen Reformprogrammes. Dies brachte eine überaus scharfe Abrechnung mit dem, was Luder als Scholastik wahrgenommen hatte, und zwar vornehmlich unter zwei Gesichtspunkten, einem methodischen und einem materialen. Methodischer Kritikpunkt ist die Vermengung von Theologie und Aristoteles:
»44. Es ist ein Irrtum zu sagen, ohne Aristoteles werde man nicht Theologe. Gegen die allgemeine Meinung.
45. Vielmehr wird man nicht Theologe, es sei denn, man wird es ohne Aristoteles.«33
Die Stoßrichtung war klar: Die seit dem 13. Jahrhundert durch die artes-Fakultäten vermittelte zentrale Bedeutung des Aristoteles für akademisches Denken sollte ihre Grenzen an der Theologie haben. In dieser Zuspitzung wurden die Thesen zu einem Fanal, das der brieflichen Notiz an Lang, niemand höre mehr Aristoteles, einen theologischen Unterbau gab. Viel mehr Aufmerksamkeit als diese grundlegende methodische Frage des Umgangs mit Aristoteles in der Theologie haben aus theologischen Gründen die materialen Thesen der Disputation gegen die scholastische Theologie auf sich gezogen, in denen Luders Beschäftigung mit dem antipelagianischen Augustin zu voller Entfaltung kam. Nicht zufällig setzt gleich die erste These mit einem Hinweis auf Augustin und einer Kritik seiner Kritiker ein, insofern der Kirchenvater vor dem Vorwurf in Schutz genommen wird, in seinem Vorgehen gegen die Häretiker, gemeint sind Pelagius und seine Anhänger, allzu scharf gewesen zu sein. Wohin dann die Argumentation gehen soll, macht die vierte These deutlich:
»Wahrheit ist es also, dass der Mensch, ein ›fauler Baum‹ (Mt 7,18) geworden, nur das Böse wollen und tun kann.«34
Damit ist das Feld bestellt, auf dem die Auseinandersetzung in den folgenden Jahren stattfinden wird: die Anthropologie. Der Mensch unter der Erbsünde ist, so der in den verschiedensten Thesen variierte Tenor Luders, zum Guten nicht fähig. Und eben deswegen ist er, unfähig, sich selbst zu erlösen, auf die Gnade Gottes angewiesen. So herb die Aussagen über den Menschen erscheinen mögen: Grundlage dieser Überzeugung ist jene Erkenntnis, die Luder durch Staupitz gewonnen hatte, dass der Mensch nicht auf einen furchterregenden Christus schauen solle, sondern auf den, der sich ihm in Barmherzigkeit zuwendet und von dem der Glaubende alles erwarten soll. Die Thesen entfalteten ihre Wirkung auch durch die Form, die Luder ihnen, in Anlehnung an eine Thesenreihe des Ingolstädter Theologen Johannes Eck, gegeben hatte: Knappen Sätzen folgte immer wieder eine ausdrückliche Benennung derer, gegen die er sich damit wandte. Dies waren ganz überwiegend Vertreter der via moderna, im Speziellen immer wieder der Tübinger Begründer der Ockham-Renaissance Gabriel Biel. Daher hat Leif Grane seine Untersuchung dieser Thesenreihe 1962 unter die Überschrift Contra Gabrielem gestellt und damit deutlich gemacht, dass, auch wenn Luder wohl der Meinung war, die gesamte Scholastik zu treffen, der Fokus sachlich deutlich enger war. Der Wirkungskreis allerdings, den Luder erreichen wollte, war wiederum weiter gezogen als bei solchen akademischen Veranstaltungen üblich: Luder wollte nicht auf den universitären Kontext Wittenbergs beschränkt bleiben, sondern er sandte die Thesen an Johannes Lang in Erfurt und erklärte ausdrücklich seine Bereitschaft, sie dort, in der Fakultät oder im Kloster, zu disputieren,35 wenig später schickte er sie auch nach Nürnberg mit dem Hinweis, man könne sie eben jenem Johannes Eck zustellen36 – nicht ahnend, dass dieser bald zu seinem erbittertsten Gegner werden sollte.
Noch passte all dies gut in das Programm einer humanistischen Neuorientierung der Wittenberger Universität, die im folgenden Jahr energisch vorangetrieben wurde: 1518 wurde die Artistenfakultät um sieben Lehrstühle erweitert. Dabei wurden Stellen für hebräische und griechische Sprache geschaffen. Von nachhaltiger Bedeutung für Luther und die Reformation wurde die Besetzung der Letzteren mit dem eben einundzwanzigjährigen hochbegabten Philipp Melanchthon. Der begann seine Wittenberger Tätigkeit mit großem Ehrgeiz: Drei Tage nach seiner Ankunft, am 28. August 1518, hielt er seine Antrittsrede, in welcher er ein humanistisches Bildungsprogramm verkündete. Damit begann für Luther eine lebenslange, phasenweise spannungsreiche, insgesamt aber überaus fruchtbare Zusammenarbeit.
Philipp Melanchthon, Kupferstich von Albrecht Dürer (1526)