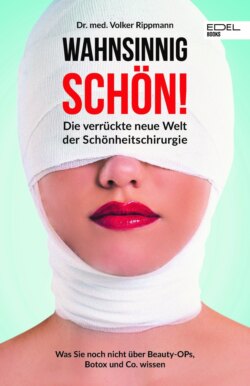Читать книгу Wahnsinnig schön! - Volker Rippmann - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1 Wie bekommen Sie mehr Likes? Wenn soziale Medien den Druck erhöhen
Оглавление»Ich muss die 10 k knacken, verstehen Sie?« Die neue Patientin rutschte nervös auf dem Stuhl hin und her, ein Büschel blonder Haarextensions, das sich gelöst hatte, fiel ihr dabei ins Gesicht und dann auf meinen Schreibtisch. Sie hob es schnell wieder auf und stopfte es in ihre Handtasche. Ich schaute sie fragend an. »Noch mal von vorne, bitte«, sagte ich. »Erzählen Sie Ihr Anliegen ganz in Ruhe.«
»Ach, am besten ich zeigs Ihnen.« Sie entsperrte ihr Smartphone, das sie die ganze Zeit in den Händen hielt, schon als ich ihr die Tür zum Beratungszimmer aufgehalten hatte. Um mir die Hand geben zu können, wechselte sie es von der rechten in die linke Hand. Es schien, als hielte sie nicht einfach das Telefon, sie hielt sich daran fest. Auf dem Foto, das ich nun auf dem hellen Bildschirm betrachten konnte, sah ich die gleiche junge Frau oder besser gesagt: Ich nahm an, dass es die gleiche Frau war wie die, die mir gegenübersaß, denn ganz genau konnte ich es nicht sagen, so verfremdet wirkte das Selfie. Auf dem Bild waren ihre Augen riesig, blaue Kulleraugen, umrandet von einem dichten Wimpernkranz. Ihre Nase war so klein, dass ich kurz hochschaute, um mich zu vergewissern, dass sie in Wirklichkeit anders aussah. Ihr ganzes Gesicht schien schmaler als in der Realität und ihre Haut hatte einen Glow, sie schimmerte und war zudem aalglatt. Von Poren oder Pickeln keine Spur. Ihre Stirn war im Verhältnis zur unteren Gesichtshälfte überproportional groß. Ein Gesicht nach dem Kindchenschema. Studien haben gezeigt, dass wir diese Proportionen als besonders niedlich bewerten. Wir finden Tierbabys süßer als ausgewachsene Tiere und Kleinkinder schützenswerter als Erwachsene. Man nimmt an, dass die Natur das so eingerichtet hat, um sicherzustellen, dass wir für unsere Nachkommen sorgen und sie verteidigen. Auch für Kunstfiguren werden diese speziellen Proportionen genutzt: Disney zeigt es uns von Bambi bis zu Elsa, der Eiskönigin. Wir sind also an das Kindchenschema in unserem Alltag gewöhnt. Und seien Sie mal ganz ehrlich: Was empfinden Sie, wenn Sie Videos von tapsigen Katzenbabys mit süßen Knopfaugen auf YouTube sehen? Auch wenn Sie die Clips vielleicht nicht an Freunde weiterleiten, Sie werden sicher für einen kurzen Moment gerührt sein. Ob Sie das wollen oder nicht.
Mir dämmerte inzwischen, wie die junge Frau, die noch nicht das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte, versuchen wollte, an ihre zehntausend Follower zu kommen. Aber ich wollte es von ihr hören und bat sie, mir ihren Wunsch genau zu erklären. »Also, das bin ich, auf Snapchat«, fing sie an und zeigte über den Schreibtisch hinweg auf ihr Smartphone, das ich jetzt in den Händen hielt. »Bei Insta bin ich ziemlich erfolgreich, ich bin Influencerin.« Dabei schaute sie mich prüfend an. »Oder zumindest auf dem Weg dahin«, setzte sie etwas leiser nach. »Wissen Sie, wie lange es dauert, die Bilder so zu bearbeiten? Wenn ich gleich so aussehen würde, würde ich mir das sparen können«, erklärte sie und forderte ihr Handy zurück. »Ich möchte, dass mein Gesicht aussieht wie mit diesem Filter. Geht das?«
Während Personen im Fernsehen und in Magazinen schon immer auch als Idole fungierten und Einfluss auf die Menschen, ihr Aussehen und ihr Selbstwertgefühl hatten, steht genau dieser Aspekt in den sozialen Medien scheinbar heute im Vordergrund. Es geht offenbar weit weniger um Inhalte als vorrangig darum, sich von den eigenen Vorbildern Trends abzuschauen. Was die sozialen von den traditionellen Medien wie Büchern und Fernsehen zudem unterscheidet, ist bekanntermaßen das partizipative Element: Wir können Erlebnisse, die uns berühren oder begeistern, ganz einfach sofort mit Freunden, der Familie und einer selbst gewählten sozialen Gruppe teilen, der Community. Insofern sind wir weit stärker involviert und vermeintlich Teil dieser anderen Sphäre. Aber gehören wir wirklich dazu? Gleichzeitig entsteht nämlich das Phänomen, dass wir dauernd dazu angehalten werden, uns zu vergleichen. Die meisten Nutzer neigen dazu, Fotos von sich zu teilen, auf denen sie sich attraktiv und schön finden. Auf Instagram sehen viele Nutzer so aus wie die junge Patientin auf ihrem Selfie: Sie haben ein schmales Gesicht, eine schlanke, aber betont weibliche Figur, große Augen, volle Lippen und eine kleine, schmale Nase. Wenn ich ehrlich bin, erscheint mir das Frauenbild auf Instagram nicht besonders divers. Auch die Medienwissenschaftlerin Dr. Maya Götz hat dieses Phänomen untersucht und bestätigt: Die meisten Frauen präsentieren sich hübsch zurechtgemacht, sind schlank und jung. Der richtige Filter sorgt dann noch dafür, dass der Alltag in Szene gesetzt wird und die Nase noch etwas schmaler und die Lippen noch etwas voluminöser wirken. Die Themen? Oft schwer zu sagen. In jedem Fall weniger Politik, dafür mehr Schminke. Ich beobachte seit geraumer Zeit, dass Instagram nicht einfach in der virtuellen Welt bleibt, sondern massive Auswirkungen auf das wahre, nein, ich sollte besser sagen: das analoge Leben hat. Viele Menschen fühlen sich, wenn sie in den Spiegel schauen, nicht mehr gut genug, nicht schön genug. Der Anblick ist im Vergleich mit den perfekten, reichlich überarbeiteten Fotos oft frustrierend. Selbst Patientinnen, die über fünfzig Jahre alt sind, fragen mich oft, warum Celebritys in ihrem Alter oft so viel besser aussähen als sie. Bei diesen Gesprächen merke ich ganz konkret, dass die Konkurrenz mit virtuellen Identitäten ein großes und umfassendes Problem ist, das alle Altersklassen betrifft. Ich versuche meinen Patientinnen dann klarzumachen, dass die meisten Fotos, die im Internet kursieren, bearbeitet sind und die wenigsten Promis in der Realität so ebenmäßige Porzellanhaut haben. Auch wenn es schwierig ist, das zu glauben, weil die Gesichter und Körper auf den Fotos so echt wirken: Bei den meisten Fotos wird mit Photoshop und Filtern nachgeholfen, von chirurgischen Eingriffen ganz zu schweigen.
Haben wir uns möglicherweise bereits so sehr an Künstlichkeit gewöhnt, dass wir ein natürliches Gesicht nicht mehr als schön genug empfinden? Und hängen wir bereits in einem Teufelskreis fest?
Sehen wir uns zunächst an, wie wir heute konkret in den sozialen Medien interagieren und was uns dazu bewegt, vor allem unbewusst.
Die meisten Menschen, die Fotos von sich in die sozialen Netzwerke stellen, bearbeiten sie vorher eingehend. Erst dann werden sie mit einem zufriedenen Lächeln und einem Hauch Anspannung hochgeladen. Leider hält dieser Zustand der Zufriedenheit nur einen kurzen Moment an. Und genau das nutzen die sozialen Medien für ihre Zwecke.
Es ist Teil des Geschäftsmodells, die Aufmerksamkeit der Nutzer so lange wie möglich zu bündeln und sie dazu anzuregen, auf der Plattform zu verweilen. Je länger die User bleiben, desto mehr Daten hinterlassen sie und ihnen kann immer personalisiertere Werbung gezeigt werden. Instagram, Snapchat, Facebook – sie alle wollen das Gleiche: uns binden. Um es im Klartext zu sagen: uns süchtig machen. Denn dann bleiben wir, unbewusst und auch oft gegen unseren rationalen Willen. Oder können Sie genau sagen, wie oft und wie lange Sie Social Media täglich nutzen? Und wenn ja, möchten Sie das öffentlich zugeben? Die Bindung funktioniert, auch bei mir. Aber warum ist das so? Zum einen sind es die immer neuen Reize, die uns stimulieren. Egal ob es die Bilder und Kommentare sind, unsere eigenen Aktionen oder die anderer, ob es für uns angenehme oder weniger angenehme Reize sind: Das Gehirn gewöhnt sich an diese Stimuli und will mehr davon. Zum anderen empfinden wir jeden Like und jeden Kommentar, den wir bekommen, als pure Belohnung, denn unser Gehirn schüttet in dem Moment den Neurotransmitter Dopamin aus. Sofort sehnen wir uns dann nach einer neuen Ladung Glücksgefühl und können die Plattform nicht verlassen. Zudem zeigen Likes in dieser virtuellen Welt an, wie hoch man im Kurs steht, wenn man so will, wie viel Wert man hat.
Wir Menschen sind soziale Wesen, die sich nach Anerkennung sehnen, und Instagram und Co. scheinen uns genau diese zu geben, wenn wir nur aktiv genug sind. Aber wie erwähnt machen die sozialen Netzwerke auch passiv Spaß. Man scrollt sich von einem Account zum anderen, folgt der besten Freundin wie auch den größten Stars. Letztere sind häufig Influencer, so wie meine Patientin es von sich behauptete, nur mit teilweise mehr als 100 000 Followern. Diese beeinflussen uns im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kaufen Dinge und probieren neue Stylings aus, manchmal ohne genau zu wissen, ob wir selbst darauf gekommen sind oder ob wir uns diese Sachen abgeguckt haben. Influencer arbeiten oft mit Firmen zusammen, die vor allem jüngere Zielgruppen nicht mehr anders erreichen können, und präsentieren ausgewählte Produkte inzwischen meist mithilfe ausgeklügelter Kampagnen. Influencer sein, sofern man eine große Reichweite hat und die Werbepartner gut zahlen, ist ein Vollzeitjob. Inzwischen kann man den sogar lernen, zum Beispiel bei der »Influencer Marketing Academy« in Berlin. Das Ziel: Die Follower langfristig an die eigene Marke binden. Das klappt meist gut, wenn man ein bestimmtes Thema hat, zum Beispiel Fitness oder Ernährung. Die Influencer auf Instagram scheinen zudem sehr nahbar, als wären sie wie Sie und ich, nur haben sie häufig ein für ihre Follower perfekt erscheinendes Leben, sehen immer top aus und reisen an die schönsten Orte der Welt.
Die Trends, die Influencer heute zum Teil verbreiten, werden für mich als plastischen Chirurgen manchmal zu einer immensen Herausforderung. Einigen Menschen scheint der Unterschied zwischen virtueller und realer Welt immer weniger bewusst zu sein. Oft hängt daher die plastische Chirurgie den Ansprüchen der Patienten hinterher. Ich erfahre manchmal erst durch meine Patienten, was gerade hip ist. Eine solche Situation ergab sich letztes Jahr, als eine Patientin in mein Büro kam und ganz selbstverständlich sagte: »Ich möchte einen Toblerone-Tunnel.« Die knusprige Dreiecksschokolade aus der Schweiz kannte ich, aber beruflich war ich – außer dass sie bei übermäßigem Genuss bestimmt auch zu vermehrten Fettpölsterchen führt – noch nicht damit konfrontiert worden. Ich wollte mir aber auf keinen Fall anmerken lassen, dass ich weder den Begriff noch den neuen Trend kannte, also entschied ich mich, meine Patientin souverän anzuschauen, zu nicken und so zu tun, als würde ich diesen Wunsch auf dem Laptop vermerken. Schnell ging ich heimlich ins Internet und googelte »Toblerone Tunnel«. Mit wenigen Klicks fand ich heraus: Die Bezeichnung meinte die Lücke, die sich bei manchen Frauen ganz oben zwischen den Oberschenkeln auftut und durch die im Idealfall, wie heutzutage viele meinen, eine Toblerone-Schokoladen-Schachtel passen sollte. Eine Erscheinung, die bei Frauen schon länger beliebt und chirurgisch durchaus leicht herzustellen ist, das konnte ich auf den ersten Blick sehen. Es handelt sich um eine präzise Fettabsaugung, also besprach ich mit meiner Patientin die Risiken eines solchen Eingriffs. Dass ich zunächst nicht wusste, wovon die Patientin sprach, hat sie nicht gemerkt. Über den neuen Trendnamen muss ich noch heute schmunzeln.
Influencern wurde seit Längerem vorgeworfen, Schleichwerbung zu betreiben, also für das Bewerben von Produkten und Marken bezahlt zu werden, ohne es zu kennzeichnen. Dagegen werden inzwischen in Deutschland rechtliche Schritte eingeleitet. Unter Posts liest man daher jetzt häufig, dass es sich um Werbung handelt. Obwohl das Bild dazu so aussieht, als säße zum Beispiel ein Mann einfach so, ganz entspannt, zufällig und spontan in einem Café. Dabei ist auf so einem Foto nichts dem Zufall überlassen. Vom Milchschaum bis zur Mütze auf dem Kopf, alles wurde perfekt inszeniert. Tatsächlich kann auch schon mal ein ganzer Tag vergehen, bis ein Foto von Influencern hochgeladen wird, so aufwendig ist die Nachbearbeitung.
Die sozialen Medien sind der Traum aller Marketinggurus, aber sie können zum Albtraum für das Selbstwertgefühl werden. Denn warum wollte sich meine Patientin ein Filtergesicht nach dem Kindchenschema operieren lassen? Meine These: Wenn man für die gefilterten und bearbeiteten Fotos Tausende von Likes mehr bekommt als für das gleiche unbearbeitete Bild, ist es nicht verwunderlich, dass man daran zweifelt, ob man für sein natürliches Aussehen überhaupt noch Anerkennung bekommen würde.
Das Muster hinter dem Sog der sozialen Netzwerke zu verstehen ist hilfreich, aber das tat in dem Moment, als ich meiner neuen Influencerpatientin gegenübersaß, nicht viel zur Sache. Sie erwartete eine Antwort. Dennoch hatte ich erst mal noch einige wichtige Fragen. Zunächst interessiert mich immer die Motivation des Patienten. Wie stark ist der Wunsch ausgeprägt? Ist der Patient sich ganz sicher, dass er diese Veränderung wirklich mit allen Konsequenzen durchdacht hat? Ist ihm bewusst, wie er den Eingriff in einigen Jahren wahrnehmen wird? Das ist insbesondere bei einem so jungen Menschen wie jener Frau, mit der ich gerade sprach, ein wichtiger Aspekt. Im weiteren Gespräch mit der Patientin fand ich heraus, dass sie schon länger mit dem Wunsch spielte, ein Filtergesicht zu bekommen, es ihr absolut ernst damit war und sie eine Karriere als Influencerin als realistisch einstufte. Influencerin war ihr Traumberuf, von dem sie nicht abrücken wollte.
Zunächst war also für mich wichtig festzustellen: Kann ich den Eingriff als Arzt durchführen, ohne dem Patienten Schaden zuzufügen? In gewisser Hinsicht war es tatsächlich möglich, das Idealbild, das die junge Patientin von sich hatte, in die Realität umzusetzen. Es wäre möglich, dass sie sich einem sogenannten »Chemical Eyebrow Lift« unterzieht. Dabei wird eine kleine Dosis Botulinumtoxin unterhalb der Augenbraue eingespritzt. Die Braue wird dadurch angehoben und das Auge optisch vergrößert. Falls ihr dies nicht genug wäre, könnte sie auch eine Oberlidstraffung machen lassen, bei der Oberlidhaut entfernt wird, was ebenfalls zu einer optischen Vergrößerung der Augen führt. Um ihren Schmollmund zu betonen, hatte sie bisher meist Lippenstift oder Lipgloss verwendet. Da sie sich die voll wirkenden Lippen aber nun dauerhaft wünschte, wäre ein »Lippenshaping« durch Hyaluronsäure möglich. Eine Methode, die inzwischen zu einem bewährten Klassiker in der plastischen Chirurgie geworden ist. Mit besonderen Unterspritzungsmethoden können selbst schmallippige Frauen volle Lippenformen bekommen. In dieses Schema passt auch die Betonung der Wangenknochen, die vor dem Spiegel gern mit Rouge in Szene gesetzt werden. Durch eine dezente Auffüllung des Areals oberhalb der Wangenknochen kann dieser Effekt mit einem Filler langfristig erzielt werden. Auch die Nase könnte ich durch eine OP verkleinern. Hier lag allerdings der Knackpunkt. Jede Nase wirkt auf einem Selfie, aufgenommen mit einem Abstand von circa dreißig Zentimetern, um 30 Prozent größer, als sie tatsächlich ist, ganz anders, als sie im Spiegel oder auf einem traditionellen Foto wirkt. Eine Selfienase, die aus diesem Abstand stupsig wirkt, wäre in der Realität vermutlich zu klein, um ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen, das Atmen. Ich zweifelte stark daran, dass ich all diese Eingriffe, insbesondere die extreme Nasenoperation, persönlich als Mensch nachvollziehen und verantworten könnte.
Wir alle haben eine Vorstellung davon, wie sich gesellschaftlicher Druck anfühlt, denn wir erleben ihn jeden Tag. Wurde man früher von der Großmutter gemaßregelt, wenn man am Kaffeetisch nicht mit geradem Rücken saß, erstreckt sich der soziale Druck heute nicht nur über unser direktes Umfeld, sondern vor allem über den virtuellen Raum. Unsere emotionale Angriffsfläche hat sich somit vervielfacht. Positives wie negatives Feedback lauert nicht nur in der Schule, in der Bahn, an Supermarktkassen und am Telefon, sondern genauso – und oft auch noch verstärkt – auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Snapchat, in den professionellen Karriereportalen Xing und LinkedIn und natürlich in Dating-Apps wie Tinder und Lovoo, die explizit auf die Bewertung anderer ausgelegt sind. Dabei stellt sich die Frage: Wie weit treibt uns der Druck der sozialen Medien? Und inwieweit möchte ich als plastischer Chirurg ein Teil der Maschinerie oder Erfüllungsgehilfe sein?
Dass die mit Filter veränderten Selfies der Patientin bei Instagram und Snapchat Erfolg haben, war für mich nicht unverständlich. Genauso rational nachvollziehbar war für mich ihr Wunsch, denn warum sollte sie sich täglich mit einem Filter bearbeiten, wenn man den Filter in die Realität umsetzen und das gewünschte Gesicht tagtäglich tragen kann? Trotzdem: Ihre Anfrage verwunderte mich. Sich von einem Filter und Menschen, die andere anhand von Likes bewerten, vorgeben zu lassen, wie man im Idealfall aussehen sollte, erschien mir extrem.
Ich erinnerte mich in diesem Moment in der Praxis an eine Situation mit einer guten Freundin. Wir saßen damals in einer Berliner Bar, in deren hinterem Teil sich ein Tattoostudio befand. Ich versuchte die Geräusche der Tätowiermaschine zu ignorieren, als sie sagte: »Jetzt schau doch mal hin!« Anne, eine meiner ältesten Freundinnen, zog ihr Kinn noch etwas tiefer zur Brust hin.
»Dieses Doppelkinn meine ich.«
»Fast jeder hat ein Doppelkinn, wenn man das Kinn auf die Brust drückt«, entgegnete ich und nahm einen Schluck aus meinem Glas, in der Hoffnung, wir könnten bald zum nächsten Thema übergehen.
Die meisten meiner Freunde sind zum Glück weder Ärzte noch haben sie mit Schönheitsoperationen viel am Hut. Ich genieße es sehr, nach der Arbeit und am Wochenende mit ihnen zusammen zu sein. Sie bringen mich auf andere Gedanken und erden mich, fernab von Schönheitsidealen und absurden Wünschen. Doch in der letzten Zeit hat sich etwas verändert. Manche von ihnen beschäftigen sich mehr mit ihrem Aussehen als früher. Das Älterwerden ist der Grund, könnte man meinen, aber das ist es nicht unbedingt. Die Tatsache, dass wir alle dauernd Fotos von uns auf Instagram, Facebook und in den WhatsApp-Status posten, lässt uns nicht nur alle zu Selbstdarstellern werden, sondern bringt uns auch dazu, uns deutlich mehr mit uns selbst zu beschäftigen, und macht uns dabei auch selbstkritischer. Britische Wissenschaftler um die Epidemiologin Prof. Yvonne Kelly vom University College London nehmen laut einer Studie von 2019 sogar an, dass es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und depressiven Verstimmungen gibt. Es scheint, dass Menschen, die sich viel in den sozialen Medien bewegen, oft unzufriedener und unglücklicher sind. In einer Studie mit dem Titel »Selfies – Living in the Era of Selfie Photography« erforschten Wissenschaftler der Boston University School of Medicine den Zusammenhang von körperdysmorphen Störungen und dem Umgang mit der Nutzung von Selfies und Filtern in den sozialen Medien bei Teenagern. Dysmorphophobie ist eine psychische Störung, bei der Betroffene ihren eigenen Körper ablehnen, eine Mischung aus falscher Selbstwahrnehmung, die manchmal sogar wahnhaft ist, und dem Denkmuster, das eigene Unglück auf die äußere Erscheinung zu projizieren. Das konnte ich schon erleben, bevor die sozialen Medien die Trends bestimmten. Wie oft haben sich Patienten von einer Schönheitsoperation seelische Heilung versprochen, wie oft habe ich erlebt, dass es auf uns Chirurgen zurückfällt, wenn die Operation die Ursache des Leids nicht auflöst. Im Prinzip muss ich mir eingestehen, dass ich oft indirekt die Psyche und den Selbstwert meiner Patienten behandle anstatt schlaffe Haut oder überschüssiges Fettgewebe. Das Problem ist also nicht neu, doch die Wahrscheinlichkeit, unter Dysmorphophobie zu leiden, scheint sich heute, laut den Wissenschaftlern der Boston University School of Medicine durch Instagram und Co., deutlich erhöht zu haben. Die Nutzung von Filtern, so fanden die Forscher heraus, hat unser Verständnis von Schönheit insgesamt nachhaltig verändert. Dass Filter den individuellen Selbstwert stören können, liegt also, wie ich annehme, daran, dass sich Gefühle der Minderwertigkeit als Konsequenz daraus entwickeln, die gefilterten Standards nicht erreichen zu können.
»Und wenn jeder ein Doppelkinn hat«, sagte Anne herausfordernd, »warum ist mir dann erst jetzt aufgefallen, dass ich eins habe?«
»Weil du dich inzwischen mehr auf dem Screen deines Handys betrachtest als in einem Spiegel. Selfies werden meist von unten aus einem ungünstigen Winkel gemacht«, erklärte ich ihr. Anne schien nicht überzeugt. Ich hingegen bin mir sicher, dass der Selfiewahn eine Menge damit zu tun hat, warum meine Praxis heute vermehrt Anfragen zum Hals- oder Facelifting erreichen. »Das Doppelkinn muss weg«, lautet immer häufiger die Devise.
Dass Selfies uns zu einer extremen Form von Selbstkritik bringen können, sah ich nicht nur damals an Anne, sondern jetzt gerade überdeutlich an meiner neuen Patientin. Ich beschloss, das gewünschte Filtergesicht nicht zu operieren, und erklärte das der jungen Frau, die enttäuscht von dannen zog. Ich sah die Patientin nie wieder, fragte mich aber noch lange, ob sie wohl einen Kollegen gefunden hat, dem ihr Wunsch keine Bauchschmerzen bereitete. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser Trend salonfähig sein wird?
Die Vorstellung, dass Menschen demnächst mit einem dauerhaften Snapchat-Filtergesicht herumlaufen könnten, und der Grad der Absurdität dieses Gedankens ließen mir in dieser Nacht keine Ruhe. Ich musste den Fall genauer betrachten und herausfinden, ob die junge Frau ein Einzelfall war oder das Filtergesicht einfach der nächste neue Trend werden würde. Es dauerte nicht lange, bis ich herausfand, dass meine Patientin nicht die Einzige war, die auf diese Idee gekommen war. Schon bald hörte ich von meinen Kollegen ganz ähnliche Geschichten. Auch im hoch angesehenen Ärzteblatt, das von der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung herausgegeben wird, wurde berichtet, dass Selfies und soziale Medien nach Einschätzung vieler plastischer Chirurgen die Selbstwahrnehmung der Menschen stark verändern und die »Generation Selfie« durch Instagram und Co. angetrieben wird, plastischchirurgische Eingriffe vornehmen zu lassen. Das Ziel der Jugendlichen: die selbst erstellten idealisierten Bilder von sich in die Realität umzusetzen. Bereits 2005 kam die Psychologin Dr. Sherrie Delinsky von der Harvard Medical School zum gleichen Ergebnis, nämlich dass erhöhter Medienkonsum den Wunsch nach einem ästhetischen Eingriff verstärkt. Die Psychologin Dr. Ada Borkenhagen, die im Spiegel von dieser Studie berichtete, bewertete die Bilder, die wir in den sozialen Medien und in der Werbung tagtäglich von idealtypischen Körpern sehen, als nicht real, sondern nannte sie »ästhetische Fiktionen«.
Erst vor Kurzem veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie ihre neue Statistik. Seit über zehn Jahren kommt sie durch repräsentative Umfragen den Motiven und Behandlungswünschen von Patienten auf die Spur. Zum ersten Mal gaben viele Patienten an, dass sie durch die sozialen Medien zu einem Eingriff motiviert worden seien. 14 Prozent der befragten Patienten gaben sogar konkret an, dass ein Eingriff ihr Erscheinungsbild auf Selfies und Fotos optimieren soll.
Meine Filtergesichtpatientin war also kein Einzelfall, sondern ein Exempel, das die ganze Branche der plastischen Chirurgie betraf. Dass Menschen bereit waren, sich allein zur Generierung von Followern operieren zu lassen, hinterließ bei mir Unwohlsein. Der Wunsch, sich ein Filtergesicht machen zu lassen, ist in meinen Augen extrem, denn während man mit wenigen Mausklicks den Körper in Sekundenschnelle virtuell verändern kann, ist ein operativer Eingriff nicht so einfach rückgängig zu machen. Wenn schöne, junge Frauen ihre Körper operieren lassen, um sich im sozialen Umfeld sicher und gesehen zu fühlen, ist die Frage, inwiefern man noch von Selbstbestimmung reden kann, sich so eine Operation zu wünschen, oder ob man von Unterwerfung unter die herrschenden, sozialen Normen sprechen muss.
Ich möchte daher Aspekte des aktuellen Schönheitswahns beleuchten, die Extreme, aber auch die Wünsche von Normalverbrauchern, die einfach »etwas schöner, etwas frischer« aussehen wollen. Wenn durch die sozialen Medien viele Menschen tatsächlich zu Selbstdarstellern werden und die Wünsche der Patienten immer extremer, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir noch tiefer graben und das Thema Schönheit und die aktuelle Debatte um die Frage, wohin uns der Schönheitswahn führt, eingehend analysieren.