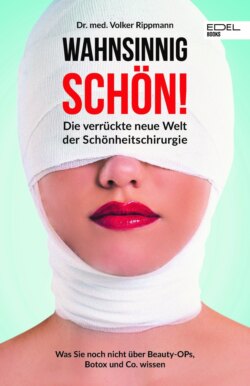Читать книгу Wahnsinnig schön! - Volker Rippmann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3 Gehen Sie noch zum Friseur oder schon zum Chirurgen? Warum wir unseren Körper verändern wollen
ОглавлениеKörperkult gab es schon immer. Heute aber scheint der Wille zur Kontrolle oder Veränderung der äußeren Hülle egal ob mithilfe von Beautysalons, Fitnessstudios oder Schönheitschirurgen zum Megahype mutiert zu sein – oft leider sogar zum Wahn. Ich denke, das ist auch der Grund dafür, dass ich meine Patienten eher im Fitnessstudio treffe als bei Kentucky Fried Chicken. Wer im Studio trainiert, macht das schließlich nicht unbedingt der frischen Luft oder der schönen Aussicht wegen und auch nicht, weil die aufgereihten Laufbänder und Crosstrainer so viel einladenden Charme versprühen. Wer hier schwitzt, möchte sich und seinem Körper etwas Gutes tun. Für die einen geht es um die körperliche Gesundheit, um Ausgeglichenheit und Kondition, für die anderen um Ästhetik, ums Abnehmen oder um Muskelzuwachs. Viele möchten einfach das Rundumpaket: Gesundheit und Schönheit in einem. In unseren Zeiten des Wohlstands, hierzulande ohne Sorgen um Nahrung oder gar Kriege, kann man sich exzessiv um die eigene Schönheit kümmern. Der Körper wird bearbeitet, diszipliniert und geformt. In unserer Leistungsgesellschaft bedeutet unser Körper vor allem eines: »work in progress«.
Diese Arbeit ist zur Normalität geworden, als sei der Körper ein Auto, das man tunen kann. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Alles scheint sich verändern, angleichen oder wegtrainieren zu lassen. Wir sprechen über den Körper, als sei er etwas, das wir besitzen, und nicht das, was wir sind.
Schon der Philosoph Descartes reflektierte über das Leib-Seele-Problem und kam seinerzeit zu dem Schluss, dass Geist und Körper auch voneinander getrennt existieren können müssten, weil man sich den Körper wegdenken kann und das Denken selbst eben nicht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt entstand die Hierarchie, die den Geist als Meister des Körpers versteht. Die neurowissenschaftliche Realität sieht aber anders aus: Unsere Erfahrungen entstehen durch die Wahrnehmungen unserer körperlichen Sinne. Unseren Emotionen und Gedankengängen liegen neurochemische Prozesse zugrunde. Was immer uns ausmacht, wir sind zunächst ein Haufen Biomasse. Wir müssen verstehen: Wir sind unser Körper. Trotzdem regiert im allgemeinen Sprachgebrauch der Dualismus: Wir benennen Körper und Geist getrennt. Descartes sagte damals: »Ich denke, also bin ich.« Meine Patienten sagen heute: »Mein Körper muss anders aussehen, denn das bin ich einfach nicht.«
Die Abgrenzung des Ichs vom Körper findet gerade dann statt, wenn wir uns über unseren Körper echauffieren, weil er anders funktioniert und aussieht, als man es sich vorgestellt hat. »Ich bin diszipliniert, doch mein Körper macht, was er will«, sagen manche meiner Patienten, als handle es sich um etwas Widerspenstiges, das erzogen werden will, wenn der Speck um die Hüften einfach nicht verschwindet oder man in Stresssituationen, wie vor laufender Kamera oder in wichtigen Meetings, zu schwitzen beginnt und rot anläuft. Souveränität auszustrahlen ist uns sehr wichtig. Besonders hier macht uns unser Körper allerdings häufig einen dicken Strich durch die Rechnung und verrät, was wir nicht sagen wollen, zeigt offen, was wir lieber verborgen hätten, zum Beispiel dass wir doch nicht so stressresistent sind, wie wir es im Bewerbungsgespräch versprochen haben. Ich als plastischer Chirurg kann tatsächlich einiges richten, doch lässt sich der Körper nicht dauerhaft bezwingen. Wir können nicht verhindern, dass unser Körper zunimmt, irgendwann altert, sich schlichtweg ständig verändert und uns dadurch vor immer neue Herausforderungen stellt. Spätestens die Zeit wird uns ein Schnippchen schlagen. Doch bis dahin heißt es für viele: Was zum vermeintlich Besseren verändert werden kann, soll verändert werden.
Die Arbeit am eigenen Körper wird von den einen als kreative Selbstermächtigung angesehen, von den anderen als Unterwerfung unter soziale Normen verteufelt. Egal ob man sie als negativ oder positiv bewertet, egal wie groß das Ausmaß der Veränderungen ist, all das kann man ganz individuell entscheiden – oder doch nicht? Wie die Soziologin Paula-Irene Villa der Universität München schrieb, ist das Wissen, wie wir unseren Körper verändern möchten, weder »vom Himmel gefallen« noch müssen wir Soziologen sein, um zu verstehen, dass das, was man als »schön« und »normal« empfindet, gesellschaftlich geprägt ist. Was viele machen, ist meistens okay – eben weil es viele machen. Wer mithalten möchte, muss sich anpassen. Wer souverän wirken und schön aussehen möchte, muss hart arbeiten. Deshalb trainieren wir unseren Körper, kleiden uns modisch, gehen zur Maniküre, zum Friseur – und wenn das alles nicht reicht, vielleicht eben auch zum plastischen Chirurgen.
Dass der gesellschaftliche Druck eine starke Wirkung auf uns hat, ist auch die Überzeugung der Bestsellerautorin Charlotte Roche. In der Süddeutschen Zeitung stellte sie allerdings mal eine interessante weiterführende Theorie auf. Sie war der Ansicht: Je mehr man als Frau durch Push-up-BHs, Wimperntusche und Extensions fake, desto schwerer sei es, das natürliche Spiegelbild zu ertragen, wenn man sich am Abend abschminkt und sich aus der figurformenden Kleidung schält. Die Dissonanz entsteht also nicht nur im Vergleich mit anderen, sondern auch im Vergleich mit dem zurechtgemachten Selbst. Diese Theorie ist aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar, denn man gewöhnt sich eben an das, was man ständig sieht. Und wie dramatisch wird es erst, wenn Freunde und Kollegen, die Angehörigen der sozialen Gruppe, einen in allen Lebensbereichen zu überstrahlen scheinen?
Roche kritisierte außerdem, dass es vornehmlich Frauen sind, die an ihrem Äußeren werkeln müssen, um mithalten zu können. Daran ist sicherlich etwas Wahres. »Wer schön sein will, muss leiden«, pflegte schon meine Oma zu meiner Mutter zu sagen – tatsächlich aber nie zu mir. Doch kann ich als plastischer Chirurg heute bestätigen: Männer leiden ebenso wie Frauen unter vermeintlichen Makeln. Die Schönheitsindustrie hat auch sie erreicht. Der Wunsch nach optischer Optimierung regiert heute das Leben Tausender und Abertausender.
Die Selbstoptimierung unserer Leistungsgesellschaft, in der Wettbewerbsfähigkeit belohnt wird, hat aber natürlich nicht nur die Arbeit am Körper zur Folge. Sie dominiert, laut der Soziologin Villa, all unsere Lebensbereiche – und exemplarisch das Programm im Privatfernsehen. Das perfekte Dinner bei Vox kürt täglich die besten Köche und Gastgeber und bei Germany’s next Topmodel auf ProSieben rangeln »die Mädchen« jedes Jahr aufs Neue um die begehrtesten Modeljobs, die sie nur dann abstauben werden, wenn sie besonders »hart an sich arbeiten«, wenn sie die »größte Entwicklung« durchgemacht und sich somit kurzum als würdig erwiesen haben.
Dabei steht tatsächlich nicht die Optimierung als solche im Zentrum, es geht vielmehr darum, Leistungsbereitschaft zu signalisieren und sich für die eigenen Träume zu strecken. Dieses Phänomen zeigt sich, wenn auch deutlich subtiler, im Privaten ebenfalls an allen Ecken. Der ständige Vergleich mit unseren Arbeitskollegen, Freunden, sogar mit Fremden auf der Straße treibt uns schon lange an. Die höchste Form der Vergleichsmöglichkeit bieten aber heute eben die allgegenwärtigen sozialen Medien, denn sie begleiten uns, wohin wir auch gehen, und sind ständig abrufbar. Gegen den inneren Automatismus zu vergleichen kann man sich kaum wehren, wenn man durch die bunten Fotos, Storys und Profile scrollt. All die Likes und Klicks verstärken zunehmend unseren Impuls, äußerlich mithalten zu wollen. Es scheint dann nicht mehr so wichtig zu sein, wie man sich fühlt, nein, es von außen so aussehen zu lassen, als lebe man das beste Leben im schönsten Körper, egal was innen tatsächlich los ist, scheint völlig auszureichen. Blender sind dabei häufig erfolgreich, Oberflächlichkeit regiert. »Fake it till you make it.« Leider geht das nur oft nicht auf: Das Innere kommt dabei vielfach nicht nach.
Während wir uns sehr wohl bewusst sind, dass unsere Selbstdarstellung und die Realität häufig doch ziemlich weit auseinanderliegen, blendet man dieses Bewusstsein beim Studieren und Stalken fremder Profile offensichtlich häufig aus. Kurzum: Wir faken, tun uns aber schwer zu erkennen, dass die anderen das auch tun. Erst kürzlich kommentierte eine Instagram-Nutzerin ein Foto der Autorin Sophie Passmann und bat sie, ihr Beautygeheimnis zu teilen, schließlich habe die Autorin kaum sichtbare Poren, obwohl sie starke Raucherin sei. Passmann schrieb daraufhin knapp und ehrlich: »Photoshop«. Zum Glück gibt es solch erfrischend ehrliche Ausnahmen.
Die Frage, die bleibt, ist nicht, ob geschummelt wird – denn das ist an der Tagesordnung –, sondern in welchem Maß und wie offen damit umgegangen wird.
Das kann und muss jeder Mensch erst mal für sich beantworten. Genauso wie die Frage, wann der Optimierungsprozess abgeschlossen und der gewünschte Grad an Perfektion erreicht ist. Das scheint allerdings oft nicht klar. Ist das Leben für viele zum oberflächlichen Wettkampf ohne Ziel mutiert? Sind dem Wahnsinn praktisch keine Grenzen mehr gesetzt?
Was für ein Glück, dass mit den Optimierungswünschen zumindest niemand alleingelassen wird. Immer ausgefeiltere Body-Tracking-Apps helfen uns, unser tägliches Pensum genauestens zu überwachen, und weisen uns darauf hin, wenn wir unser »Schönheits- und Fitnessprogramm« nicht erfüllt haben. Haben wir es nicht geschafft, flüstert Heidi uns ins Ohr: »Du musst eben härter an dir arbeiten.« Was, Sie haben schon seit einer Woche kein Selfie und kein Video mehr aus dem Fitnessstudio gepostet? Jetzt wirds aber Zeit! Falls die Apps es nicht tun, wird die soziale Kontrolle es schon richten.
Es ist kein Wunder, dass die gigantische Schönheitsindustrie floriert, denn man braucht doch jede Hilfe, die man kriegen kann. Der Wunsch, schön zu sein, ist omnipräsent. Ob das gut oder schlecht ist, sei erst mal dahingestellt, Fakt ist aber: Fürs Mitmachen muss sich niemand schämen. Das fällt nur in manchen Bereichen leichter als in anderen. Wenn Sie samstags in den Drogeriemarkt gehen und viel Geld für Cremes, Masken, Make-up und Rasierer hinblättern, wird Ihnen das nicht peinlich sein, nein, es gehört sogar dazu – auch für mich. Bevor ich morgens aus dem Haus gehe, durchlaufe auch ich eine Routine: Dusche, Rasur, Zahnpflege, Creme, Parfum, Wachs in die Haare. Auch ich trete meinen Patienten nicht in Jogginghose und mit fettigen Haaren entgegen – eine unsichtbare Verhaltensregel im sozialen Umfeld und beruflichen Kontext. Oder würden Sie sich gern von mir behandeln lassen, wenn ich im kaffeebefleckten Kittel vor Ihnen säße? Ich hoffe stark, Sie nähmen die Beine in die Hand und würden das Weite suchen. Gepflegt auszusehen gehört nicht nur zum guten Ton, in unserer Gesellschaft ist es in vielen Bereichen eine Pflicht.
Während die Kosmetikindustrie immer neue Produkte auf bereits übersättigte Märkte pusht, boomt auch das Fitnessgeschäft. Einer meiner Patienten erzählte mir erst kürzlich, dass er auf der Kölner Fitnessmesse Fibo einer von 145 000 Besuchern war. Der Personal Trainer stand stundenlang Schlange für Gratisproben von Nahrungsergänzungsmitteln, während er beobachtete, wie andere Besucher versuchten, Selfies mit ihren durchtrainierten Idolen von Instagram zu ergattern. Das Gleiche habe ich schon auf etlichen Beautymessen und -Events erlebt, die ich besuche, um Vorträge zu halten oder neue Techniken zu präsentieren. Was ich dort beobachte, stimmt mich immer wieder nachdenklich. So war es auch bei meinem letzten Besuch einer solchen Veranstaltung. Kaum war ich durch die Tore getreten, fühlte ich mich wie auf einem orientalischen Basar. Anstatt der typischen Lampen und stark riechenden Gewürze empfingen mich hier aber nur die stickigen Düfte von Parfums und Bodysprays und Mütter mit ihren Teenietöchtern, die Prosecco mit Bambusstrohhalmen aus kleinen Flaschen tranken. Riesige Plakate blitzten entlang der Gänge, die jung und schön gephotoshopte Gesichter zeigten. Vor mir schoben sich alte wie junge Männer und Frauen wie eine einzige Masse durch die Gänge. Niemand schien sich sonderlich für den Anlass herausgeputzt zu haben. Ich passierte unzählige Glücksräder, vor denen sich meterlange Schlangen gebildet hatten. Die Besucher waren verrückt danach, Produkte abzugreifen, die ihre Probleme lösen würden, die neueste Augenmaske gegen geschwollene Lider, die Magnetmaske gegen tiefe Poren oder eine Handcreme mit Urea gegen die trockenen Finger im Winter. Es gab zahlreiche Waxingstände, an denen Frauen ihre Härchen entfernen lassen konnten. An einem anderen wurde ein aufplusternd wirkender Lipgloss angepriesen, der den Besuch beim plastischen Chirurgen überflüssig machen sollte. Das interessierte mich natürlich, also trat ich näher heran und hörte gerade, wie eine Frau rief: »Ah, das brennt!« Sie verzog das Gesicht, die Verkäuferin sagte nur: »Das ist Chili.«
»Wer schön sein will, muss leiden – aber nicht gleich beim Chirurgen«, war die Aussage der kessen Dame am Counter! Wie viele Firmen inzwischen Leistungen bewerben, die den Gang zum Schönheitschirurgen ersetzen sollen, überraschte mich nicht, im Gegenteil, der Besuch der Messe bestätigte mir: Äußerliche Schönheit ist absolut in und schön sein zu wollen nicht peinlich.
Ob es darum geht, im sozialen Kontext das Gesicht zu wahren, dem Partner zu gefallen oder einfach nur sich selbst, an dem Antrieb, das eigene Aussehen zu verändern, ist grundsätzlich nichts verwunderlich. Dass wir uns die Haare färben, sobald die ersten grauen zu sprießen beginnen und plötzlich wie Antennen in die Höhe ragen, ist jedem verständlich. Ebenso nachvollziehbar ist es für die meisten Menschen, dass man sich danach sehnt, platinblond zu sein. Dieser Wunsch ist übrigens auch an mir nicht vorbeigegangen. Nachdem ich mein Physikum, die erste große Hürde im Medizinstudium, erfolgreich absolviert hatte, belohnte ich mich mit einem weißblond gefärbten Kurzhaarschnitt bei einem Frankfurter Promifriseur, flog anschließend nach London und fand mich irre cool. Die wenigsten würden ihre Freundin dafür kritisieren, dass sie sich mal wieder hat Strähnchen machen lassen, und gewöhnlich sind Mütter nicht einmal sauer, wenn die Töchter sich mit fünfzehn Jahren die Haare mit Henna tönen oder die Spitzen auf einmal hellblau oder pink sind. Seinen Typ durch Haarefärben zu verändern, wurde praktisch schon immer sozial akzeptiert. Auch brennender Chililipgloss ist in Ordnung. Zum plastischen Chirurgen zu gehen ist aber noch immer so eine Sache.
Warum sind manche Veränderungen, die wir an unserem Körper vornehmen, wie beispielsweise eine Gesäßvergrößerung, eher verpönt, als sich zum Beispiel tätowieren zu lassen? Schon Piercings und Tattoos stellen für viele eine krassere Stufe des Eingriffs dar als der wöchentliche Gang zur »Mani-Pedi« oder die professionelle Entfernung von Haaren an Brust, Beinen und im Intimbereich. Während man Tattoos früher nur bei Seefahrern und Ringe in Augenbrauen und Nasenflügeln nur bei Mitgliedern afrikanischer Kulturen sah, ist diese Form von Körperschmuck heute von Australien bis Skandinavien präsent: bei der sportlichen Verkäuferin, dem hippen Grundschullehrer, der lässigen Ärztin und ich vermute auch bei Ihrer Tochter, Schwester, Mutter, Ihrem Bruder oder jemand anderem, dem Sie nahestehen. Für die einen wird die Modifikation des Körpers dazu genutzt, sich von der einen sozialen Gruppe abzugrenzen, um sich der nächsten, selbst gewählten zugehörig zu fühlen. Für andere geht es darum, Unfallnarben unter großflächigen Blumenmotiven zu verstecken. Für die meisten ist es wiederum einfach nur eine Frage der Ästhetik, weil sie es mögen, ihren Körper als Kunstwerk zu betrachten. Für eine Künstlerin, die ich einmal operierte, war das sogar wortwörtlich der Fall. Nach ihrer Bauchdeckenstraffung verlangte sie nach dem tätowierten Stück Haut, das wir entfernt hatten, nahm es kurzum mit nach Hause und legte es in Formaldehyd in einem Einmachglas ein, um es haltbar zu machen. Das Ganze verkaufte sie dann für viel Geld als Kunstwerk. Der Wunsch, zu behalten, was einmal Teil des Körpers war, scheint aber verbreitet. Dass Patienten entfernte Brustimplantate mit nach Hause nehmen möchten, ist zum Beispiel auch keine Seltenheit. Den Körper kontrollieren zu wollen ist inzwischen so üblich, dass es mittlerweile normal geworden ist, ihn nicht nur durch Training zu formen und durch Make-up zu stylen, sondern durch Körperschmuck wie Piercings und Tattoos zu modifizieren. Es gibt Studien, die Korrelationen zwischen dem Wunsch, invasiven Körperschmuck zu tragen, und dem Drang, sich selbst zu verletzen, gezeigt haben, und obwohl ich solche Studienergebnisse nicht anzweifeln möchte, muss man sie doch mit Vorsicht genießen. Oder wie viele Menschen kennen Sie, die weder Ohrlöcher noch Nasenpiercings haben und die Tattoos strikt ablehnen? In meinem Bekanntenkreis sind das nicht sehr viele. Aber sind wir deshalb eine Gesellschaft voller Masochisten?
Körpermodifikationen wie das Stechen von Piercings und Tattoos gehören heute längst zum Mainstream. Den Körper als Plattform zur Veränderung zu verstehen, gehört dazu und unter anderem die Beautyindustrie zehrt davon. Gefällt ein Piercing nicht mehr, nimmt man es heraus, zurück bleibt maximal ein kleines Loch. Entpuppt sich das Tattoo, auf das man mit achtzehn noch so stolz war, als bombastischer Fehler, versteckt man es unter einem weiteren oder lässt es sich – in mehreren Sitzungen – weglasern. Das ist weder günstig noch ungefährlich, die Behandlung kommt trotzdem recht häufig vor, sonderlich kritisiert wird sie nicht.
Vor dem Hintergrund der Körpermodifikation frage ich mich, wo die Grenze zwischen »etwas tun« und »etwas machen lassen« verläuft. Die geläufige Antwort ist einfach. Wer sich spritzen oder operieren lässt, sprich: zum plastischen Chirurgen geht, überschreitet eine Grenze. Diese Argumentation sieht also einen Unterschied zwischen »schamvollen« und sozial akzeptierten Veränderungsmethoden. Die Frontzähne zu bleachen, das Haarwachstum an Armen und Beinen per Laserbehandlung dauerhaft zu unterbinden und Tinte in die unteren Hautschichten des Oberarms, Schulterblatts oder Knöchels stechen zu lassen, das sind in meinen Augen aber mindestens so große Manipulationen des natürlichen Körpers, wie Filler in Gesicht und Dekolleté zu spritzen. Der Unterschied ist, dass uns Tattoos länger, wenn nicht ewig schmücken, während die Effekte von Botulinumtoxin und Hyaluronsäure nach einigen Monaten nachlassen und dann wieder verschwinden. Die Grenze liegt nicht im Gang zum plastischen Chirurgen per se. Die Art des Eingriffs spielt offensichtlich eine entscheidende Rolle. Viele Menschen bewerten OPs mit Eigenfett wie den »Brazilian Butt Lift«, das Einsetzen von Implantaten in die Brust oder die Korrektur einer Nase als Grenzüberschreitung, wenn es um die Akzeptanz von Körperveränderungen geht. Sozial akzeptiert hingegen sind Operationen, die medizinisch notwendig sind. Ist es aber nur richtig, eine Nase zu korrigieren, wenn die Nasenscheidewand so stark verkrümmt ist, dass das Atmen schwerfällt? Ist es falsch, eine Nase zu operieren, wenn sie funktionell in Ordnung ist, aber ein subjektiv als unschön empfundener Höcker sie ziert? Ist es verwerflich, schöner sein zu wollen, mit dem Ziel, sich im eigenen Körper wohlzufühlen – Optimierungsdruck hin oder her? Haben wir als Individuen nicht das Recht darauf, uns genau solche Wünsche zu erfüllen, ohne dafür verurteilt zu werden, so wie es uns freisteht, ins Fitnessstudio und zur Kosmetikerin zu gehen, uns Tattoos und Piercings stechen zu lassen, also einfach selbst zu entscheiden, ob und inwieweit wir Kontrolle auf unseren Körper und unser Äußeres ausüben?
Wo die Grenze zwischen »etwas machen« und »etwas machen lassen« liegt, haben wir nun aus der gesellschaftlichen Perspektive beleuchtet. Was aber sagt die Wissenschaft dazu? In unserer Gesellschaft verkörpern wir im wahrsten Sinne des Wortes bestimmte soziale Positionen. Egal welche Rolle man verkörpert – Frau, Vater, Kindergärtner, Verwaltungsfachangestellte, Anwalt –, wir alle verwenden bestimmte Strategien, wie die Soziologin Prof. Paula-Irene Villa es treffend beschreibt, um genau diese Rollen, diese sozialen Positionen zu verkörpern, also sichtbar auszuführen. Das fängt mit für uns alltäglichen, ganz selbstverständlichen und daher fast unbewussten Strategien wie Hygiene und Kleidung an. Als Arzt wasche ich mich regelmäßig und habe für schicke Events einen Anzug im Schrank hängen. Die Steigerung dieser Strategien sind bewusste Praktiken, wie zum Beispiel die neueste Brigitte-Diät auszuprobieren oder bis zum Sommer im Fitnessstudio zu schwitzen, um sich in Badehose oder Bikini nicht zu schämen. Dann, so analysiert die Soziologin Villa, gibt es noch eine Grauzone, die Gesundheit, Wellness und Optimierung zu vereinen scheint, wie zum Beispiel Massagen und das alljährliche Fasten. Die in der Gesellschaft momentan noch häufig als extrem wahrgenommene Strategie ist der Gang zum plastischen Chirurgen. Natürlich ist es wünschenswert, dass es mit einem neuen Haarschnitt getan ist und Sie sich nach dem Friseurbesuch schön und attraktiv fühlen. In vielen Fällen ist dieses Gefühl aber nur von kurzer Dauer und so landen viele Menschen bei mir in der Praxis. All diese Strategien, von Hygiene und Kleidungsstil, Diäten und Sport, Piercings und Tattoos bis hin zu plastischen Eingriffen, können, so die Soziologin Villa, als eine kontinuierliche Reihe von Möglichkeiten gesehen werden, die wir nutzen, um unsere soziale Position zu demonstrieren. So hat die plastische Chirurgie wie auch die anderen mehr oder weniger bewusst ausgeführten Strategien im Grunde das große Ziel, soziale Anerkennung und Erfolg zu erzielen, unsere gesamte Existenz zu verteidigen und zu legitimieren.
Die Strategien, die Paula-Irene Villa beschreibt, scheinen fließend ineinander überzugehen. Wie sie bewertet werden, hängt von der Meinung der Mehrheit ab, und auch diese Meinung entwickelt sich mit der Zeit. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch die plastische Chirurgie bald vermehrt offen im Gespräch sein wird. Dann wird sie tatsächlich zum Mainstream.
Für mich gibt es schon jetzt keine Grenze zwischen »etwas machen« und »etwas machen lassen«. Wenn der soziale Druck wächst, mithalten zu müssen, dann ist es irrelevant, ob Sie zum Friseur, zum Kosmetiker oder zum plastischen Chirurgen gehen, denn der Antrieb ist derselbe. Die Entscheidung, wie radikal Sie sich verändern (möchten), sollte aber in jedem Fall niemand außer Ihnen allein treffen. Die Grenze bestimmen ausschließlich Sie selbst.