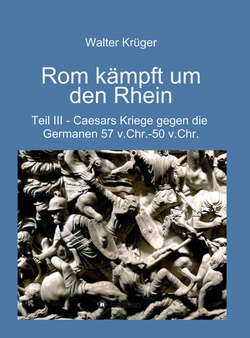Читать книгу Rom kämpft um den Rhein - Walter Krüger - Страница 9
ОглавлениеDer Überfall auf die Atuatuker
Herkunft-wer sind die Atuatuker?
In seinem Buch „De Bello Gallico“, (liber II, 4,10) erwähnt Caesar zum ersten Male einen Stamm mit dem Namen Atuatuker (lat. Atuatuci). Von den Remern, Angehörigen des belgischen Stammes der Suessionen, die sich als Römerfreunde abspalteten, erhielt er die Information, dass die Atuatuker im Jahr 57 v.Chr. wie viele andere Stämme auch, dem Oberbefehlshaber der vereinigten belgischen Streitkräfte, König Galba, 19.000 Bewaffnete zugesagt hätten. Als Caesar den Krieg gegen die Suessionen begann, beteiligten sich jedoch die Atuatuker nicht an den Kämpfen. Jedenfalls hat Caesar sie nicht erwähnt. Erst als er gegen die nordbelgische Allianz unter Boduognatus, die aus den belgischen Stämmen der Nervier, Atrebaten und Viromanduer bestand, zu Felde zog, sagten sie angeblich ihre Hilfe zu und schickten ein Heer auf den Weg, dessen zahlenmäßige Größe unbekannt blieb. Caesar sagte „mit gesamter Macht“ (liber II, 29). Ehe die Atuatuker auf dem Schlachtfeld erschienen, hatten die Nervier den Kampf gegen die Römer bereits verloren, so dass sie unverrichteter Dinge wieder umkehren mussten. Ob das der Wahrheit entspricht, sei dahingestellt. Caesar reichte allein die Absicht der Atuatuker aus, den Nerviern helfen zu wollen, um sie als Aufständische zu betrachten und anzugreifen.
Doch wer waren die Atuatuker? Über die Herkunft dieses Stammes liefert Caesar einige sehr interessante, wenn auch kurz gehaltene Informationen.
„Sie selbst waren Nachkommen der Kimbern und Teutonen, die auf ihrem Zug in unsere Provinz (gemeint ist Gallia Transalpina) und nach Italien (wohin sie nie gelangten) ihr Hab und Gut, das sie nicht mit sich führen oder tragen konnten, diesseits des Rheins in Sicherheit brachten und eine Schutztruppe von sechstausend Mann dabei zurückließen. Diese hatten sich nach dem Untergang ihrer Stämme viele Jahre lang mit ihren Nachbarn herumgeschlagen, indem sie bald angriffen, bald sich gegen Überfälle verteidigten, und sich bei einem Friedensschluss nach allseitiger Übereinkunft diesen Raum zum Wohnsitz gewählt. “(liber II, 29)
Welcher Raum das konkret war, sagt er nicht. Alle römischen Politiker und militärischen Führer waren vertraut mit den Zügen der Kimbern und Teutonen. Fast zehn Jahre hatten diese Stämme die Republik herausgefordert. Als sie geschlagen waren und die gefangenen Anführer und Krieger nach Rom gebracht wurden, konnte zweifelsfrei geklärt werden, woher sie kamen. Aufgeschrieben wurde das bestimmt, nur hat kein Dokument überlebt. Vielleicht wollten die Römer die vielen früheren Niederlagen nach Gaius Marius Sieg bei Aix-en-Provence schnell vergessen. Dass sich dennoch die Legende verbreitete, sie seien aus dem hohen Norden von der kimmerischen Halbinsel gekommen, ist deshalb völlig unverständlich. Caesar jedenfalls, dessen Verwandter im Kampf gegen die Tiguriner gefallen war, kannte den Raum ihrer Herkunft annähernd genau und hat ihn uns übermittelt: das Niederrheingebiet. Von hier stammten die Teutonen und Ambronen.
In meinem Buch „Die Kimbern und Teutonen kamen nicht aus Jütland“ habe ich nachzuweisen versucht, dass alle am Zug teilnehmenden Stämme, die beidseitig des Niederrheins wohnten, den teutonischen Stammesverband gebildet hatten, der zwischen 109 v.Chr. und 102 v.Chr. gegen die Römer Krieg führte um die freien Zugänge zum Mittelmeer entlang der Saône und Rhone bis Marsaille (Massalia). Die Teutonen und Ambronen – letztere wurden mit den Sugambrern gleichgesetzt – verloren diesen Kampf und ihren Heerkönig Teutobodo.
Aus dessen Hauptlager mit einer etwa 6.000 Mann starken Schutztruppe hatte sich im Laufe der Jahrzehnte eine neue Stammesgruppe entwickelt, deren Einfluss ungebrochen groß blieb. Sicher waren die durch die Feldzüge angehäuften Reichtümer und die für die umliegenden Stämme hohen Kriegerzahlen dafür ausschlaggebend. Als die anfänglichen Reibereien, bedingt durch den Tod Teutobodos, beigelegt werden konnten, blieben diese Nachkommen des teutonischen Heeres als Teil des eburonischen Großstammes wohnen und bezogen mehrere befestigte Orte. Es handelt sich bei den Atuatukern demnach nicht um einen Stamm aus Mitgliedern gleicher Abstammung, sondern um ein künstliches Stammesgebilde, das sich aus einer militärischen Gemeinschaft von Aristokraten und Kriegern mehrerer germanischer Stämme gebildet hatte. Eine Kriegerkaste, eine aristokratische Gefolgschaft, hatte mit den Angehörigen des teutonischen Winterlagers von 103 v.Chr. eine verschworene Gemeinschaft gebildet.
Die Krieger blieben ihren Anführern treu ergeben. Auch war es bei vielen germanischen Stämmen Sitte, dass Männer, die länger als fünf Jahre außerhalb des Stammesgebiets lebten, ihr Recht auf Stammeszugehörigkeit verloren. Da ohnehin den Heeren viele Frauen folgten und dauerhaft bei ihren Männern blieben, war es nicht schwierig, über die nachfolgenden zwei Generationen - die Niederlage der Teutonen war erst 44 Jahre alt - einen neuen Stamm aufzubauen. Sicher waren die meisten Krieger der Atuatuker ehemalige Eburonen und Angehörige der Nachbarstämme. Doch das war lediglich nur noch eine Verbindungslinie zu den Wohnorten, die den Atuatukern vorschwebten. Sie blieben in der Nähe ihrer früheren Stämme. Die Erfahrungen aus den Feldzügen gegen die Römer wirkten lange im neuen Stamm nach. Das Waffenhandwerk stand im Mittelpunkt der männlichen Bevölkerung. Oft genug musste es, wie Caesar andeutete, auch gegen Angriffe von Nachbarn ausgeübt werden.
In der römischen Provinz hatten die Teutonen ganz andere Siedlungen gesehen, als sie aus ihrer Heimat kannten. Städtische Siedlungen waren ihnen eigentlich fremd. In den belgischen und germanischen Gebieten, in denen Caesar Krieg führte, ragt die befestigte Siedlung der Atuatuker deshalb als besonders erwähnenswert heraus. Abgesehen von Bibrax, Bratuspantium und Villeneuve-Saint-Germain (Soissons) erwähnt der römische Feldherr keine weitere Stadt ähnlicher Befestigungsart. Besonders fällt das in den germanischen Gebieten des Niederrheins auf, in denen Weiler und Einzelgehöfte dominierten. Die feste Stadt der Atuatuker wird von Caesar erobert. Leider nennt er ihren Namen nicht, als sie angegriffen wird. Das erschwert die Ortsbestimmung. Erst später, als er das ehemalige Winterlager des Titurius aufsucht, spricht er davon und nennt es Atuatuka.
Der Stamm der Atuatuker ist eine seit 102 v.Chr., dem Jahr des letzten der Teutonenzüge, bestehende Zweckgemeinschaft. Aus einer aristokratischen Kriegerkaste und ihren Veteranen hatte sich ein Verband entwickelt, der sein Leben in ständiger Bewegung mit einem Leben an einem festen Ort vertauschen wollte. Das ist ihm dank der verwandtschaftlichen Verbindungen mit den Nachbarn und dank seiner Wehrhaftigkeit gelungen. Der dazu erforderliche Grund und Boden und auch ein Teil der früheren Bewohner mussten ihm zugestanden werden. Zu den älteren Bewohnern, wahrscheinlich überwiegend Eburonen und Nervier, gesellten sich die Nachfahren aus dem Teutonenlager und möglicherweise noch einige Rückkehrer.
Wo lebten die Atuatuker?
Die Angaben zum Siedlungsgebiet der Atuatuker sind uns durch Caesar nur spärlich und widersprüchlich übermittelt. Deshalb gibt es darauf sehr unterschiedliche Antworten. Vor allem gehen die Meinungen über ihren Hauptort weit auseinander. Ihn Atuatuka zu nennen, ist nicht sicher, weil Caesar nur sein Lager so nannte, nicht einen Ort.
Was wird Brauchbares übermittelt? Die Atuatuker eilten den Nerviern, die an der Selle den Römern eine Schlacht lieferten, zu Hilfe, wenn auch zu spät. Sie waren deren Nachbarn und kamen aus östlicher Richtung. Als Gebiet kommt nur die Region entlang der Sambre und ein Teil der nach Norden angrenzenden Ebene in Frage. Die Eburonen, Nachbarn der Atuatuker, wohnten laut Caesar zwischen Maas und Rhein. Zitat:
„ Eine Legion, die er erst vor kurzem jenseits des Padus ausgehoben hatte, und fünf Kohorten entsandte er zu den Eburonen, die größtenteils zwischen Maas und Rhein wohnen und von Ambiorix und Catuvolcus beherrscht wurden. “(liber V, 24)
Caesar hatte sich vor seinem Zug gegen die Atuatuker über die bis zum Rhein lebenden Stämme umfassend informiert. Das war nicht schwierig, weil er einen Fernweg zu nutzen gedachte, der von der Kanalküste, von Boulogne-sur-Mer über Bavay, einem Ort der Nervier, den er gerade besetzt hatte, bis zum Rhein führte. Er kannte den Weg schon, als er zur Selle marschierte. Am Flussübergang fand die Schlacht statt. Weiter östlich kreuzte dieser Fernweg die nach Norden fließende Maas. Der viel genutzte Weg war neben den ansässigen auch den Fernhändlern und Kaufleuten, darunter auch römischen, bekannt. Caesar konnte viele Leute befragen und erfahren, dass nach den Nerviern entlang dieses Weges die Atuatuker, dann die Eburonen und schließlich die Ubier am Rhein wohnten.
Zwischen den Eburonen und Nerviern siedelten demnach die Atuatuker. Da dieser Stamm seinen Anspruch auf Grund und Boden schließlich nur im gegenseitigen Einvernehmen mit beiden Nachbarn durchsetzen konnte, wird es sich höchstwahrscheinlich nicht um die ertragreichsten Gebiete gehandelt haben. Als neu entstandener Stamm war er nicht in einen geografischen Raum hineingewachsen wie seine Nachbarn. Obwohl der neue Lebensraum unbedingt über sekundäre Flusseinzugsgebiete verfügt haben wird.
Sein Wohngebiet müsste ein Landstrich gewesen sein, den andere Stämme mehr oder weniger freiwillig abgetreten haben. Dafür kämen nur die beiden Stämme der Nervier und Eburonen infrage. Eine dauerhafte Regelung darüber könnte beinhaltet haben, dass die drei Stämme stets zur gegenseitigen Waffenhilfe bereit waren. Land gegen Kriegsdienst war eine weit verbreitete und anerkannte Verbindlichkeit. Während der römischen Aggression konnte sich dieses Bündnis bewähren. Alteingesessene Stämme bewohnten wie schon öfters gesagt Flusseinzugsgebiete, in die sie hineingewachsen waren. Die Nervier und ihre Klientelstämme, die Atrebaten und Viromanduer, teilten sich das der Schelde mit den an der Leie lebenden Menapiern im Westen. Ihr Lebensschwerpunkt lag direkt an der mittleren und oberen Schelde und den linken Nebenflüssen. Die Eburonen bewohnten das Flusseinzugsgebiet der Maas, zu dem auch das Sekundärgebiet der Sambre gehörte. Beide alten Stämme suchten den Kompromiss für die Atuatuker in einem Landstrich zwischen ihren Gebieten. Dafür bot sich ein Waldgebiet an, das bereits als Grenzregion fungierte. Überliefert ist die Bezeichnung Kohlenwald. Es handelte sich um einen Waldstreifen, der aus den Ardennen herauswuchs und sich zwischen Zenne und Dijle nach Norden bis an die Sümpfe um Mechelen ausdehnte. Im Einzugsgebiet der Sambre, das sich vorwiegend südlich des Flusses erstreckte, bedeckten die Wälder der Ardennen den größten Teil der Berge. Dieses wenig fruchtbare und dünn besiedelte Gebiet wurde nach meiner Auffassung den Atuatukern zugesprochen. Demnach verlief die Wasserscheide Schelde-Maas mitten durch das neu gebildete Stammesland. Die ertragreicheren Landschaften lagen nördlich davon. Dieses Mittelbelgische Hügelland zwischen Schelde und Maas verfügte über fruchtbare Lehmböden. Inselartig siedelten die Bauern auf den Lichtungen der Laubwälder.
Die Atuatuker konnten davon einen Teil nutzen, der zwischen den Flüssen Haine, Zenne und Dijle lag, aber nur deren Oberläufe und Quellbereiche umfasste. Die Besiedlung führte zu Rodungen. Für das Vordringen der Atuatuker in ihr Flusseinzugsgebiet erhielten die Nervier zur „Entschädigung“ das Einflussgebiet der oberen Sambre, den nach Westen schwingenden Bogen bis zur Quelle. Es umfasste im Süden die Landschaft Thirache, nahe der Stadt Nouvion. Von dort schlägt die Sambre einen Bogen im Uhrzeigersinn, nähert sich auf 10km Bavay, einer wichtigen Siedlung der Nervier, und verläuft danach ziemlich genau in nordöstlicher Richtung bis Namur, um dort in die Maas zu münden. Das Flusseinzugsgebiet wird durch wenige kleine Nebenflüsse auf der linken und viele größere auf der rechten Seite charakterisiert. Ich nehme an, dass die südwestliche Grenze zwischen den Nerviern und Atuatukern etwa nahe der Solre lag, einem der rechten Nebenflüsse der Sambre. Diese Landschaft war weniger bewaldet und charakterisiert durch eine dichte Besiedlung und intensive landwirtschaftliche Nutzung um den Ort Avesnes-sur-Helpe, der zu einem Oppidum ausgebaut worden war.
Abb.4
Das Stammesgebiet der Atuatuker in Mittelbelgien
Aus dem Gesagten ergibt sich etwa folgende Gebietsbeschreibung: im Süden reichte das atuatukische Land bis an die Wasserscheide der Seine und grenzte somit an das der Suessionen und Remer, markiert durch die Höhenzüge der Ardennen. Östlich davon, an der Maas, könnten die Treverer und Condruser Nachbarn gewesen sein. Die Grenze zu den Eburonen bildete wahrscheinlich die Wasserscheide zwischen den sekundären Einzugsgebieten der Gete und Dijle. Im Norden gingen die abfallenden Hügel in das flandrische Tiefland über, wo sich weite Sumpflandschaften herausgebildet hatte - eine natürliche Grenzregion zu den Nerviern und Eburonen. Im Westen lebten die Nervier. Südlich der Sambre könnte das Tal der Solre die Grenze zu ihnen gebildet haben; nördlich davon ist die Abgrenzung schwierig. Angenommen wird die Zenne als Grenzfluss und der Kohlenwald als Ödlandzone.
Die Größe und Struktur des Stammeslandes
Verkehrswege und Siedlungen hatten sich schon lange vor der Entstehung des neuen Stammesgebiets der Atuatuker herausgebildet. Die Nachkommen der Teutonen, hin und her geworfen von den Auseinandersetzungen um einen festen und dauerhaften Wohnsitz, richteten sich in den vorgefundenen Siedlungen ein und bauten sicher auch neue hinzu.
Ob die Atuatuker einen Hauptort hatten, ist eine interessante, viel diskutierte und bis heute offen gebliebene Frage. Von französischer Seite werden verschiedene Orte genannt, so eine Festung Dunon in der Region um Namur, auch Huy mit seinen Bergspornen, das Plateau Hastedon oberhalb von Saint-Servais und das Plateau von Champeau, um nur einige zu nennen. Caesar hat keine nachprüfbaren Angaben zu einem Hauptort der Atuatuker gemacht. Es ist nicht einmal klar, ob er mit dem Ort, den er eroberte, den Hauptort meinte. Er sagte: „…, verließen alle Städte und festen Plätze und schafften ihren ganzen Besitz in eine durch ihre Lage hervorragend geschützte Stadt. “(liber II, 29, 3)
Im Laufe der weiteren Darstellung des Krieges erfahren wir, dass im Land der Eburonen ein Winterlager der Römer, kommandiert von den Legaten Quintus Titurius Sabinus und Lucius Aurunculeius Cotta angelegt wurde (liber V, 24, 5-6). Dieses Winterlager nennt Caesar später Atuatuca (liber VI, 32, 4). Verwirrend für alle Leser ist der nachfolgende Satz, dass dieses Lager in der Mitte des Eburonenlandes läge. Nun kann man sich nicht vorstellen, dass Caesar eine Bezeichnung Atuatuka, die wie der Stammesname lautet, wählt, und Eburonen meint. Dieses römische Lager muss tatsächlich dort gelegen haben, wo er die Stadt der Atuatuker angesiedelt hat. Eine weitere Angabe könnte sehr hilfreich sein. Als Caesar die Anordnung dieser Winterlager vornahm, nennt er den weitesten Abstand von Samarobriva (Amiens), wo er sich befand, mit 100 Meilen. Das sind rund 150km. Damit ist auch die äußere Grenze für die Lage des Ortes Atuatukas gezogen. Von Amiens aus lägen dort in Richtung der Atuatuker die heutigen Orte Binche und Thuin. Alle weiter entfernt liegenden kämen demnach für eine Stadt der Atuatuker nicht in Frage. Thuin ist ein Ort, der auch von einigen Historikern favorisiert wird. Ich habe mich für Binche entschieden, das in der Nähe liegt. In den nachfolgenden Abschnitten wird das noch begründet. Die Abb.4 zeigt den Versuch, ein Stammesgebiet für die Atuatuker darzustellen. Über Annahmen kann ich nicht hinausgehen.
Markante strukturelle Linien im Gebiet der Atuatuker sind drei Verkehrsachsen: einmal die Sambre als Wasserstraße und der sie nördlich begleitende Fernweg von Boulogne-sur-Mer über Bavay nach Tongeren und Neuss am Rhein. Zum anderen ein Fernweg, der ihr Stammesgebiet im Süden schneidet, von Avesnes-sur-Helpe durch die Ardennen nach Osten, genauer nach Dinant führt, und zum dritten ein Weg, der im Norden, von Tongeren kommend, über Asse nach Kortrijk führt. Er tangiert das Stammesgebiet unterhalb der Sümpfe um Mechelen. Darüber hinaus gab es sicher einige Querverbindungen von Süden nach Norden, die nur untergeordnete lokale Bedeutung hatten, wie der von Thuin über Binche zur Demer.
Die Sambre begleitet auf dem nördlichen Ufer ein Höhenzug, dessen Kamm zwischen 50 und 120m über dem Wasserspiegel verläuft. Auf dieser Wasserscheide zwischen Maas und Schelde hatte sich der Fernweg von Boulogne über Bavay nach Neuss entwickelt. Wald und Heide bildeten eine Art Ödland, das besonders geeignet war für den Durchzug Fremder. Auf der rechten Uferseite zieht sich das Hochland der Ardennen von der Sambrequelle bis an die Maas hin in einer gleichbleibenden Höhenlinie zwischen 200 und 250m, eingeschnitten durch die Täler der großen Nebenflüsse Helpe, Solre und Thure, die überwiegend von Nordwest nach Südost verlaufen. Der Raum nördlich der Wasserscheide bildet eine Zone mit lehmigen Böden, die überwiegend mit Laubwäldern bedeckt war. Da sich die eiserne Pflugschar schon durchgesetzt hatte, konnten die Siedler auch Land in diesen Wäldern roden und bebauen. Zwischen den Nebenflüssen Zenne und Dijle lagen die Siedlungen, Weiler und Höfe der atuatukischen Bauern.
Der oben erwähnte Fernweg von West nach Ost zieht sich wie ein Rückgrat durch das Stammesgebiet. Die atuatukische Streitmacht, die zu den Nerviern ziehen wollte, müsste diesen Weg benutzt haben, denn er war für sie am geeignetsten. Es war der Weg von Tongeren nach Bavay. Er verlief zur Römerzeit etwa 20km nördlich der Sambre fast parallel zum Fluss. In der Zeit vor den Römern waren die Verhältnisse andere als nach der Eroberung. Es fehlte der übergreifende politisch und staatsrechtlich geschützte Großraum. Die viel kleineren Stämme waren die bestimmenden Elemente. Ein Fernweg sollte deshalb überwiegend über dünn besiedelte Wasserscheiden führen. So konnte er auch im Falle von Konflikten durch Händler und Kaufleute genutzt werden. Die Führung des Fernhandelsweges auf der Wasserscheide nördlich der Sambre blieb auch zur Zeit der Atuatuker sinnvoll. Dieser Höhenzug konnte bewaldet bleiben. Folgt man diesen Überlegungen, dann wäre der vorrömische Weg von Bavay nach Osten über den gleichbleibenden Höhenzug von 150m nahe an Maubeuge herangekommen und hätte sich dann über Grand-Rend, Peissant, Mont-Sainte-Genevieve bis Fontaine-l‘Eveque fortgesetzt. Schmale Laubwaldstreifen markieren noch heute diesen Kamm des Höhenzuges. Von dort verlief der Weg über Le Bons Villeurs, um sich dann bei Gembloux wieder der späteren römischen Trasse anzunähern. Zwischen den Orten Liverchies und Le Bons Villeurs wird der römisch als Geminiacum bezeichnete Ort vermutet. Der Ort Morlanwelz soll später ebenfalls an der römischen Chaussee, „Brunehault genannt“, gelegen haben, so wie der Vorort von Binche, Waudrez (röm.:Vodgoriacum).
Gibt es eine solche markante Wegstrecke auch weiter südlich? Im „Digitalatlas of the Roman Empire“ ist ein Weg von Bavay nach Ciney in den Ardennen angezeigt. Man kann ihn nur anhand des heutigen Straßennetzes über Maubeuge/Hautmont, Beaumont, Dinant/Anseremme bis Ciney nachverfolgen. Wenn es einen solchen Weg bereits in vorrömischer Zeit gegeben hat, dann durchschnitt er das atuatukische Stammesgebiet im Süden und grenzte die Wohngebiete zu den Remern ab. Die östliche Grenze könnte dann die Wasserscheide zur Maas gewesen sein.
Um die Fläche des Stammesgebiets zu ermitteln, kann der Ausgangspunkt nur das Einzugsgebiet der Sambre sein. Von der Quelle bis zur Mündung in die Maas beträgt die Länge des Flusses 193km. Er überwindet ein Gefälle von 199m. Das Bassin misst 2.740 km2. Durch die Teilung mit den Nerviern können von dieser Fläche etwa 2/3 für die Atuatuker angerechnet werden, d.h. etwa 1800km2. Das Gebiet im Norden, Teil des Scheldebassins, kann nur geschätzt werden. Die Dijle, in der Mitte des Gebiets, ist 86km lang. Etwa bis zur Hälfte floss sie durch atuatukisches Gebiet. Für die Breite des Lebensraums nehme ich 45km an. Das ergibt grob eine Fläche von 4.500km2; insgesamt könnte das Stammesgebiet eine Fläche von etwa 6.300km2 umfasst haben.
Die Einwohnerdichte muss in Beziehung gesetzt werden zur Geografie. Im Einzugsgebiet der Sambre bestimmten Hügel und tiefe Täler das Profil. Im Norden davon dehnten sich riesige Wälder auf lehmigen Böden aus. Ohne dies eindeutig begründen zu können, sondern als Querschnittswert aus vielen Texten zur Bevölkerungsdichte der vorrömischen Eisenzeit in Mitteleuropa gehe ich von einer Wirtschaftseinheit in den Abmessungen 3x3km aus, in der sich durchschnittlich 7 Gehöfte befanden. Mit einer Personenzahl von 7 bis 9 ergäben das 49 bis 63 Menschen auf 9km2 oder etwa 4,5 bis 7 Personen pro km2. Der Stamm könnte deshalb eine Größe von 28.000 bis 44.000 Mitgliedern erreicht haben. Nach den gültigen Erfahrungswerten hieße das: etwa 5.600 bis 9.000 Krieger stünden zur Verfügung. Die von den Remern angeblich an Caesar übermittelte Zahl, die 19.000 Krieger für das belgische Bündnis umfasst haben soll, setzte eine Bevölkerung von mindestens 95.000 Menschen voraus, wahrscheinlich noch mehr, denn das Hilfskontingent eines Stammes dürfte wohl nicht alle Waffenfähigen umfasst haben, sondern nur einen kleineren Teil. Diese Bevölkerungszahl von 95.000 übersteigt die Möglichkeiten, die der Lebensraum bietet. Sicher sind die Zahlen anfechtbar, doch findet eine Aussage sehr wahrscheinlich Zustimmung: Die Atuatuker waren nicht in der Lage, den Römern ein Heer entgegenzustellen, dass auch nur geringste Chancen auf einen Sieg gehabt hätte. Caesars Angaben sind völlig übertrieben.
Von den Siedlungen der Atuatuker kennen wir keine mit gesicherter Lage, auch keine mit richtigem Namen. Aus den geografischen Gegebenheiten lassen sich einige mögliche Standorte annehmen, so bei Maubeuge, Thuin, Montigny-le-Tilleul und Namur. Sollten sich an diesen Orten befestigte Siedlungen befunden haben, dann hätten sie sich aufgereiht entlang der Sambre und nicht entlang des Fernwegs. Das erscheint logisch, denn am Fluss war die Verteidigungsfähigkeit größer als in der Ebene. Angesichts der Widerstände, die die Nachfolger des teutonischen Hauptquartiers zu bewältigen hatten bis zu ihrer endgültigen Ansiedlung und Ausbreitung, war der hohe Aufwand zur Befestigung von Orten im Vergleich zur germanischen Umgebung gerechtfertigt. Dennoch muss man auch von festen Siedlungen im flachen Hügelland oder in der Ebene ausgehen.
Der Angriff auf die Atuatuker 57 v.Chr.
Caesars Anlass für einen Feldzug
Ausgangspunkt für den Vorstoß Caesars nach Osten in Richtung des Rheins war die Schlacht an der Selle im Juli 57 v.Chr. Sie stellte den vorläufigen Endpunkt seines Eroberungszuges gegen die belgischen Stämme dar. Er siegte an den Ufern der Selle, die von den Römern Sabis genannt wurde, über das Heer der Nervier, die sich mit den Atrebaten und Viromanduern unter dem Feldherrn Boduognatus zum Kampf gestellt hatten. Dieser Kampf wurde im Teil II dieses Buches ausführlich beschrieben.
Die Nervier und ihre Verbündeten hatten Caesar keinen Anlass gegeben für einen Angriff auf ihr Stammesgebiet. Doch als er im Land der Ambianer stand, die sich ihm
„…mit all ihrem Besitz ohne weiteres ergaben… “ (liber II, 15, 3), erwartete er ein ebensolches Angebot von deren Nachbarn, den Nerviern. Doch die sahen keine Veranlassung, das zu tun. Allein diese Einstellung genügte Caesar als Kriegserklärung. Gerüstet hatten sich die nordbelgischen Stämme bereits, als die südlichen unter Galba ein Heer gegen den anrückenden Caesar aufstellten. Es war also bekannt, was den Römer in den Nordwesten getrieben hatte: reine Eroberungssucht.
Die Nervier hatten nach Caesars Aussage ihren östlichen Nachbarstamm, die Atuatuker, als Verbündete gewonnen. Ob ihnen das überhaupt gelungen war, und wenn ja, ob dann die Atuatuker Wort hielten und ihre Krieger in Richtung der nervischen Streitkräfte schickten, bleibt offen. Sie erreichten nach Caesar das Schlachtfeld nicht pünktlich. Das ist erstaunlich (liber II, 29). Hatte doch die treverische Reitereinheit, die Caesar unterstützen wollte, die Nervier bereits im römischen Lager kämpfen sehen und deshalb das Schlachtfeld mit dem Eindruck verlassen, die Römer seien geschlagen (liber II, 24, 4).
Dieses Geschehen kann nicht kommentarlos übergangen werden. Die Treverer, die einen viel weiteren Weg als die Atuatuker zur römischen Streitmacht hatten, waren pünktlich zur Stelle. Überall verbreiteten sie voreilig den „Sieg“ der Nervier. Ausgerechnet die in der Nähe lebenden Atuatuker marschierten so spät ab, dass nur noch die Nachricht von der Niederlage der Nervier bei ihnen ankam und sie umkehren mussten. Zweifel ob dieses Verhaltens kommen auf. Sie verstärken sich weiter, wenn man liest, dass der Stamm sofort seine Bevölkerung zur Flucht aufrief. Doch lassen wir das Caesar selbst sagen:
„…verließen alle Städte und festen Plätze und schafften ihren ganzen Besitz in eine durch ihre Lage hervorragend geschützte Stadt…“(liber II, 29, 3)
Man kann nicht übersehen, dass die Räume, in denen die Heere operierten, relativ klein waren. Caesar brauchte drei Tage von Amiens bis zur Selle. Es handelt sich um eine Strecke von 97km und sie entspricht mit etwa 32km der Marschleistung römischer Legionen vollauf. Der benutzte Fernweg kreuzte am Schlachtfeld den Fluss. Er führte den Sieger danach schnell weiter zum 27km entfernten Bavay, wo die Verhandlungen mit den Stammesältesten der Nervier stattgefunden haben könnten, wofür ein weiterer Tagesmarsch nötig war. Ohne mich jetzt bereits festlegen zu wollen, welcher Ort im Land der Atuatuker es war, den Caesar angriff, hätte er seine Legionen von Bavay in ein bis drei Tagen nach Binche und bis Namur führen können; also in einer kurzen Zeit. Wie konnte es den Atuatukern möglich gewesen sein, ihre verspäteten Truppen, die vielleicht schon auf der Höhe von Bavay standen, sofort zu wenden? Waren ihnen flüchtende Nervier begegnet? Wie gesagt, sie marschierten noch am Tag der Schlacht oder höchstens einen Tag später zurück. Gleichzeitig soll es ihnen gelungen sein, die gesamte Räumung ihres Stammeslandes in eine feste Siedlung zu veranlassen und durchzuführen? Caesars Darstellung ist ganz und gar unglaubwürdig. Zumal die Atuatuker ja noch gar nicht wussten, dass er überhaupt Legionen gegen sie in Marsch setzen würde.
Die Wirklichkeit könnte so ausgesehen haben, dass Caesar, enttäuscht über die Härte und den Opferreichtum der Schlacht an der Selle, nicht in der Lage war, das Land der Nervier vollständig zu unterwerfen, wie er es mit den südlichen Stämmen der Belger tun konnte.
…Er ließ sie auch im Besitz ihres Landes und ihrer Städte und verbot den Nachbarn und deren Abhängigen, sie zu belästigen oder zu misshandeln. “ (liber II, 28, 3)
Ihm fehlte die Beute für seine eigene Kasse und für die Legionäre. So entstand sein Plan, schnell Richtung Rhein vorzustoßen, wenn auch nur ein Stück, den östlichen Nachbarn der Nervier Angst einzuflößen, ein Exempel zu statuieren und reiche Beute zu machen. Caesar suchte einen Ausweg aus der unrühmlichen Lage und fand ihn in einem Raubzug.
Der Vorstoß und die Wahl des Weges
Es gab nur einen Weg nach Osten, der für eine solch große Armee, wie sie Caesar befehligte, infrage kam: der bereits lange bestehende und viel genutzte Fernweg von Boulogne-sur-Mer nach Neuss am Rhein. Auf der Abb.5 wird die Wegeführung dargestellt.
Ein anderer führte von Bavay über Avesnelles, einem nervischen Oppidum in einer fruchtbaren Landschaft, nach Ciney in den Ardennen, links der Maas. Doch dorthin zog es den Feldherrn nicht, denn er hatte sich für den Vorstoß zum Rhein entschieden. Das belegen alle weiteren Handlungen.
Auf diesem Weg befand er sich bereits, als er an der Selle anlangte und nach der Schlacht weiter zog bis Bavay. Selbst wenn die Verhandlungen mit den Nerviern in Avesnelles stattgefunden haben sollten, wäre er in kurzer Zeit über den Fernweg, der aus Reims kommt, innerhalb eines Tages in Bavay angekommen. Welche Orte der Atuatuker lagen an diesem Fernweg?
Einer davon müsste der sein, den er angegriffen und erobert hatte. An Caesars Seite befanden sich insgesamt 8 Legionen (liber II, 19), d.h. ohne Tross und Hilfskräfte waren das mindestens 40.000 bis 45.000Mann. Mit Hilfskräften noch mehr. Diese Legionen und ihre Hilfsvölker einschließlich der Tiere mussten permanent versorgt werden. In diesem nervischen Gebiet, in dem die Römer standen, waren die Vorräte bereits vom Stammesheer aufgebraucht worden. Mit ausreichendem Nachschub war nicht zu rechnen, auch wenn er die Remer dazu verpflichtete.
Abb.5
Caesar auf dem Fern weg von Boulogne-sur-Mer (Gesoriacum) nach Neuss mit den Schlachtorten an der Selle und vor Atuatuka/ Binche
Unter diesem Gesichtspunkt kann man davon ausgehen, dass Caesar sein Heer nicht beisammen halten konnte. Zu allererst galt es, sich um die Verwundeten nach der Schlacht an der Selle 57 v.Chr. zu kümmern. Dazu bedurfte es großer Legionslager. Zum anderen mussten die geschlagenen Nervier, Atrebaten und Viromanduer gezwungen werden, so bald wie möglich Nahrungsmittel heranzuschaffen. Und schließlich war der Vorstoß nach Osten dazu angetan, einen Teil der Legionen in Bewegung zu setzen zu neuen Gebieten, in denen beschafft werden konnte, was sie benötigten. Da Caesar die starken Nervier besiegt hatte, fürchtete er den viel kleineren Stamm der Atuatuker nicht. Auf die lockende Beute habe ich schon hingewiesen. Sie fand man jedoch nicht in den verstreut liegenden Gehöften und Weilern, sondern dafür wären Siedlungen oder befestigte Plätze vorzuziehen.
Wie zuvor bereits erwähnt, gab es östlich von Bavay zwei Plätze, auf denen feste Siedlungen gestanden haben könnten. Durch die 100-Meilen-Grenze, die er in seiner Aussage über die Winterlager von Amiens aus zog, kämen dafür nur Binche und Thuin infrage. Thuin wird von französischen und belgischen Historikern des Öfteren genannt, Binche nicht. Ich werde nachfolgend versuchen, diese beiden Orte unter dem Gesichtspunkt der von Caesar überlieferten Angaben zu bewerten und zu vergleichen.
Die Atuatuker hatten kurz nach den Verhandlungen zwischen den Römern und Nerviern erfahren, dass Caesar mit einigen Legionen in ihr Gebiet eindringen werde. Da er schon in ein bis zwei Tagen anrücken konnte, war Eile geboten. Wie in solchen Situationen üblich, flohen die entlang des Fernwegs lebenden Bauern mit ihrem Hab und Gut in die umliegenden Wälder und Schluchten, um sich zu verstecken. Der Fluchtkorridor musste mindestens 15 bis 20km breit sein, um nicht der Reiterei in die Hände zu fallen. Ein Teil der wehrfähigen Männer bildete größere Haufen, die sich längere Zeit verteidigen konnten. Von den unter Waffen stehenden Kriegern wurde ein Teil in den befestigten Platz hineingeführt. Die nahe wohnenden Bauern zog es ebenfalls dorthin. Schließlich musste der befestigte Ort ertüchtigt werden für eine Belagerung. Das war unter dem Zeitdruck äußerst schwierig.
Sehen wir uns in Abb.6 an, wo sich die möglichen festen Plätze befunden haben können. Hauptgrund für die Wahl dieses geografischen Raumes ist die Entfernungsangabe Caesars mit etwa 150km von Amiens. Sehr unterschiedliche Bedingungen beeinflussten die Lage der Orte. Thuin liegt an der Sambre in einer für die Höhensiedlungen angemessenen Topografie. Binche liegt abseits, nördlich des Flusses, in der Nähe des Fernwegs. Nur etwa 12km entfernt. Der Fernweg, der heute als „Chaussée Brunehault“ bekannt ist, wurde erst in römischer Zeit als schnurgerade Reichsstraße angelegt. Zur Zeit der römischen Invasion führte er wahrscheinlich südlich von Binche über die Höhenrücken nördlich der Sambre. Sie bildeten zugleich die Wasserscheide zwischen den Flusseinzugsgebieten der Maas/Sambre und Schelde. Binche gehört geografisch bereits in das Einflussgebiet der Schelde, speziell der Haine, und damit zum nördlichen Stammesgebiet. Vom alten Fernweg aus waren Thuin und Binche etwa gleich weit entfernt. Warum entschied ich mich, Binche als Atuatuka anzunehmen? Diese Frage möchte ich mit der Lagebeschreibung und Charakteristik von Thuin beantworten.
Abb.6
Die Lage der beiden Orte Binche und Thuin und der Angriff auf Atuatuka/Binche. Wege sind angenommene.
Die Höhenburg von Thuin
Thuin liegt heute auf einem Hügel, der im Norden von der Sambre und im Süden von der Biesmelle begrenzt wird. Die Höhe des Plateaus über der Flussniederung beträgt ca. 50m. Die Höhenlinien im Tal liegen bei 120m über NN und steigen bis auf 170 und 180m über NN an. Die Hänge des Plateaus sind steil. Während die Geografie einen Platz für eine Höhenburg auf dem auslaufenden Sporn des Plateaus zwischen der Sambre und der Mündung der Biesmelle anbietet, gut geschützt durch die natürlichen Gewässer, haben belgische Forscher den tatsächlichen Platz auf einem südlichen Teil des Plateaus gefunden. Die archäologische Stätte wird der „Bois du Grand Bon Dieu“ genannt. Sie ist 13ha groß und wird im Westen, Süden und Südosten, auf drei Seiten von der Biesmelle eingefasst. Im Norden bildet ein Graben, der aus dem Étang du Houillon entspringt, die Trennung zum übrigen Plateau. Nur im Osten verbleibt ein niveaugleicher Übergang, der zur Zeit des Oppidums durch eine Mauer geschützt wurde. Davon zeugt noch heute ein 3m hoher Wall von 40m Länge. Somit besaß dieser Platz eine natürliche Verteidigung. Der Felsen trägt heute einen Wald aus Eichen, Stechpalmen und Mispeln.
Zwischen den Forschern in Belgien gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob sich dieser archäologische Platz in die Reihe der Oppida einordnen lässt und dieses vielleicht sogar das von Caesar erstürmte sein könnte. Bis heute wurden aber keine Bebauungsreste gefunden, auch keine Hinweise auf eine kriegerische Auseinandersetzung. Die Forscher des Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine der ULB schließen sich dieser Meinung, Thuin sei Atuatuka, nicht an.
Berühmt geworden ist ein bedeutender Münzfund aus Goldstateren, der aus der Zeit von 90 v.Chr. bis 50 v.Chr. stammt. Sie werden den Nerviern zugeschrieben. Darüber hinaus förderten die Ausgrabungen ein zeremonielles Schwert, einen besonders schönen Metallgürtel aus einer Kupferlegierung mit eingelegter roter Email, Tongefäße u.a. zu Tage. So führen diese eher kultischen Artikel die Gedanken mehr auf eine Kultstätte, denn auf eine Siedlung (nach Christian Du Brulle). Der Hügel war bereits seit der Jungsteinzeit bewohnt, aber eben auch (oder wieder) im 1.Jh. v.Chr.
Es liegt somit nahe, dass hier, unter oder neben dem heutigen Thuin ein nicht unbedeutender Ort der Atuatuker lag. Betrachtet man die nähere Umgebung, dann erkennt man, dass Thuin etwa in der Mitte zwischen den Fernwegen Bavay-Tongeren und Avesnes-Dinant liegt. Eine Nord-Süd-Verbindung von Binche über Thuin nach Stree, einem Dorf weiter südlich (eine Annahme), könnte westlich des „Bois du Grand Bon Dieu“ die Sambre gekreuzt haben. Das würde die Bedeutung des Ortes heben. Da es aber unwahrscheinlich gewesen sein dürfte, dass Caesar von Bavay aus in Richtung Dinant ziehen wollte (diesen Ort oder einen Vorläufer kannte er noch gar nicht), sondern den Fernweg nach Tongeren nahm, lag Thuin nicht an seiner Marschroute. Dieser von den beiden West-Ost-Wegen etwas abgelegene Ort hatte aber für den südlichen Gau der Atuatuker eine günstige Lage. Und geheimnisvoll abgeschieden war er auch. Für einen Versammlungs- und Kultplatz unter einem Eichenrund und mit einer Quelle, Étang du Houillon, in der Nähe, war er fast ideal dafür geeignet.
Abb.7
Die Lage des Oppidums oder Kultplatzes Thuin
Noch etwas spricht gegen Thuin als Oppidum. Auch wenn auf dem erwähnten Sporn zwischen Sambre und Biesnelle möglicherweise eine Siedlung, ein Weiler oder, was wahrscheinlicher sein könnte, ein Herrenhof gestanden hätte, wären das keine Voraussetzungen für eine Stadt wie sie Caesar beschrieben hat. Die belagerte Stadt hätte vielen Menschen Lebensraum und Nahrung bieten müssen. In Abb.7 ist die geografische Situation des Siedlungsplatzes Thuin zu erkennen. Was sagt Caesars Geometrie dazu?
Die Umfassungsmauer war 15.000 römische Fuß lang. Das römische Grundmaß Fuß (pes) beträgt 29,6352 cm. Die Mauer war demzufolge 4.445,28m lang.
Hätte es eine Siedlung auf dem Sporn gegeben, müsste man fragen: warum sollte um einen solchen hohen Felsen eine Mauer gebaut werden, wenn doch unmittelbar an seinem Fuß bereits das Wasser der Sambre und der Biesnelle fließt? Auch eine römische Umwehrung des „Bois du Grand Bon Dieu“ würde die gleiche Fragestellung bewirken. Die Biesnelle ist ein kräftig sprudelnder Gebirgsfluss und stellte bereits ein erhebliches Hindernis für Soldaten dar. Welchen Sinn sollte hier noch eine Umwallung haben? Nach meiner Skizzierung einer römischen Mauer kommt eine Gesamtlänge von etwa 2,7km zusammen. Erhebliche Steigungen an Hängen wären zu bewältigen. Wie lange deren Bau wohl gedauert hätte? Caesar spricht von 4,44km Länge. Und von schneller Bauzeit. Das passt alles nicht zusammen.
Unter diesen Bedingungen fällt es schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Für den Fortgang der Geschichte dieses Teiles des „Gallischen Krieges“ möchte ich mich von Thuin als den belagerten Ort der Atuatuker verabschieden. Für den weiteren Verlauf des Krieges ist es unerheblich, ob Thuin eine Fluchtburg, eine Kultstätte oder ein Thingplatz war. Viel interessanter wäre ein Ort an dem Fernweg von Bavay nach Tongeren. Es kann dennoch nur eine Annahme sein, wenn ich den Ort Binche Thuin vorziehe.
Die feste Siedlung Binche
Binche ist eine belgische Stadt im Hennegau. Sie wurde im 12.Jh. von den Grafen von Hennegau gegründet und als Grenzsiedlung gegen Frankreich befestigt. Noch heute beeindrucken die gewaltigen Mauern, die an vielen Teilen der Altstadt zu sehen sind. Sie liegt in der Mitte der West-Ost-Achse Mons-Charleroi und zwischen den Flüssen Haine und Sambre. Südlich des Ortes verläuft die Wasserscheide zwischen den Flussgebieten der Schelde und der Sambre (Maas). Der nordwestliche Vorort Woudrez wurde von den Archäologen mit dem antiken Vodgoriacum gleichgesetzt, einer Station an der Römerstraße von Bavay nach Köln. Noch heute führt dieser ehemalige Fernweg als „Chaussée Brunehault“ unmittelbar am Ort vorbei, Richtung Nordosten. Wenn ich den Ort Binche auswähle als das von Caesar erwähnte Atuatuka, dann deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass die Hennegauer Grafen ihre Stadt nicht im freien Feld gegründet haben, sonder auf eine bereits bekannte Siedlung aufbauten; zumal sie verkehrsgünstig lag.
Abb. 8
Mittelalterliche Stadtmauer von Binche
Caesar sagt: „Der Ort hatte ringsum sehr hohe Felswände und gutes Blickfeld nach unten; auf einer Seite blieb ein leicht ansteigender Zugang in einer Breite von höchstens zweihundert Fuß: diese Stelle hatten sie mit einer Doppelmauer befestigt, dazu…“(liber II29,3)
Dieser Satz mag manchen Kenner der Materie sofort in Erinnerung kommen, wenn er den Namen Binche hört. Die Stadt liegt am Fuße des etwa 200m hohen Höhenrückens, der nördlich der Sambre verläuft, wie schon gesagt, als Wasserscheide, und sie im Süden und Osten umfasst, während nach Westen und Norden das Gelände leicht abfällt zur Haine, wohin auch die Nebenflüsse und Bäche fließen. Wie soll sich hier Caesars Aussage von den sehr hohen Felswänden bestätigen lassen?
Wäre es nicht denkbar, dass diese Formulierung vielleicht gar nicht dem Urtext entspricht? Man kann von Felsen sprechen und von Wänden aus Naturstein. Man kann auch beides zusammenfügen. Sieht man sich die Stadtmauern von Binche an, was jährlich viele Menschen tun, weil sie die beeindruckendsten in Belgien sind, dann kann man heute noch sehr gut erkennen, dass die hohen Mauern auf Fels stehen. Siehe Abb. 8.
Caesar spricht weiter von einer hohen Doppelmauer am Zugang. Das zeigt, dass die Bewohner dieser Siedlung die Stadt bereits mit festen Wänden umgeben konnten. Da er diese Menschen als Nachkommen der Kimbern und Teutonen bezeichnet, kann die Kunst, eine gute und hohe Stadtmauer zu errichten, von den in der Provinz Gallia Transalpina umherziehenden Kriegern der Teutonen den Römern und Griechen abgeschaut worden sein. In seinem Buch erscheint im germanischen Norden niemals wieder eine solche befestigte Stadt. Die der Atuatuker ist die einzige, die er benennt und stürmt.
Der Angriff Caesars auf Atuatuka
Der von Caesar beschriebene Angriff 57 v.Chr. auf eine wichtige Stadt der Atuatuker wird in meiner Darstellung zu einem auf die Vorläufersiedlung von Binche. In der Abb.9 ist die Erstürmung der Stadt nachempfunden worden. Eine Folge dieser Entscheidung Caesars ist die Einrichtung eines Winterlagers für eine Legion und weitere fünf Kohorten unter den Legaten Quintus Titurius Sabinus und Lucius Aurunculeius Cotta, die im Jahr 54 v.Chr. auf dem Grundriss des Lagers erfolgen sollte, das Caesar vor Atuatuka angelegt hatte.
Bereits nach zwei Tagesmärschen hätten die Römer den heutigen Ort Binche von Bavay aus erreichen können. Caesar wäre auf eine gut befestigte Stadt gestoßen, die auf einer felsigen Erhebung stand. Es war kein hoher Berg, sondern eher ein Plateau. Auf diesem felsigen Untergrund hatten die Atuatuker ihre Siedlung gebaut.
Man kann das ursprüngliche Plateau noch gut an der Faubourg Saint-Paul und der Faubourg du Posty erkennen. Da die heutige Anlage erst im 12.Jh. erbaut wurde, ist davon auszugehen, dass eine atuatukische Anlage etwas anders ausgesehen haben wird. Der Felsen war besser zu erkennen und die Befestigung oben aufgesetzt. Später, im Mittelalter, wurde sie z.T. auch davor errichtet. Der Grundriss des Ortes wird kleiner gewesen sein. Der Befestigungsring der Römer von etwa 4.400 m Länge gibt eine gewisse Grundfläche des Ortes vor, wenn man den Abstand für Wurfgeschosse einberechnet. Angenommen, der vorrömische Ort hätte etwa die Abmessungen des späteren Ortes innerhalb der noch sichtbaren Stadtmauern eingenommen, dann hätte er eine Länge von 1.200m und eine Breite von 400 - 600m gehabt.
Grob ergäbe das einen Umfang von 3.400m. Die römische Umfassungsmauer hätte demnach einen Abstand von etwas über 100m von der Stadtmauer gehabt. Somit gehen die Überlieferungen mit den hier angegebenen Maßen konform. Binche hatte auch nur einen Zugang. Und der lag im Norden. Vielleicht dort, wo die Rue de Bruxelles in die Avenue Charles Deliege übergeht. Vor dem Tor befand sich das Tal eines Flüsschens, heute La Princesse genannt. Zum Stadttor hatte es demzufolge einen leichten Anstieg des Weges gegeben. Tore durch Doppelmauern zu schützen, war in jener Zeit bereits eine weit verbreitete Verteidigungstechnik. Im Vergleich mit Caesars Aussagen ließe damit nur die Bezeichnung „Der Ort hatte rundum sehr hohe Felswände und ein gutes Blickfeld nach unten;…. “(liber II,29) einige Zweifel aufkommen. Der Höhenunterschied zwischen den Umgehungsstraßen an der Stadtmauer und dem Burgplateau beträgt zwischen 12 und 15m. Früher, als hier keine Straßen verliefen, lag das Terrain garantiert wesentlich tiefer. Diese Felsenwand kann durchaus als hoch bezeichnet werden, wenn erst darauf die Wälle, Palisaden oder Mauern standen. Doch warum ließ Caesar den Ort durch eine Umfassungsmauer einschließen? Hätte Binche wirklich auf einem hohen Felsen gestanden, wäre ein Mauerbau sinnlos gewesen. Sie erfüllte erst einen Zweck, wenn sich die Belagerten ohne besondere Probleme an den Mauern herunterlassen oder durch Schlupftüren Ausfälle organisieren könnten.
Der felsige Untergrund der Stadt hatte auch bei niedriger Höhe den Vorteil, dass die Römer mit ihrer Belagerungstechnik wie Rammböcken nichts anfangen konnten; weshalb sie sich auf das Tor konzentrierten, denn dort gab es keine Felsen, sondern die Stadtmauer. Insgesamt ergibt sich also doch eine weitgehende Übereinstimmung zwischen Caesars Texten und der angenommenen Realität.
Binche erwartete die Römer. Als die römische Vorhut die Hügel von Paissant und Fauroeulx überschritt, konnte dies von Binche aus gesehen werden. Ringsum auf den Hügeln stiegen die Rauchzeichen hoch. Dies war das bekannte Zeichen, das Feld oder den Hof zu verlassen und zum Schwert zu greifen. Im nahem Umland lebende Bauern eilten in die Stadt, während sich die Familien von den weiter entfernt stehenden Gehöften und Weilern in ihre vorbereiteten Verstecke in den Schluchten der Wälder begaben. Nur wer unmittelbar im Weichbild der Siedlung lebte, raffte seine bewegliche Habe zusammen und eilte auf das Tor zu. Ich bezweifle, dass die Atuatuker ein Aufgebot an Kriegern zur Unterstützung der Nervier gebildet hatten. Wenn es so gewesen wäre, hätte es sich auch pünktlich zum Schlachtfeld begeben. Tatsächlich wird der Stamm nur vorausschauend ein Aufgebot zum Schutz seiner eigenen Bevölkerung zusammengerufen haben. Dieser Haufen wäre dann vielleicht in Binche, der Siedlung am Anmarschweg der Römer, zu finden gewesen.
Es war nicht damit zu rechnen, dass es gelingen würde, wenige Tage nach der Schlacht an der Selle und mitten in der Erntezeit ein großes Aufgebot an Kriegern aus den entfernteren Stammesgebieten zusammenzurufen. Das ließ die Zeit nicht zu, denn die Römer rückten schneller an als gedacht. Die Anführer in Binche erfuhren das und vertrauten auf ihre Stadt und ihre Kräfte. Sie glaubten auch nicht daran, dass die Römer nach dem Kampf mit den Nerviern bereits wieder mit einer gewaltigen Streitmacht heranziehen würden. Schließlich waren sie keine Belger, sondern Germanen und mit den Eburonen verbündet. Ob der Römer sich auch mit dem germanischen Volk in einen Krieg einließe, war fraglich. Eher glaubte oder besser hoffte man auf eine kleine römische Streitmacht, die sich auf eine Erkundungstour begeben würde.
Aber es kam anders. Die Stadt, vor der Caesar erschien, hatte er sich als Beute auserkoren. Von diesem Schicksal ahnten die Bewohner noch nichts. Sie waren die Kriege mit ihren Nachbarn gewöhnt, aber nicht mit den Römern, den unerbittlichsten Gegnern.
Kommentieren wir, was Caesar dazu schrieb:
Die Stadt, die er angriff, kann nicht die „gesamten Streitkräfte“ aufgenommen haben (liber II, 29), denn das waren nach den Angaben Caesars bzw. der remischen Adligen 19.000 Mann, auch für die Römer eine ernst zu nehmende Armee. Dieses Heer hätte sich in jedem Falle in einer Feldschlacht gestellt und nicht zurückgezogen in eine eisenzeitliche Siedlung. In der Stadt lag eine Mannschaft zu ihrer Verteidigung, die vielleicht 1.000 bis 1.500 Mann stark war. Mehr konnte der Stamm in dieser Zeit und Gegend nicht aufbieten und mehr konnte auch der Raum nicht fassen. In der Stadt, die höchstens 2.000 bis 3.000 Bewohner beherbergen konnte, mussten dazu noch Flüchtlinge aus der nahen Umgebung aufgenommen werden. Alle wehrfähigen männlichen Bewohner hatten sich auf einen Kampfeinsatz einzustellen. Der Rat der Siedlung verfügte über einige gefüllte Speicher und Brunnen. Mit Entsatz konnte nicht gerechnet werden. Denn mit dem Einmarsch der Römer müssten sich im übrigen Stammesgebiet, besonders an den befestigten Plätzen wie Thuin, Namur u.a. einige Tausend Männer zu deren Verteidigung eingefunden haben. Ein Rest von Kriegern verteilte sich im Lande und bildete kleinere Einheiten, die Jagd auf römische Futter- und Holzsammler machen sollten.
Caesar war vielleicht mit zwei Legionen, die ihm besonders nahe standen wie die X. und einigen Hilfskräften - ca. 15.000 Mann - von den Nerviern fortgezogen, um die Atuatuker in ihrer befestigten Siedlung anzugreifen. Da er die Stärken der Gegner genau erfasste und prüfte, bevor er angriff, wusste er, dass zwei Legionen völlig ausreichten. Seine Vorstellungen von diesem Kriegszug sind bereits dargestellt worden. Es kommt jedoch noch eine andere hinzu. Nach der Schlacht an der Selle musste er den gewaltigen Widerstand der Nervier, Atrebaten und Viromanduer anerkennen und ließ als Folge diese Stämme weitgehend in Ruhe, d.h. in ihrem Eigentum und in ihren Rechten, obwohl er sie als unterworfen ansehen konnte dank der Friedensangebote. Seine Legionäre gingen dadurch leer aus. Sie konnten keine Beute machen. Dafür galt es einen Ersatz zu schaffen. Für Caesar stand deshalb von Anfang an fest, dass der Vorstoß in das Land der Atuatuker vorrangig dieses Ziel beinhaltete. Insofern hatten die Bewohner und Krieger der belagerten Stadt gar keine Chance, heil aus dieser Situation herauszukommen. Aber noch wehten die Feldzeichen auf den Mauern der Stadt. Sie waren geschmückt mit dem Stammeszeichen, den schwarzen Früchten des Attichs. Im Gegensatz zu den roten der Eibe, die die Eburonen verwendeten. Vom Attich hatten die Atuatuker ihre Stammesbezeichnung abgeleitet. Attich, der Zwergholunder, heißt germanisch Attuh, attah, Aduk, aduhhaz, und Zug tuga. Dieses Wort verweist auf die Züge ihrer Vorfahren.
Abb. 9
Die Belagerung von Atuatuka/Binche 57 v.Chr.
Wie die Belagerung abgelaufen ist, schildert uns Caesar ausführlich in liber II, 29-33. Doch kann man ihm glauben, nachdem schon einige wesentliche Ungenauigkeiten entdeckt werden konnten? Die belagerte Stadt war rundum auf „sehr hohen“ Felswänden errichtet worden. Sie hatte nur einen Zugang. Dieser war etwa 60m breit und stieg vom Umland zum Tor hin leicht an. Das Tor und sicher noch ein zweites befanden sich in einer Doppelmauer. Sie schützte die einzige Stelle der Siedlung, von der aus sie angegriffen werden konnte. Als die Römer heranrückten bis vor die Stadt, veranlasste deren Kommandant (den Namen verschweigt Caesar ebenso wie den des Stammesführers) seine Krieger, den Versuch der Römer, ein Lager zu bauen, durch Ausfälle zu stören. Für diese Ausfälle kam nur das einzige Stadttor in Frage und der abschüssige Zugang beschleunigte das Vordringen der atuatukischen Krieger. Die Gefechte werden von Caesar als klein bezeichnet. Es waren nur wenige Krieger daran beteiligt. Durch ein gewiss kleines Tor konnten eben nur wenige Krieger hinausströmen, damit ihnen der Rückzug ohne Stau gelang. Unbeeindruckt davon legten die Römer ihr Lager an. Sie errichteten es vermutlich auf dem Höhenrücken, der sich nördlich der Siedlung erhebt. Er bildet ein großes Plateau, etwa 100m über NN. Das Tal des Flusses liegt etwa 30m tiefer. Diese Geländeunterschiede stellten keine Hindernisse dar.
Die Stadt zu stürmen, so erkannten Caesar das unschwer anhand der Gegebenheiten, konnte nur über das einzige vorhandene Tor erfolgen. Die Felswände unter den Mauern ließen das nicht zu.
Der römische Kriegsrat entschied, eine Umfassungsmauer mit vielen Stützpunkten zu bauen. Sie maß immerhin 4.400 m Länge und musste sich, um einen militärischen Zweck zu erfüllen, um den ganzen, wenn auch niedrigen Felsen, der die Stadt trug, hinziehen. So sollten die Belagerten von jeglicher Verbindung zur Außenwelt abgeschnitten werden. Das demoralisierte gewiss. Römische Wachposten unterhalb der Wände konnten leicht jeden Kontakt zwischen oben und unten, z.B. das Hinaufbewegen von Nahrung oder Waffen, verhindern. Der Abstand zwischen den Mauern der Verteidiger und Angreifer war so groß, dass keine Wurfgeschosse von Hand ihn überbrücken konnten, nur die Geschütze der Römer.
Die Legionäre wurden beim Bau der Mauer immer wieder gestört durch ausbrechende atuatukische Krieger. Doch denen gelang dies immer nur in der Nähe des Tores. Zum größten Teil verwendeten die Legionäre für ihre Belagerungsmauer Erdreich, das sie ausgruben und zu Wällen aufwarfen, verstärkt mit Gestein. Oben auf setzten sie Palisaden und hölzerne Türme für die Schützen. Dies alles geschah unter den aufmerksamen Augen der Eingeschlossenen. Sie mussten dem Treiben der Legionäre weitgehend tatenlos zusehen und die schnelle und reibungslose Ausführung bewundern.
Nachdem die Stadt keinen freien Zugang mehr hatte, fingen die Römer an, ihre Sturmtechnik für das Erbrechen des Tores aufzubauen. Sie bestand aus Schutzdächern, unter denen, langsam vorwärts bewegend, ein breiterer Damm zum Tor hin aufgebaut werden konnte. Des Weiteren errichteten die Zimmerleute einen hohen Holzturm unterhalb der Rampe. Die Belagerten hätten so etwas noch nicht gesehen, behauptet Caesar und deshalb darüber gespottet, wie denn die kleinen Römer solche riesigen Türme bewegen mochten. Diese Äußerung kann man getrost übersehen, denn gerade Menschen, die in befestigten Siedlungen lebten, waren auch mit der Technik von Belagerungstürmen vertraut, wenigstens die Veteranen, die in der römischen Provinz gekämpft hatten. Denn auch die Nachbarn, die Suessionen wussten zu belagern, wie sie es mit Bibracte versuchten; auch das Beispiel Soissons, das die Römer belagerten, hatte Schule gemacht. Es wurmte Caesar offensichtlich schon länger, dass die Germanen und Kelten über die kleinwüchsigen Römer herzogen. Solche Art von Spott nehmen besonders kleinwüchsige Feldherren sehr übel und rächen sich bei jeder Gelegenheit dafür. Wie nicht anders zu erwarten, schoben die Römer, nachdem sie die günstigste Neigung des Dammes geschaffen hatten, den Belagerungsturm langsam zum Tor vor. Ebenso führten die Legionäre den Rammbock unter dem Schutzdach näher an das Tor heran.
Die meisten Belagerten in der Stadt konnten die Arbeiten der Römer vor dem Tor gar nicht verfolgen. Dazu musste man auf der Mauer stehen. Umso aufmerksamer taten das der Anführer der verteidigenden Kriegerschar und die Räte der Einwohnerschaft. Da die Stadt auf sich allein gestellt blieb, wagten die Anführer angesichts der überlegenen Technik nicht mehr, die Waffen zur Verteidigung zu erheben. Nach den in Kriegen üblichen Regeln entschieden sie sich, den Römern ein Friedensangebot zu unterbreiten, um die Stadt und ihre Bewohner zu retten. Man setzte sich im Rat zusammen und wählte eine Gesandtschaft aus angesehenen Männern. Der römische Feldherr nahm den Vorschlag, den Konflikt friedlich beizulegen, scheinbar an. Die Gesandtschaft durfte vorgelassen werden. Ihr Sprecher unterbreitete Caesar ein Friedensangebot. Es beinhaltete die damals übliche Form der Unterwerfung, indem sie sich und ihre Habe der römischen Gewalt übergaben. Allerdings baten sie darum, dass ihre Krieger bewaffnet blieben, um sich nach dem Abzug der Römer gegen andere Feinde wehren zu können. Das war eine in germanischen Stämmen gewünschte übliche Ausnahme, weil ein Germane ohne Waffen, also wehrlos, kein vollwertiger Mann mehr war. Caesar reagierte wie schon in früheren Situationen mit einem klaren Nein darauf. Sein Argument war, dass ein römischer Untertan, und das seien sie ja von nun an, keine Feinde zu fürchten habe. Er, Caesar, würde allen Nachbarn verbieten, römischen Untertanen ein Unrecht zuzufügen.
Von einem freien Abzug der Bewohner, die aus der Umgebung stammten, und von der der Krieger, war nicht die Rede. Die Gesandten ahnten, dass ihnen und der Stadt ein schlimmes Schicksal bevorstünde. Dennoch warfen die Männer Waffen über die Mauer in den Graben am Tor, der sich füllte „bis zur Höhe von Mauer und Damm“. Danach öffneten die Räte die beiden Stadttore und ließen die Römer ein. Deren Augen richteten sich zuallererst auf die mögliche Beute, die hier zu holen war. Das blieb den Menschen nicht verborgen. Ihre Sorgen wuchsen. Auch deshalb, weil niemand die Stadt verlassen durfte. Am Abend wurden die Legionäre aus der Stadt gerufen und die Tore wurden geschlossen, angeblich, um die Bewohner vor Übergriffen zu schützen. Tatsächlich wollte Caesar die Flucht von Menschen verhindern. Was hatten wohl die Legionäre den ganzen Tag über in der Stadt gemacht? Waren sie spazieren gegangen? Hatten sie mit deren Bewohnern geplaudert? Ich denke, sie orientierten sich über die Lage und den Umfang der zu erwartenden Beute.
Die kommende Nacht konnte kein Bewohner, kein Flüchtling, kein Krieger schlafen. Alle ahnten, dass der römische Feldherr etwas im Schilde führte, was nicht gut für sie sein würde. Die Stadttore geschlossen zu halten, obwohl sie sich unterworfen hatten, kam ihnen vor, als wären sie wie Gefangene eingesperrt worden. Am quälendsten entwickelte sich der Gedanke, tatsächlich in Gefangenschaft geraten zu können. Caesar hatte im Gespräch mit den Gesandten zu verstehen gegeben, dass er die Atuatuker als Nachfolger der Teutonen immer noch als Feinde Roms betrachte. Das bedeutete, dass alles, was die Atuatuker besaßen, rechtmäßig Rom gehörte. Verzweiflung breitete sich aus. Die Krieger rebellierten. Bewohner wollten schnellstens die Stadt verlassen. All diese Ängste mündeten in dem Entschluss, doch einen Ausbruch zu versuchen. Nur wenige Waffen lagerten noch in der Stadt. Man behalf sich und baute neue zusammen aus allen möglichen Materialien. Als der Morgen graute, wurde das Tor geöffnet und eine Schar Bewaffneter drang nach draußen. Wie überrascht waren die Männer, als sie sich nicht etwa einigen müden Wachposten gegenüber sahen, sondern aufspringenden Legionären, die bereits durch Feuerstöße alarmiert worden waren. Die Römer hatten schon mit diesem Ausbruchsversuch aufgrund der sehr harten, von Caesar diktierten Bedingungen gerechnet. Gerät ein Mensch in eine ausweglose Situation, macht sich Verzweiflung breit und führt zu unüberlegten spontanen Handlungen. So hatte der römische Feldherr es vorausgesehen und nun seinen Grund gefunden, die Stadt und ihre Menschen trotz ihrer gestrigen Unterwerfung mit Feuer und Schwert zu überziehen.
Damit bestätigte sich der Verdacht der Belagerten, sie seien absichtlich eingesperrt worden. Es half alles nichts, jeder atuatukische Mann kämpfte in diesem Augenblick verzweifelt um sein und seiner Angehörigen Leben. Vor allem die Krieger wollten die Umfassungsmauer der Römer überwinden, doch sie wurden von einer Unzahl von Wurfspeeren, Pfeilen und Schleudersteinen empfangen. Alles drängte sich zwischen dem Tor und der Belagerungsmauer, in diesem kleinen Raum zusammen. Niemanden gelang es durchzubrechen. Als bereits 400 Männer (ein Zehntel nach Caesars Angaben) dahingestreckt auf dem Boden lagen, musste der Rest in die Stadt zurück flüchten. Die Wachen schlossen schnell die Tore. Im Inneren verbreitete sich Panik. Manche Bewohner sprangen von den Mauern in die Tiefe, andere konnten sich abseilen, davon nur wenige entweichen, da römische Wachen von der Belagerungsmauer aus Jagd auf sie machten.
Als der Tag dann voranschritt, ließ Caesar, zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, den Rammbock sprechen und die Tore aufsprengen. Die wenigen Krieger hatten nur geringe Kraft, sich zu verteidigen. Das von Caesar erdachte Schicksal nahm seinen Lauf. Seine Legionäre durften erneut in die Stadt eindringen und ungehindert Beute machen. Dann trieb man die Bewohner, Flüchtlinge und Krieger zusammen und vor die Stadttore. Dort wurden sie auf die Legionäre aufgeteilt und anschließend von den bereits wartenden Aufkäufern abgenommen. 53.000 gefangene Menschen nennt uns Caesar. So viele konnten damals in keiner eisenzeitlichen Siedlung untergebracht werden. Ich wähle wieder das Zehntel. 5.300 Personen sind für eine eisenzeitliche Siedlung in diesen linksrheinischen Gebieten schon eine bemerkenswert hohe Kopfzahl. Dies wird der Wahrheit vielleicht nahe kommen, obwohl die Siedlung mit so vielen Personen völlig überfüllt gewesen sein müsste. Nach diesem „Sieg“ über die Atuatuker sonnte sich Caesar nachträglich im Glanze seines Onkels Marius. Er hatte die Teutonen an ihrer Quelle vernichtet. Nun traten auch sie den Weg ihrer Vorfahren in die sizilianischen Güter der Senatoren an, wieder als Sklaven. Soweit der persönliche Kommentar zu diesem Ereignis, dem Auftakt zu den Germanenkriegen.
Aus militärischer Sicht war diese Belagerung ein völlig unnützer und unbedeutender Schritt. Sie diente lediglich der Befriedigung der beutehungrigen Offiziere und Soldaten. Unter den Römern dürfte es wenig Verluste gegeben haben. Die Unterwerfung dieser einen Stadt und ihres engeren Umlandes hatte mehr symbolischen Charakter. Der größte Teil des atuatukischen Stammesgebiets war noch frei, nur das Gebiet, durch das Caesar zog, war auf der Breite einer Reiterstunde beidseitig der Marschroute verwüstet worden.
Caesar betrachtete die Eroberung der atuatukischen Stadt als einen gewaltigen Sieg, der sich angeblich bis über den Rhein herumsprach und die dort lebenden Germanen veranlasste, sich bereits aus der Ferne ihm zu unterwerfen. Doch nahm er sie aus „Zeitgründen“ noch nicht an. Er verschob sie auf das nächste Jahr (liber II, 35). Wie es möglich war, dass sich die Einnahme von Binche über den ganzen Raum des Niederrheins in wenigen Stunden ausbreitete und die dortigen Stammesführer veranlasst haben sollte, über Hunderte Kilometer Entfernung sofort Gesandtschaften zu Caesar zu schicken, um sich, ohne das Schwert zu heben, zu unterwerfen, lässt sich nur durch einen glücklichen Traum des Eroberers erklären. Er muss so viel Gold und Silber, so viele Sklaven erbeutet haben, dazu ohne nennenswerte Opfer, dass seine Einbildung zu Höhenflügen aufgestiegen war.
In der Realität unterschied sich der Angriff auf Binche von allen bisherigen deutlich. Wir kennen die Eroberung wichtiger Städten der Suesionen, Bellovaker, Ambianer, Atrebaten, Viromanduer und Nervier. Keine Siedlung und kein Oppidum wurden bisher geplündert, gebrandschatzt und ihre Bewohner versklavt, wie er das bei dem kleinen Stamm der Atuatuker getan hatte. Vollzog sich in Caesar eine Wandlung? Nein. Es war das Ziel, das er sich gesetzt hatte und dessen Erfüllung ihm große Probleme bereitete. Sein Vorstoß auf den Rhein, das wusste er, mobilisierte eine unendliche Anzahl germanischer Stämme auf beiden Seiten des Flusses.
Ein germanisches Reich mit straffer Führung hätte ihn vielleicht abhalten können. Doch da er wusste, dass die Stämme größeren Wert auf ihre Unabhängigkeit legten als auf ein Leben innerhalb eines Bündnisses, würde er versuchen, einige davon auf seine Seite zu ziehen und andere, die sich wehrten, mit besonderer Härte und Grausamkeit bestrafen. Es sollte sich herumsprechen, dass er gegen germanische Stämme besonders rücksichtslos vorging. Wenn er den Rhein erreichen und als Reichsgrenze auszubauen gedachte, konnte er nicht in traditioneller Art und Weise Gegner besiegen und unterwerfen. Er musste weiter gehen: Verwüsten, Töten, Mensch und Tier, Ausrotten mit Stumpf und Stiel. Dies waren seine Gedanken. Unter den keltischen Stämmen hatte er bereits das Saatkorn des „Germanenhasses“ gelegt. Auch diesen unseligen Begriff hat er erfunden. Caesar zog mit seinen Legionen aus der geplünderten und sicherlich gebrandschatzten Stadt der Atuatuker zurück zu den Legionen, die nach der Schlacht an der Selle noch bei den Nerviern lagerten, und führte sie von dort aus in die Winterlager nach Süden über die Seine in keltische Gebiete. Er selbst verließ den Kriegsschauplatz und verbrachte den Winter in Italien und Illyricum. Damit endete das Jahr 57 v.Chr. für den germanischen Stamm der Atuatuker mit einer empfindlichen Niederlage in seinem zentralen Gau, dem ein bedeutender und weithin bekannter Ort am Fernweg zum Rhein zum Opfer fiel. Noch wissen wir nicht, welchen Rang die Personen einnahmen, die sich Caesar vor der Stadt unterworfen haben. Er lernte sie alle kennen, als Gefangene. Übermittelte aber keinen Namen, obwohl die Stadt nach seinen ausschweifenden Beschreibungen möglicherweise sogar das Stammeszentrum hätte sein müssen. Persönlichkeiten der Atuatuker, der Nachfahren der besiegten Teutonen, durften keinen Platz in den Geschichtsbüchern finden. Darüber befand allein Caesar, denn die Germanen konnten nicht schreiben.
Als die Römer ihre Herrschaft festigten, etwa 27 v.Chr. unter Augustus, bauten sie den Fernweg, der südlich an dem zerstörten Ort (Binche) vorbei führte zu einer schnurgeraden Reichsstraße aus, die dann Waudrez streifte. In diesem Ort hatten sich vielleicht nach dem Abzug der Römer zurückgekehrte Atuatuker neben ihrer zerstörten Stadt niedergelassen.
Die Römer nach dem Kampf mit den Atuatukern
Caesar hatte mit seinem Angriff auf die Atuatuker einen ersten Schritt in Richtung des Rheins und der Eburonen, des größten linksrheinischen germanischen Stammes, unternommen, war aber noch vor deren Stammesgrenze stehen geblieben. Auch die Atuatuker in anderen Städten hatte er noch nicht unterworfen. Am Ende des diesjährigen Feldzugs konnte er tatsächlich einen überragenden Sieg über die belgischen Stämme verzeichnen. Dennoch bewertete er das hart erkämpfte Friedensangebot der Nervier und den fragwürdigen Sieg über die Siedlung Binche als ein glückliches Unternehmen, durch das er „ganz Gallien zur Ruhe gebracht hatte“.
Welche Ruhe er damit meinte, bleibt für immer sein Geheimnis. Jedenfalls herrschte in Westeuropa größere Unruhe seit der Ankunft Caesars. Schließlich war er es, der mit seinem ungerechtfertigten Anspruch, alle Stämme in den keltischen und belgischen Gebieten, ja sogar die Germanen, seien römische Untertanen, wenn er das befehle, der in der weiten Umgebung für Unruhe sorgte. Was ihn so stark machte, waren die Legionen. Die Stämme, bis auf die Haeduer und Remer, hatte er alle gegen sich. Dort, wohin er mit seinen Soldaten gelangte, setzte er römisches Recht und Gesetz durch, ohne die dortigen Bewohner zu fragen, ob sie dies wollten, und ohne Rücksicht auf deren Stammesgesetze und -recht. Zog er ab, erlosch das römische Recht.
Fasst man das Jahr 57 v.Chr. zusammen, dann hatten die Römer unter den keltischen Stämmen (er spricht vom „eigentlichen“ Gallien) fast nur noch Verbündete. Von den belgischen Stämmen waren die an den keltischen Gebieten, d.h. die im Einzugsgebiet der Seine lebenden, ihrer Freiheit verlustig geworden und hatten ihre Unterwerfung besiegelt. Die Größten unter den Belgern kämpften, gaben auf, behielten aber ihre Gebiete und eine gewisse Unabhängigkeit. Dazu gehörten die Atrebaten, die Viromanduer und die Nervier. Die germanischen Stämme östlich davon, z.B. die Atuatuker und Eburonen, blieben noch frei. Daran änderte auch der Überfall auf Binche nichts.
Caesar gewann in diesem Feldzug, der eine Mischung aus militärischem Drill und einem echten Angriff war, eine wichtige Erkenntnis: In seinem erfundenen „Gallien“, das bis zum Rhein reichen sollte, gab es zwei Stammesgruppen, die im Gegensatz zu den Kelten, die sich mit ihm notgedrungen arrangierten, Widerstand leisteten. Die einen waren die nördlichen Belger, germanischer Abstammung, die anderen die Stämme, die sich „gemeinschaftlich Germanen nannten“, links des Rheins.
Im Herbst 57 v.Chr. zogen die Römer aus den Stammesgebieten, durch die das Heer geführt worden war, wieder ab. Standorte für die Winterlager wählte Caesar stattdessen bei den Karnuten, Anden, Turonern u.a. aus. Das waren keltische Stämme, die zwischen der Seine und Loire lebten, also lagerte er im Zentrum dieser Volksgruppe. Damit blieben die germanischen Gebiete nördlich der Oise (Isar) und der Somme (Samara) noch frei. Frei von römischer Besatzung, aber nicht von Verpflichtungen wie Getreidelieferungen, Tributen u.a.
Dennoch darf man sich nicht davon täuschen lassen, dass die Römer abgezogen waren, weil sie ihren Anspruch auf dauerhafte Unterwerfung noch nicht durchsetzen konnten. Der Zug Caesars hatte eine enorme Auswirkung auf die Führung der Stämme und deren Stammesbevölkerung. Immer deutlicher wurde, dass der einzelne Stamm nicht mehr in der Lage war, sich gegen die römische Übermacht zu verteidigen. Selbst die Nervier erkannten das, obwohl sie beispielhaft kämpften. Alle waren sich einig in der Ansicht, dass die Römer wiederkehren würden. Aber nicht darüber, wie man darauf reagieren sollte. Freiheit war das höchste Gut, über das die Germanen verfügten. Es war für die meisten Stämme Ehrensache, sie mit allen Mitteln zu verteidigen. Doch gab es Unterschiede. Die Stämme, die den keltischen am nächsten lebten, die zum Teil sogar keltische Bewohner hatten, neigten Lebensweisen zu, die denen der südlichen Stämme ähnelten. Und die wiederum standen der römischen Zivilisation begehrlich nahe. Die römischen Gesandtschaften, die Reisenden, Kaufleute und Händler hatten auf so manchen Edlen in einem Sinne eingewirkt, dass es diesem schwerfiel, in den ankommenden römischen Truppen tatsächlich ernste Feinde zu erkennen. Man wiegte sie auch in dem Glauben, dass die Verbindung mit den Römern, ja sogar als künftige Untertanen, ihnen mehr Möglichkeiten bieten würde, als das der einzelne Stamm könne.
Es blieb nicht aus, dass sich auch in den herrschenden Adelsfamilien der südlichen belgischen Stämme Mitglieder fanden, die aus einem Bündnis mit den Römern Vorteile in dem Sinne erzielen vermochten, selbst auf schnellstem Wege zu Führern ihrer Stämme aufsteigen zu können. Die Römer legten einen Spaltpilz bis in die Familien. Das Gleiche galt auch für keltische Adelsfamilien, wie wir es schon bei den Haeduern erlebt haben. Für längere Zeit war das der Hauptgrund für die nachgiebige Haltung dieser Stämme gegenüber den Römern. Ein gemeinsamer Aufschrei aller keltischen Stämme wäre doch schon in dem Augenblick zu erwarten gewesen, als Caesar die Grenze zu den Sequanern ohne Kriegserklärung überschritten und sich nicht wieder zurückbegeben hatte. Doch weder die Zwietracht unter den keltischen Stämmen konnte der römische Vorstoß aufheben, noch sie veranlassen, in den germanischen Nachbarn ihre natürlichen Verbündeten zu sehen. Im Gegenteil, Caesar, der damit gerechnet hatte, vertiefte die Kluft zwischen Kelten und Germanen noch, in dem er die einen über die anderen erhob, was Menschen stets schmeichelt. In diesem Falle erhob er die Kelten über die Germanen. In seinem sogenannten Germanenexkurs kann man das nachlesen.
Nach dem römischen Feldzug durch das südliche Belgien, in dem jeder der angegriffenen Stämme bis auf die Moriner und Nervier unterworfen wurde, glaubte sich Caesar seinem Ziel, der neuen Provinz Gallia, sehr nahe. Von nun an verwendete er fast nur noch den Begriff Gallien. Darunter ordnete er alle Stämme, gleich, ob Kelten, Belger oder Germanen, als Gallier ein. Dies war die Bezeichnung für die Bewohner seiner künstlichen Provinz, eine Verwaltungsbezeichnung, keine ethnische. Unter diesen Bedingungen konnte Caesar über den Winter 57-56 v.Chr. seinen Aufgaben als Statthalter in Gallia cisalpina und Istrien nachgehen.
Abb. 10
Münzen aus Thuin