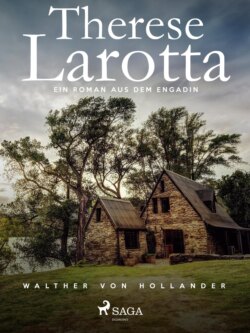Читать книгу Therese Larotta - Walther von Hollander - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDer erste Sommer ging schnell hin. Man hatte hier oben mehr Arbeit als unten in Promontogno, wo man zur Not immer eine Hilfe bekam. Hier musste man — ausser bei der Heumahd, zu der man Schnitter bekam —, alles allein machen, einerlei wieviel Arbeit es war. Haus und Stall waren gross und verwahrlost. Die Wiesen waren vermoost und verunkrautet. Über einige war der Steinschlag niedergegangen, als hätte es Kiesel gehagelt, oder als wäre ein Steinfluss hinübergeströmt. Andere Wiesen fingen an morastig zu werden weil die Abzugsgräben verstopft und verschlammt waren.
Therese wusste manchmal nicht, was sie zuerst arbeiten sollte, denn neben der Feld- und Wiesenarbeit musste sie kochen, putzen, melken, buttern, Käse machen und Schweine füttern. Nur gut, dass Hühner, Enten und Gänse, dass Ziegen und Kühe unter Peters und Pauls Leitung ihr Futter selber suchten und dass Peter Larotta gern rechnete und es ihm darum leicht war, auseinanderzurechnen, wieviel Milch die eigenen Tiere gaben und wieviel die Kostgänger, wieviel man für Wartung und Futter einbehalten durfte und wieviel man gutschreiben musste.
In der Abenddämmerung sass er meist vor der Tür an dem Eichentisch und rechnete. Er rechnete in einem merkwürdigen Singsang, halb deutsch, halb italienisch, eine, zwei Stunden lang, und meist war dieser Gesang der Zahlen, war das monotone Absingen der Liter und Pfennige das einzige, was Therese von ihrem Mann zu hören bekam. Die Einsamkeit hatte den Bauern noch schweigsamer gemacht. Früher hatte er wenigstens manchmal noch geschimpft. Aber jetzt sprach er tagelang nichts ... nichts Gutes und nichts Böses. Therese versuchte herauszubekommen, was in den Mann gefahren war, was ihn wohl quälte und wie sie es vielleicht ändern könnte. Schliesslich brauchte sie doch auch mal hier und da ein paar Worte. Wenn man niemanden zum Sprechen hatte, so war es schon beinahe ein Unglück, wenn der Mann gar nichts sprach und sie darauf angewiesen war, allein mit den beiden Jungen zu reden, die aber den ganzen Tag draussen waren. Wenn sie den Mann etwas fragte, nickte er oder schüttelte den Kopf. Wenn sie sich endlich eine Frage ausgedacht hatte, auf die man nicht mit Gebärden antworten konnte, so konnte es vorkommen, dass er einfach die Achseln zuckte und wegging, und wenn sie ihn abends im Bett etwas fragte, weil er da nicht weglaufen konnte, so drehte er sich langsam zur Wand und schien einzuschlafen.
Tatsächlich — das hatte Therese bald heraus — schlief er nicht. Er lag vielmehr mit offenen Augen und starrte ins Dunkle. Er bemühte sich, den Husten zu unterdrücken, der ihn quälte. Manchmal räusperte er sich, manchmal bellte er leise wie ein Schosshündchen in die Kissen hinein, besonders wenn er glaubte, dass die Frau fest schliefe. Aber sie merkte das alles ganz gut. Nur sie begriff nicht, warum er sich so anstrengte, diese „kleine Erkältung“ vor ihr zu verbergen, warum er sich nicht bemühte, sie loszuwerden.
Gegen Ende des Sommers hielt sie die Einsamkeit nicht mehr aus. Sie hielt es nicht mehr aus, dass der Mann dalag und den Husten zu unterdrücken suchte. Zuerst sagte sie noch, dass sie der Frau Guggis bei irgendeiner besonderen Arbeit zur Hand gehen wolle oder dass sie noch Sahne oder Butter schnell hinaufbringen müsse. Langsam aber — auch weil der Mann sie eher ermunterte, hinzugehen — gewöhnte sie sich daran, auch ohne Grund zum Hotel hinaufzuwandern. Sie wurde angezogen von dem merkwürdigen und ihr völlig unverständlichen Leben, das da oben geführt wurde. Es war ein höchst lächerliches Leben, fand sie. Aber doch ein Leben mit sehr viel Licht, mit weissen Tischen und Blumen, die aus dem Unterland kamen, mit fein angezogenen Menschen, mit einer seltsamen Musik, die sie nicht schön fand, mit Tänzen, bei denen sie als Zuschauer erröten musste, und mit lautem Lachen und vielem Geschwätz, das gleichzeitig lustig und langweilig sein musste. Denn bei allem Lärm und allem Lachen waren die Gesichter der Sommergäste merkwürdig starr und wirklich so, wie Therese sie manchmal in den Zeitschriften gesehen hatte, die durch Zufall sich nach Promontogno verirrt hatten. Die Welt der Zeitschriften lebte! Die Menschen, die dort feine Fräcke und wehende Sommerkleider trugen, die dort puppenhaft und starr herumstanden ... hier lebten sie, liefen herum, lachten und sprachen in vielen verschiedenen Sprachen. Merkwürdig!
Meist stand Therese Larotta in der Anrichte und sah durch die kleine, gardinenbedeckte Scheibe in den Speisesaal, in dem die Gäste sechs oder acht Speisen hintereinander assen. Nach dem Essen aber ging sie nach draussen und stellte sich auf den kleinen Felsen, die sogenannte Kanzel, fünf Meter vom Tanzsaal entfernt. Sie stand immer ganz bewegungslos und ernst, die Augenbrauen so zusammengezogen, dass sie als schmale dunkle Grenze das braunrote Gesicht und die weisse Stirn trennten, die Arme fest in das Tuch gewickelt und so um sich selbst geschlungen, dass sie sich wärmen konnte. Denn in dem ersten Sommer fror sie noch bitterlich in den Nächten, die keine echten Sommernächte waren, sondern fast Winternächte mit Tau, Reif und Eiskälte.
Schon im Verlaufe dieses Sommers lernte sie die einzelnen Gäste unterscheiden, erwärmte sich für die einen und fand die anderen langweilig. Sie begriff sogar, dass hinter den Spielen und hinter dem Lachen auch Kämpfe sich abspielten, zum Beispiel der Kampf um die rote Holländerin Frau Wilhelmine Roodeweld, die, wie Frau Guggis erzählte, von ihrem Mann geschieden war und nicht wusste, ob sie den Kommerzienrat, den Schriftsteller oder den Oberingenieur nehmen sollte, und schliesslich mit einem Missionar abreiste.
Manchmal kamen die Fremden auch an der Felsenkanzel vorbei, wenn sie zum Beispiel mit viel Lärm einen Mondscheinspaziergang machen wollten oder ein kleines Feuerwerk anzünden. Sie bemerkten natürlich die stumme Beobachterin und wurden bei ihrem Anblick still, linkisch, übertrieben sorglos, oder sie versuchten sogar mit Witz und Zuruf eine Anknüpfung. Aber Therese Larotta bemerkte das alles nicht. Die Menschen, die an ihr vorübergingen, so nah manchmal, dass sie sie hätte greifen können, waren für sie nicht Menschen von dieser Welt. Genau so gut hätte man ihr raten können, mit den Engeln zu reden, Gabriel und Michael, die von Kindheit an durch ihre Träume gingen, geformt wie die Gestalten des Kirchengemäldes in der Heimatkirche und natürlich auch in einer Sprache sprechend, die sie nicht verstand, und taub für die leisen und seltenen Worte ihrer Sprache.
So blieben ihre Augen starr auf den beleuchteten Tanzsaal gerichtet, wo hinter Scheiben, die im Verlaufe des Abends immer mehr durch Hitze und Zigarrenrauch beschlugen, die fremde bunte Welt sich blütenhaft entfaltete und schliesslich hinter wassertropfenden Scheiben versank und verschwamm.
Wenn Therese heimkam, wachte der Bauer fast immer, oder man hörte ihn leise in die Kissen husten oder aus schweren Träumen vor sich hinreden. Er sprach über Lawine und Steinschlag, er wehrte Kühe und Ziegen ab, die im Schlaf an seinem Lager standen und ihn anzuknabbern suchten. Wachte er dann auf, so sah er sie an, als ob er und nicht sie von ferne nach Hause kam. Er presste die Hand auf sein Herz und schüttelte abwehrend den Kopf, wenn sie sich über ihn beugte. Einmal, als sie wiederkam, merkte sie, dass er vor Kälte zitterte. Da legte sie sich der ganzen Länge und Breite nach auf den Kranken, deckte ihn ganz und gar mit sich zu und lag still, den runden Kopf unter das Kinn des Mannes geschoben, horchte auf das Rauschen und Brausen der Wasser, das Brüllen einer Kuh, das Klirren der Stallketten, das Rasseln des langsam ruhiger werdenden Atems, und sie schlief — dieses Mal und immer — erst ein, lange nachdem der Mann eingeschlafen war. Hätte sie ihn gefragt, ob er sie bei sich haben wollte, er hätte sie sicher weggeschoben. So aber, da sie ohne zu fragen gekommen war, liess er es sich gefallen und — so schien es — war ihr dankbar. Denn ein paarmal strich er ihr über die Stirn, und einmal, als sie ein wenig später als sonst vom Hotel zurückkam, murrte er: „Endlich.“