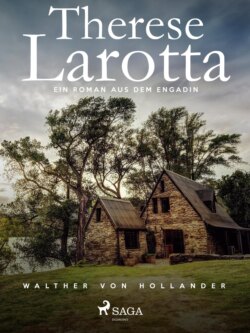Читать книгу Therese Larotta - Walther von Hollander - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеAn diesem „Noch nicht“ klammerte sich der Kranke fest. Er richtete sich daran auf wie an einem Seil. Mit diesen zwei Worten bekämpfte er den Tod länger, als er es sonst vermocht hätte.
Zwischen den Eheleuten war jede Verbindung zerschnitten. Es gab nichts anderes mehr als Hohn von Peter Larotta und Tränen von Therese. Konnte man denn wirklich nicht gutmachen, was man einmal falsch gemacht hatte? Wahrhaftig, sie hatte doch nicht seinen Tod gewünscht, als sie den Stoff kaufte. Der Tod fragte doch nicht bei ihr an, was sie wünschte. Warum wollte er ihr nicht verzeihen?
Larotta antwortete nicht. Er war tagelang ganz abwesend. Er gab es jetzt schnell auf, den Gesunden zu spielen. Er arbeitete nicht mehr oder arbeitete doch nur daran, am Leben zu bleiben. Meist lag er im winterdunklen Schlafzimmer, den Kopf sehr hoch gebettet, und sah zu, wie die Wolken draussen sich hoben und senkten, zusammenballten und auseinanderflatterten, wie der Schnee fiel und immer höher wurde.
Nur selten kam er in die Stube oder in die Diele, stand schweigend da, sah die „Lebenden“ hasserfüllt an oder lachte über ihr Tun und Treiben. Eines Abends tauchte er im Stall auf, stand plötzlich vor ihr, wie damals, als er um sie warb, im Kuhstall von Promontogno, zehn Jahre zuvor. Und wie sie damals weitergemolken hatte, den Kopf tief auf den Eimer gesenkt, damit er nicht sähe, wie sie errötete, so melkte sie auch jetzt weiter, liess die Milch gleichmässig in den Eimer zischen, als könnte sie ihm dadurch entgehen. Und wie er damals im Scherz und Übermut, um sie von ihrer Arbeit abzulenken, den vollen Milcheimer wegtrat, so dass die Milch über den Stallboden floss und Therese erschreckt aufschrie, so trat ihr jetzt der Bauer auch wieder den Milcheimer um, böse und mutlos, als könne er sie dadurch zwingen, ihn von neuem zu lieben. Aber wenn es damals gut geendet hatte in einer heftigen Umarmung und in einem Gelächter über die verschwendete Milch, so endete es diesmal hässlich und mit einem bösen Lachen. „Noch nicht ... noch nicht“, flüsterte der Bauer, indem er die Bäuerin, die aufgesprungen war, wieder auf den Melkschemel zwang, „noch nicht.“
Endlich, Mitte November, war es mit seinen Kräften vorbei. Im Verlauf von wenigen Stunden verfiel er. Er sah es nun wohl auch ein, dass ihm nichts vom Sterben weghalf, trotzdem es ihm gerade in den letzten Tagen so gut ging. Denn er wurde mit einem Male ruhig, sanft und beinahe heiter. Ja — man sollte den Kaplan benachrichtigen. Zwar bis der kam, war es wohl zu spät.
Aber man hatte dann wenigstens getan, was man konnte. Und der heilige Peter, sein Namenspatron, schloss ja selbst die Himmelstür auf. Dann konnte er ihm schon erklären, wie es sich mit dem Sterben hoch oben im einsamen Tal verhielt und dass man auch ohne die Letzte Ölung in den Himmel hineinschlüpfen müsse. Er rief die Jungen. Sie sollten sich nur ruhig ein bisschen aufs Bett setzen und die Mutter neben sie. Nein ... näher die Mutter. Er legte ihr die Hand auf die Schulter. Er krallte sich schmerzhaft mit seinen Fingern in ihrem Winterschal fest. Er zog sie mit letzter Kraft näher und näher, bis ihre Stirn auf seine Stirn zu liegen kam. Er starrte mit grossen fremden Vogelaugen in ihre Augen. „Wo bist du denn?“ stöhnte er. Er konnte sie nicht mehr erkennen. Dann war es vorbei.
Therese Larotta lag ein paar Minuten mit ihrer Stirn auf der Stirn des Toten. Dann erhob sie sich vorsichtig, löste den Schal aus seinen erstarrten Händen und wickelte ihn sich fest um den Hals. Die beiden Jungen drückten sich weinend zur Tür hinaus. Dann liefen sie um die Wette zum Guggis ins Berghotel hinauf und zum Bauern am Hang hinunter, um die Nachricht zu überbringen. Therese drückte dem Bauern die Augen zu und faltete seine Hände. Sie war wehmütig und doch auch erlöst, dass der lange Abschied nun ein Ende hatte.
Abends ging sie ins Berghotel zum Guggis hinaus. Sie sassen zusammen in der Küche, tranken Kaffee und sprachen gedämpft über den Toten, und die dicke kleine Frau Guggis vergoss sogar ein paar Tränen. Nachher gingen Therese und Herr Guggis in die Werkstatt im Keller und suchten Bretter für den Sarg zusammen. Es lagen dort schöne glattgehobelte Fichtenbretter, und nachdem Therese die Bretter gebeizt hatte, setzte Guggis sie geschickt und schnell zusammen. Eigentlich, so erzählte er, war er Sargtischler von Beruf. Aber das war schon Jahrzehnte her, und er hatte sich nicht träumen lassen, dass er seine Kenntnisse hier oben noch werde verwenden können. „Es macht ordentlich Spass, mal was Vernünftiges zu tun“, sagte er eifrig. „Nicht immer nur herumstehen und sagen, dass es bald wieder schönes Wetter gibt, wie die Spitze heisst und der Gletscher und ob der eine Spaziergang schöner ist als der andere. Müssiggängerarbeit!“
Er unterbrach sich, denn er hatte Therese weinen gesehen. Richtig, richtig! Für sie war ja dies Tischlern eine schmerzliche Sache. Er stand verlegen gegen einen Stapel Bretter gelehnt und sah die Frau prüfend an. „Nun müssen Sie nicht mehr weinen“, sagte er. „Das hat ja keinen Zweck. Sie sind jung, Sie sind hübsch, Sie sind auch nicht arm. Also, was wollen Sie?“
Therese stand unbeweglich und weinte. Die letzten Monate mussten erst mal weggeschwemmt werden, die ewige Todesangst, die Furcht vor dem Sterben und dem Sterbenden. Sie musste sich erst daran gewöhnen, dass sie weiterlebte. Sie allein mit ihren Jungen.
Guggis stand jetzt neben ihr. Er hatte ihr den Arm väterlich um die Schulter gelegt. „Wenn Sie mal einen Rat brauchen ...“, sagte er. Therese entzog sich dem schützenden Arm. „Vielen Dank“, flüsterte sie, „aber ich brauche keine Hilfe.“
„Gut ...“, sagte Guggis etwas gekränkt, „wenn Sie meinen, dass Sie allein durchkommen ...“
Therese nickte. Ja, sie wollte allein durchkommen. Ja, sie wollte allein leben. Sie hatte ja ihre Arbeit und ihre Jungen, und sonst wollte sie gar nichts mehr. Sie freute sich schon ein wenig auf ihr Leben.
Als sie über die Wiesen nach Hause ging, schien der Mond hell durch die Wolken. Man konnte den Weg gut übersehen, ihr Schatten ging getreulich neben ihr, ein breiter, etwas behäbiger Schatten mit einem grossen Schal um die Schultern, den der Wind heftig aufblies.
Zu Hause setzte sie sich auf den grossen Stuhl neben dem Ofen und schlief sofort ein. Nebenan im Totenzimmer brannten die Kerzen ruhig und hell.