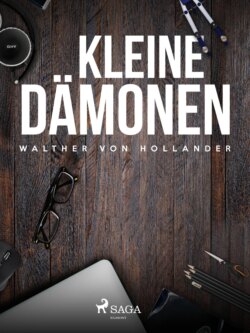Читать книгу Kleine Dämonen - Walther von Hollander - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеIch bin die letzten zwanzig Jahre Redakteur gewesen, teils aus Neigung, weil es mir Spaß macht, die verschiedensten Meinungen unter den Jochbogen einer einheitlichen Meinung zu biegen, teils aus einer angeborenen Trägheit. Denn bei aller Leidenschaft für das Wort und für den Gedanken der Vernunft scheint es mir weitaus bequemer, andere schreiben zu lassen, anderen die undankbare Aufgabe zu überlassen, ihre Gedanken zu schleifen. Es fördert das Selbstbewußtsein, wenn man dann hinterdrein nur mit dem Finger auf die ungeschliffenen Worte zu weisen braucht und ein Nachschleifen verlangen darf. Eine schmerzhafte Empfänglichkeit für reine, ungebrochene Sprachtöne, ein starkes kritisches Vermögen haben mich zu einem guten Redakteur gemacht. Aber während ich dies schreibe, stelle ich mit Bedauern fest, daß das Schreiben mir sehr schwer fällt. Die zwanzig Jahre lang geübte Kritik ist natürlich auch dem eigenen Wort gegenüber wach. Wenn ich aber das schreiben will, was ich mir vorgenommen habe, so darf ich nicht allzu wählerisch im Ausdruck sein. In einer gehobenen, prächtigen Prosa können die Meinungen und Taten der Menschen meiner Geschichte einfach nicht geschildert werden. Ich hasse es jedenfalls, einen leichtfertigen Swing als Sinfonie herauszuputzen.
Aber das sind so Sorgen, die eigentlich jene Leser, die ich mir beim Schreiben vorstelle, gar nichts angehn. Ich kam auch nur darauf, weil es ja doch wohl notwendig ist, mich vorzustellen und zu erzählen, wieso wir alle in Wallberg zusammenkamen. Ich war also als Redakteur in einem der großen Verlagshäuser in Berlin während des Krieges u. k. gestellt, obwohl ich mit dem Propagandaministerium einen tückischen Kleinkrieg führte, auf den ich damals sehr stolz war und der mir jetzt recht läppisch erscheint. Denn wenn es mir auch gelang, hier und da zwischen die Zeilen meiner Zeitung ganz nette Tellerminen gegen die Regierung zu placieren, so hat das zwar meinen immer kritischer werdenden Lesern viel Spaß gemacht, aber der Regierung hat es nichts geschadet. Man ließ mich ruhig meine Minen weiter legen, obwohl es ein leichtes gewesen wäre, mich einzuziehn, da ich im letzten Jahr des ersten Weltkrieges Offizier geworden war und man Offiziere dringend brauchte. So blieb ich in Berlin und mußte miterleben, wie diese von mir so geliebte Stadt — eine der häßlichsten, aber originellsten Städte der Welt — langsam und stetig in Schutt und Asche sank. Zweimal bin ich ausgebombt worden. Das erstemal ging meine hübsche Wohnung im Künstlerblock Wilmersdorf in Flammen auf, und alles, was ich mir in zwanzig Jahren zusammengekauft hatte, meine Möbel, meine Teppiche, meine Anzüge und Mäntel, mein schöner, warmer Biberpelz, meine Bilder, meine Bücher, meine Briefe und Photographien, alle Kostbarkeiten und aller Müll meines früheren Lebens verbrannten. Bis auf die paar Sachen, die ich in zwei Lederkoffern bei jedem Angriff in den Keller schleppte. Das zweitemal wurde ich verschüttet in einer Mietskaserne am Spandauer Berg und lag dreißig Stunden zwischen zwei Betonklötze geklemmt, ohne etwas anderes abzubekommen als eine Quetschung der linken Kniescheibe, die mich manchmal am Gehen behindert.
Ich hatte es insofern leichter als andere, als ich die letzten fünf Jahre infolge einer großen persönlichen Enttäuschung, die nicht hierher gehört, nahezu völlig einsam gelebt hatte und jedenfalls keine engeren Bindungen eingegangen war. Ich konnte deshalb auch keine Verluste erleiden, die mir hätten ans Herz, greifen können. Ein armseliges Leben, wird man sagen. Aber es ist nicht nur Eulenspiegelei, wenn ich meine, daß es in unseren Zeiten besser ist, arm zu sein. Denn die Seele des Reichen ist immer verschattet von der Angst vor dem Verlust.
Um mich selbst habe ich nie sehr gezittert. Ich lebe ganz gern, weil ich trotz allem das Schauspiel des Lebens anregend und amüsant finde. Oder besser: ich fand es amüsant. Jetzt, nachdem sich die Sensationen allzusehr gehäuft haben, und vor allem, seitdem es sich herausstellt, daß es meistens negative Sensationen sind, beginnt mich das Zuschaun zu ermüden und zu langweilen.
Aber ich schweife immer wieder ab und auf diese uninteressante Person hin, die bei 15 Grad Kälte draußen und 4 Grad Wärme drinnen im Polarforscherkostüm am Schreibtisch hockt und klappernd vor Kälte die klappernde Schreibmaschine bedient. Was ich sagen wollte, ist nur: Nach meiner Verschüttung empfand ich es als angenehm, daß Teile der Redaktion verlagert wurden. Mit einem kleinen Extrazug fuhren wir, zwei Wagen mit vielleicht hundert Menschen und fünf Wagen mit Akten, Schreibmaschinen, Büromaschinen und Büromöbeln, Ende Januar 1945 nach Süden. Wir fuhren recht bequem und ungeheuer langsam. Die Eisenbahnen waren schon weitgehend zerstört, und immer wieder lagen wir stundenlang auf freier Strecke, bedroht von Jabos, die uns auch zweimal erheblich beharkten. Dabei wurde neben mir das reizende Fräulein von Klemen erschossen, eine meiner begabtesten Volontärinnen, in die ich mich während der ersten zwei Tage der Fahrt so heftig verliebt hatte, daß ich ihr einen Heiratsantrag machte. Es war der zweite Heiratsantrag in meinem Leben. Ich glaube kaum, daß ich einen dritten machen werde. Wir begruben sie in Koburg auf einem besonders häßlichen Friedhof, dessen Marmorkreuze und Engel noch heute gut erhalten sind und durch ihre Existenz beweisen, daß vieles, was uns umgab, zerstörenswert war.
In Koburg lernte ich Vittorio Trenti etwas näher kennen. Er war ein recht begabter Kameramann, der Chefphotograph des Verlages (ein Titel, den er sich ausgedacht hatte). Ich hatte ihn früher schon hier und da in der Kantine des Verlagshauses getroffen, und ab und zu kam er auch auf die Redaktion, um sich zu beschweren, daß dieses oder jenes seiner Bilder nicht gut genug placiert oder gedruckt worden war. Aber ich hatte noch keine hundert persönlichen Worte in meinem Leben mit ihm gewechselt.
Trenti war einer der schönsten Männer, die ich je gesehn habe, und ich mag schöne Männer nicht. Woran diese Schönheit eigentlich lag, ist schwer zu beschreiben. Blauschwarzes, leicht gewelltes und sorgsam gescheiteltes Haar haben auch andere. Seine Augen allerdings, die er seiner norddeutschen Mutter, einer geborenen Gräfin Haake, verdankte (man konnte nicht zehn Minuten mit ihm zusammen sein, ohne zu erfahren, daß er sozusagen ein Halbgraf war), diese strahlend blauen, etwas seelenlosen Augen standen in einem anziehenden Gegensatz zu den schwarzen Haaren. Das Gesicht war schmal. Die Nase etwas zu groß, aber fein geschnitten. Die Lippen voll und nahezu himbeerrot. Das Gebiß sehr weiß, mit gleichmäßigen, etwas zu großen Zähnen. Er war etwas übermittelgroß, breitschulterig, schmalhüftig, sehr trainiert, ein berühmter Kurzstreckenläufer, Dritter auf der Olympiade 1936 im 200-Meter-Lauf, ein guter Reiter, ein vorzüglicher Florettfechter, ein brillanter Schiläufer. Wenn ich noch erzähle, daß er auf eine besonders saloppe Art elegant oder auf eine besonders elegante Art salopp gekleidet war — immer trug er ein pfiffiges Halstuch, ein schnittiges Lumberjack, seltsame Trainingshosen, die durch einen besonderen Schnitt auf geheimnisvolle Weise jede Plumpheit verloren, oder eine alte Manchesterhose, die an seinen langen, graden Beinen wie von einem ersten Atelier geschneidert wirkten —, so habe ich alles geschildert, was ihn zu einem typischen Herzensbrecher machte. Aber darüber hinaus hatte er eine in Deutschland sehr seltene Gabe: eine charmante Selbstverständlichkeit, mit Menschen umzugehn, die ihn auch befähigte, selbst zu den abweisendsten Mächtigen dieser Welt vorzudringen und ihr Bild mit seiner ewig jagdbereiten Kamera einzufangen. Obwohl er sich selber schön fand, war er nicht eigentlich eitel. Er verstand es aber, seine Schönheit auf anziehende Art in Szene zu setzen. Wo er sich aufhielt, war er der Mittelpunkt der Welt, und selbstverständlich war er auch der Mittelpunkt jener Woche in Koburg, in der wir im übrigen wenig taten, weil die Post schon nicht mehr recht funktionierte und die mahnenden Telegramme unseres Verlagshauses, das noch immer so tat, als müßten wir für einen Sieg arbeiten, der längst untergegangen war, uns immer gleichgültiger wurden.
Daß Trenti ganz besonders im Mittelpunkt stand, hatte seinen Grund auch darin, daß er gerade erst aus den Gestapokellern in der Albrechtstraße entkommen war. Im Gegensatz zu allen anderen, die, wenn sie von dort herkamen, sich in ein angstvolles Schweigen verkrochen, sprach er offen und heiter von dieser Zeit. Anscheinend hatte er selbst die Gestapowachtmeister und -häuptlinge bezaubert. Ihm war jedenfalls nichts geschehn. Und genau an dem Tage, an dem der Transport aus Berlin abging, erschien er frisch, heiter und wie aus dem Ei gepellt mit umgehängter, schußbereiter Kamera in unserem Zug. Was er allerdings sonst aus den Kellern berichtete, war weniger heiter. Er erzählte ohne sonderliche Empörung und darum um so eindrucksvoller von Martern und Hinrichtungen, mit denen wir uns unsere Geschichte nicht weiter beschweren wollen. Denn Trenti selbst war durchaus nicht beschwert oder beeindruckt davon. Wenn man es auf eine Formel bringen will, was Trenti eigentlich dachte oder besser empfand — denn ich glaube nicht, daß er sich jemals mit Denken abgegeben hat—, so wird es etwa folgendes sein: Das Leben heute ist sehr interessant. Überall stehn Fallen, die den Harmlosen fangen, aber wer heute harmlos lebt, ist eben dumm. Man muß sehr genau aufpassen. Man muß leben wie das Wild im Walde, in ständiger Witterung. Dann lebt man genau so frei wie das Wild und kann die ungeheure Weite des Lebens trotz aller Gefahren genießen.
Trenti war wegen einiger unbedachter Äußerungen festgesetzt worden, wegen harmloser Schimpfereien, wie sie damals eigentlich jeder machte, und weil er auf besonders gute Art und in erschreckender Weise genau den Propagandaminister sowohl körperlich wie stimmlich imitieren konnte. Fräulein Schütze, die in den Koburger Tagen seine Freundin war, erzählte mir, daß seine Berliner Geliebte, eine Tänzerin, ihn verpfiffen habe. Damals hörte ich zum erstenmal den Namen Manuela.
Die Schütze ist ein guter Kerl, frisch, tüchtig, dumm und von jener angenehmen Heiterkeit, die in Zeiten wie den unsern nur die Dummen haben können. Ich gab deshalb nicht allzuviel auf ihr eifersüchtiges Geschwätz. Aber Spernser, der ein paar Tage nach uns eintraf — natürlich in einem wundervollen Ford-Acht-Zylinder, wie es sich für einen Sachverständigen in Frauenfragen gehört, und mit zwei überaus eleganten Frauen im Fond des Wagens, Frau Herma Zacke und Didi Seifert, Generaldirektorsfrauen mit Handkoffern voll Schmuck, die ihre kostbare Existenz zu retten entschlossen waren und dafür sogar dem häßlichen Spernser zulächelten, ihm vertraulich auf die breiten Schultern klopften, ihn ab und zu burschikos umarmten und ihn Herzblatt nannten —, Spernser bestätigte Fräulein Schützes Angaben im wesentlichen. Die Sache war nach seiner Darstellung sogar noch übler. Manuela, die es mit der Treue besonders ungenau nahm, verlangte von Trenti, dem die Feen zu den anderen Gaben die Gabe der Treue gleichfalls nicht in die Wiege gelegt hatten, daß er ihre Eskapaden ihr nachsehn, selbst aber keine andere Frau ansehn dürfe. Sie hatte ihre besondere Gunst einem höheren SS-Offizier geschenkt, der seinerseits auf Trenti naturgemäß sehr eifersüchtig war. Und als Manuela nun ihrem Vittorio auf eine Geschichte „draufkam“ — wie sie als Bayerin wohl sagte —, lieferte sie ihn ihrem SS-Offizier aus, der sich dieses „unerhörten“ Falles mit großer Energie annahm. Soweit Spernser.
„Und wie ist er wieder herausgekommen?“ fragte ich. „Du weißt doch alles.“
„Weiß ich auch“, sagte Spernser. „Trenti hat es mir genau erzählt, mit weit aufgerissenen blanen Gräfinnenaugen, gläubig wie ein Kind. Ich habe schon vor Jahren geschrieben: Don Juan ist dumm. Er lernt aus keiner Erfahrung. Sonst könnte er ja nicht immer wieder von jeder Frau begeistert sein.“
„Ich möchte nicht wissen, was Spernser geschrieben hat“, sagte ich ungeduldig, „denn das weiß ich sowieso. Was erzählt Trenti?“
„Natürlich, daß Manuela ihn wieder herausgeholt hat“, brummte Spernser. „Er will jetzt nach Berlin zurück, um sie zu retten. Das wäre zumindest seine Dankespflicht. Er schwimmt in Rührung.“
„Und schläft mit Fräulein Schütze. Der eine ist des anderen wert. Und Spernser, der Frauenkenner, bekommt bei dieser Geschichte die Augen eines gerührten Hundes.“
„Lerne du erstmal Manuela kennen! Wenn du nicht sofort auf deinem moralischen Roß davonreitest, bist du verloren. Das sage ich dir.“
„Eine glutäugige Kastagnettenklapperin also, eine Männerfrühstückerin, eine Unwiderstehliche! Mann, Spernser, sowas habe ich schon mein Leben lang gesucht und nirgends gefunden. So eine, für die sich die Männer die Brillanten gegenseitig aus der Brusttasche reißen, bebend ungedeckte Schecks verschenken, Familien kalt pfeifend im Sumpf versinken lassen ...“
„Ja, so ähnlich“, sagte Spernser etwas spitz, „jedenfalls eins steht fest: Sie ist unserm Viktor Dreißig (so nannte er Vittorio Trenti zu dessen Wut immer) mindestens gewachsen. Bin gespannt, wie das ausgeht.“
„Aber das ist doch aus ... nach diesen Gemeinheiten ...“
„Gemeinheit schützt vor Liebe nicht“, lachte Spernser. „Die beiden kommen nicht voneinander los ... bis daß der Tod sie beide scheidt.“
Tatsächlich war Vittorio am nächsten Tag nach Berlin abgereist, angeblich um den neuernannten Verteidiger Berlins, der übrigens ein Bayer war, soweit ich mich erinnere, zu photographieren. Fräulein Schütze lief mit verquollenen Augen durch die Gänge unseres komischen Hotels, hockte nach Tisch mit Spernser in einer dunklen Ecke des Speisesaals und trank mit ihm eine halbe Flasche Orangenlikör, Trentis Spezialmarke, die sie aus seinem Kleiderschrank gestohlen hatte. Oder sagen wir besser: entnommen. Denn Trenti, äußerst schlampig in allen Angelegenheiten des äußeren Lebens, hatte ihr die Verwaltung aller seiner Angelegenheiten übertragen. Es war das, wie ich erst später erfuhr, eine Art von leichtsinniger, aber ritterlicher Kapitulation vor dem weiblichen Geschlecht. So sehr er die Fügung und Lösung seiner Freundschaften beherrschte, so sehr ließ er sich in den Dingen des Alltags von der jeweiligen Freundin beherrschen. Die Auslieferung aller Schlüssel an die Königin der Situation war so ein vertracktes Symbol für seine Unterwerfung unter das weibliche Geschlecht an sich. Aber da die Herrscherinnen sehr schnell zu wechseln pflegten, kann man sich denken, wieviel Verwirrungen dadurch in Vittorios Leben angerichtet wurden. Er pflegte übrigens allen Damen gegenüber kein Geheimnis aus dem Stande seiner Gefühle zu machen. Er schwärmte, wie er oft betonte, für Ehrlichkeit und Wahrheit. So hatte er auch, wie mir Spernser gleich danach mit vor Orangenlikör schwimmenden Augen berichtete, dem unglücklichen Fräulein Schütze mitgeteilt, daß er nach Berlin fahre, um Manuela „diesem SS-Knilch schleunigst abzuknöpfen“. Denn bei der Lage der Dinge sei ja diese Verbindung für sie äußerst gefährlich. Spernser und Fräulein Schütze waren am Ende der halben Flasche Orangenlikör zu dem Ergebnis gekommen, daß Vittorio schneidig und edelmütig zugleich handele. Die brave Schütze war am Abend vollständig betrunken. Da sie aber von ihrer ostpreußischen Heimat her gewohnt war, sich gut und gerade auf den Beinen zu halten, merkte man das nur an ihrer ungewöhnlichen Redseligkeit und der Hartnäckigkeis, mit der sie mir immer wieder versicherte, Vittorio werde Manuela zwar retten, weil er eben schneidig und edelmütig sei, aber er werde sie nicht einmal mehr mit dem Hintern angucken. Da sie diesen kräftigen Satz im Laufe des Abends etwa fünfzehnmal wiederholte, sehr zur Freude der Generaldirektorsfrauen Didi Seifert und Herma Zacke, und da der Orangenlikör unerschöpflich war, verlief dieser Abend in einer verschwimmend-eintönigen Langeweile. In den alkoholischen Nebel hinein brachte der kleine, glatzköpfige Direktor Kölle, der anscheinend in seinem Zimmer mit seinem Kofferapparat eifrig die feindlichen Sender abhörte, immer neue sensationelle Schreckensnachrichten. Die Amerikaner seien nur noch achtzig Kilometer von Koburg, die Russen hätten die Oder überschritten. Die telephonische Verbindung mit Berlin sei abgerissen, und schließlich sei ein Blitztelegramm des Verlages eingetroffen, das uns den Befehl gebe, uns in den nächsten Tagen weiter nach Süden abzusetzen.
Alle diese Nachrichten machten auf uns wenig Eindruck. Nicht nur des Orangenlikörs wegen waren wir von allen Verbindungen zu unserem früheren Leben losgelöst. Da wir unsere Zukunft nicht bestimmen konnten, da es unmöglich war, sich ein Bild davon zu machen, was nun kommen werde, waren wir auf eine bis dahin unvorstellbare Weise frei. Wir lebten so gegenwärtig wie kaum je zuvor oder nachher. Es gab für uns keine Wirklichkeit außerhalb der vierundzwanzig Quadratmeter unseres engen Gastzimmers, außerhalb der dunklen, verräucherten Lincrustawände dieses Honoratiorenstübchens mit dem schlecht gescheuerten Kneiptisch in der Mitte, den ungefügen, ungepflegten Ledersesseln, den klobigen Aschenbechern, die den Schnaps einer längst ausgebombten Berliner Schnapsfabrik dringend empfahlen, der kleinen Biertheke, hinter der vollmondgesichtig und verächtlich Herr Maiboom sich lümmelte, der Zapfknecht des Hotels, Zellenleiter und Inhaber des goldenen Parteiabzeichens, das er aufreizend genug immer noch auf seiner grünen Hausknechtsschürze trug — einer der wenigen getreuen Gefolgsmänner seines Führers. Keine Wirklichkeit, außer den sechs, sieben Gesichtern um den Tisch, lachenden, gierigen, hoffnungslosen Gesichtern, den blitzenden Ohrringen der hektischen Frau Zacke, der sanftschimmernden, kostbaren Perlenkette Didi Seiferts, an der sie mit spitzen, rotlackierten Fingernägeln herumfingerte, so, als würde sie sonst an ihrem Schmuck ersticken. Dazwischen immer wieder die Glatze Kölles und seine feisten, bleichen Hamsterbäckchen, die vor Nervosität vibrierten, die Katastrophenglatze, wie Spernser sie unehrerbietig nannte. Schließlich noch, durch unser Gelächter angelockt, Tellermann, der Matador der Berliner Lokalredakteure, der rüstige Sechziger, ehemaliger Meister im Schnellgehn, vielfacher Sieger im Gepäckmarsch rund um Berlin, ein Mann also, dem mit dem Untergang Berlins seine Existenz gewissermaßen doppelt genommen wurde und der als einziger unter uns noch von einer Wendung der Dinge im letzten Augenblick faselte. Dazu seine fünfundfünfzigjährige Sekretärin Bella van Zamen, aus unerfindlichen Gründen Häschen genannt, Herta Schröder, Spernsers Sekretärin, ein blaßblondes Nichts, das beim Lächeln einen Goldzahn entblößte, und Oskar von Willigrodt, mein Stellvertreter, achtundzwanzig Jahre alt, einarmig und einäugig, den leeren linken Ärmel seines Rockes mit fahrigen Bewegungen wie eine Vogelscheuche schwenkend und die leere, linke Augenhöhle hinter einem schwarzen Monokel verborgen.
Das also war das äußere Bild dieses letzten Koburger Abends. An Ereignissen ist lediglich zu verzeichnen, daß Maiboom, der Zapfknecht, den ziemlich betrunkenen Spernser wegen defaitistischer Reden stellte und mit einer Anzeige beim Ortsgruppenleiter drohte, ein paar Ohrfeigen bekam, hinausflog und von da ab hartnäckig immer wieder an der verschlossenen Tür polterte. Ferner, daß wir überflüssigerweise alle Brüderschaft tranken, wobei Herma Zacke an Willigrodts Brust gewissermaßen kleben blieb. Daß Spernser und Didi Seifert sich unter Tränen schworen, miteinander durch dick und dünn zu marschieren, wobei Didi immer wieder versicherte, nur häßliche Vögel seien treue Menschen. Das war dann wieder das Signal für Fräulein Schütze, über Vittorio zu sprechen, den kein Mensch außer ihr je verstanden habe, der wohl äußerlich nicht treu sei, aber innen von purem, treuestem Golde. Schneidig und edelmütig und edelmütig und schneidig, und ob irgend jemand von den Anwesenden etwa glaube, daß Vittorio jemals diese talentlose Tänzerin, diese Manuela, geliebt habe. Nein ... versicherten wir im Chor, kein Mensch könne auf eine so lächerliche Idee kommen. Worauf sich Fräulein Schütze feierlich erhob, alle Gläser bis zum Überlaufen mit Vittorios Orangenlikör vollschenkte und uns aufforderte, auf Vittorios schneidige Edelmütigkeit zu trinken. Wer, außer Trenti, würde wohl eine ungeliebte Frau, die ihn dazu noch — „Ihr wißt es ja alle“ — denunziert habe, unter Lebensgefahr aus Berlin herausholen? „Niemand“, sagte Spernser dumpf und feierlich, und wir antworteten im Chor, wie Statisten beim Rütli-Schwur: „Niemand, niemand.“ Darauf brach die Schütze weinend zusammen. Und da kein anderer Mann in der Nähe war, begoß sie mit ihren Tränen Tellermanns Rockaufschläge. Tellermann streichelte etwas verlegen Fräulein Schützes Hinterkopf, während das fünfundfünfzigjährige Häschen verkniffen versicherte, daß zu ihrer Zeit, die freilich eine andere Zeit gewesen sei, die jungen Mädchen „ihre Seidenwäsche nicht vor aller Augen gewaschen hätten“.
Mit diesem etwas vagen und kühnen Bild schloß für mich der letzte Koburger Abend. Als ich hinausging, prallte ich auf den Schenkknecht Maiboom, der sich hineinzudrängen versuchte, aber nicht hineinkam, weil Spernser und Willigrodt ihm die Tür wieder vor der Nase zudrückten und abschlossen. „Der Ortsgruppenleiter ist getürmt“, schrie er. „Ich kann ihn nicht melden. Aber kaltmachen werde ich den Kerl. Ich dreh ihm den Kopf um wie einem alten Hahn. Verstehn Sie.“