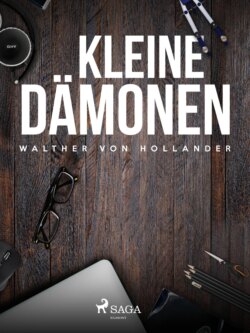Читать книгу Kleine Dämonen - Walther von Hollander - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеDie Kälte dauert an. Sie dringt unaufhaltsam durch alle Mauern. Langsam bezieht sich die Ostwand des Zimmers mit einer Eisschicht, die tagsüber manchmal auftaut, wenn wir was zu heizen haben. Dann werden die Tapeten feucht. Sie lösen sich langsam von den Zimmerwänden, rollen sich, hängen in Buchten und Beuteln, aus denen es leise tropft. Aber wir haben nicht mehr viel zu heizen. Gestern erwischte ich allerdings einen Zentner Kohlen für hundert Mark und vier Zigaretten. Vier Tage wird es einigermaßen warm bleiben. Wenigstens im Zimmer. Über den Dachboden fegt ein eisiger Wind. Denn irgendeiner der anderen Dachbodenmieter, die Gesangspädagogin Pisarri (italienische Schule) oder Herr Kallumeit, D. P., d. h. displaced person, von Beruf Schwarzmarkthelfer, von Aussehen Kellner, seiner Behauptung nach ehemaliger Gutsbesitzer — irgendeiner hat das Dachbodenfenster herausgefeilt und weggetragen. Folge: der Lokus ist eingefroren und die Wasserleitung auch. Wasser kann man Gott sei Dank noch im Parterre kriegen, bei Stirrks, zwischen neun und zehn Uhr. Tessy holt es jeden Morgen in zwei Eimern. Denn ich wache immer zu spät auf. „Laß es mich nur machen“, sagte sie tröstend. „Ich habe da meine Vorteile. Stirrks sind gegen mich sehr zuvorkommend. Die anderen dürfen nicht.“
Nein ... wir andern huschen frierend in den Trümmern herum. Die Nebenhäuser scheinen alle ganz eingefroren. Aber es ist viel Platz zwischen den Trümmern.
„Du hast zwei Tage nicht geschrieben“, sagte Tessy heute nachmittag streng. „Du bist so faul wie damals in Wallberg.“
„Es hat keinen Zweck, Tessy, fleißig zu sein. Bis das Buch fertig ist und es wieder Papier gibt und die Druckmaschinen wieder laufen, sind meine Leser alle verhungert oder erfroren.“
„Damals in Wallberg hattest du tausend andere Entschuldigungen für deine Faulheit. Wie hält das ein erwachsener Mann nur aus ... immer nichts tun und vor sich hinstarren?“
„Ich mag nicht mehr, Tessy. Zweimal habe ich mir eine sogenannte Existenz aufgebaut. Zweimal hat man sie mir zertöppert. Was soll es?“
Tessy schnitt zwei Scheiben Brot ab und legte sie zum Rösten auf den Ofen. „Wärme als Aufschnitt“ nennt sie das. Sie schien ganz vertieft in das Rösten. Sie brach ein Stück von der Brotrinde ab und kaute es versonnen. „Was soll es, was soll es?“ sagte sie schließlich. „Entweder man stirbt dran. Das ist immer das Einfachste. Oder man stirbt nicht. Dann lebt man eben.“
„Bloß um ein bißchen später zu sterben. Nee ... was kann schon noch kommen für einen Deutschen? Du bist noch sehr jung, Tessy. Zweiundzwanzig.“
„Zweiundzwanzig war ich damals. Die Zeit schreitet schnell.“
„Also dreiundzwanzigeinhalb. Du kannst es eines Tages noch besser haben. Wir Endachtundvierziger ... da kommt nichts mehr.“
Sie reichte mir meine Scheibe Röstbrot. „Ihr habt schon ein ganz schönes Ende Leben geschluckt“, stellte sie sachlich fest. „Mit ziemlich viel Butter drauf. Was sollen wir da sagen? Bloß acht Jahre ohne Heil Hitler, und als für mich die Seidenstrümpfe anfingen, gab’s keine mehr. Was soll es? Ich weiß es auch nicht. Aber du mußt arbeiten. Meinetwegen schon.“
„Wenn ich noch soviel arbeite ... zu Seidenstrümpfen für dich langt es doch nicht“, sagte ich ausweichend. Denn ich wußte schon, worauf sie hinaus wollte, die durchtriebene Katze.
Sie hob entrüstet ihr Röstbrot und biß ein tüchtiges Ende ab. „Was gehn dich meine Seidenstrümpfe an? Noch hab ich außerdem ein Paar ganz gute und ein Paar verschiedene. Sieht man das eigentlich sehr?“ Sie schob ihren grauen Rock bis über die Knie hinauf.
„Sehr niedliche Beine hast du.“
„Ob man es sieht, daß der eine dunkler ist?“
„Der linke ist dunkler.“
„Falsch ... der rechte. Man sieht es also nicht. Und für dich lohnt es nicht, die guten zu strapazieren.“
„Nein. Ich bin eben kein Frauenheld wie ...“
Sie sprang auf und hielt mir den Mund zu. „Sprechen darfst du nicht über ihn. Schreibe, Künstler, rede nicht.“
Und indem sie mir ihre schmalen Arme um den Hals schlang, flüsterte sie mir flehend und sanft ins Ohr: „Ich kann doch nirgends anders hin.“
„Ich habe dir gesagt, daß du bleiben kannst“, sagte ich, wider Willen gerührt. „Laß die dramatischen Auftritte.“
„Wenn du nicht arbeitest, bin ich schuld. Dann muß ich gehn.“ Und, indem sie mich plötzlich losließ, wieder ganz in ihrer alten, frechen Tonart: „Siehst du, es gibt noch Frauen, die ein Gewissen haben. Lohnt zwar nicht. Ihr merkt’s gar nicht. Die Gewissenlosen ... an denen klebt ihr. Na ja, Eisen zieht Eisen an. Ist doch so?“
„Ist so. Wenigstens in der Physik“, sagte ich. „Aber wieso war ich gewissenlos? Das möchte ich gerne wissen. Ich habe niemals ...“
„Wer spricht denn von dir, armer Alter?“
Später packte sie ihre Handtasche, malte sich die Lippen sorgfältig und unter vielem Seufzen über die schlechte Qualität ihres Lippenstiftes, dessen mangelhafte Kußfestigkeit sie durch einen schmetterlingsartigen Abdruck auf meiner Stirn manifestierte, erbat sich den Hausschlüssel, weil es „in den Jagdgründen“ spät werden könne, denn das ersehnte Wild komme nicht auf Kommando ... und stapfte davon. Ich sah ihr nach, wie sie nachdenklich, und ab und zu wie ein junges Füllen über die Mauerbrocken hüpfend, durch die Trümmerstraße davonging. Dann wischte ich mir das Schmetterlingsmal von der Stirn, zögernder, als es seiner Lächerlichkeit zukam, und setzte mich an die Maschine.
Ich habe es ja gleich gewußt: die jetzige Tessy wird mir die frühere verdunkeln, und wenn ich weiter so viel über unsere gleichgültigen Schwätzereien berichte, werde ich die Geschichte von Manuela und Vittorio nie zu Ende schreiben, in der Tessy ja nur eine Nebenfigur ist.
Auf die Hauptfigur Manuela war ich natürlich an jenem ersten Abend sehr gespannt, und ich ging frühzeitig zu der verabredeten Einladung. Mein Zimmer lud auch nicht zum Bleiben. Es war ein winziges Abstellzimmer beim Bauern Dirrmoser, in dem der Kleiderschrank mit den Sonntagssachen, die Truhe mit dem Leinenzeug und eine Vitrine mit Glassachen so viel Platz einnahmen, daß gerade noch das Bett mit den plumpen, vertrauenerweckenden Pfühlen hineingestellt werden konnte. Es war zum Ersticken.
Ganz anders bei Manuela und Vittorio. Sie hatten ein sehr großes Wohnzimmer, in dem allerlei Mobiliar stehngeblieben war: eine alte Bauerntruhe, ein roher, großer Eichentisch, ein Sessel, wahrscheinlich sehr häßlich überzogen und von Manuela mit einem bunten Bauerntuch voll großblütiger Rosen verdeckt, fünf recht angenehme Holzstühle. Eine Matratze stand in einer Ecke, bedeckt mit einer wundervollen, weichen Pelzdecke, grau und weiß gefleckt, ich weiß nicht, was für einem Tier abgezogen. Das ganze Zimmer, etwa dreißig Quadratmeter groß, war mit einem schönen Smyrna ausgelegt, der seinerseits unter zehn oder zwölf herrlichen Brücken ertrank. Ich versank fast bis zum Knöchel in dem dicken Gewebe und ging lautlos, von Vittorio lärmend begrüßt, auf Manuela zu, die auf der Couch saß, ein Bein untergeschlagen und nur das andere vorweisend. Es war kostbar bestrumpft und stak in einem braunen Wildlederschuh mit breiter, geriffelter Gummisohle. Es schien mir damals, als wolle sie den unvorbereiteten Zuschauer nicht gleich mit beiden Beinen in Verwirrung setzen. Denn in der Tat, es waren, nach Marlene Dietrichs Beinen, derentwegen ich mir so um 1928 eine völlig alberne Revue in Berlin fünfmal angesehn habe, die schönsten, geradesten, lieblichsten Beine (Was gibt es noch für Superlative? Keine, die mir im Moment einfallen. Was ist die Sprache doch für ein armseliges Instrument!), die erregendsten, die vollkommensten Beine der Welt. Sie selbst? Lieber Himmel, wie sollte ich nach allem, was ich über sie gehört hatte, nicht enttäuscht sein? Ich war auch voreingenommen. Ich wünschte nicht, daß sie mir gefiele. Aber es war auch nichts Besonderes an ihr zu entdecken. Ein rundliches, eher durchschnittliches Gesicht, pfirsichglatt und pfirsichfarben, nur wenig geschminkt, bis auf die Lippen, die, von Natur ein bißchen dick, fast immer wie zum Kuß etwas vorgeschoben waren, und die sie fraisefarben, mit einem Stich ins Gelbliche, glänzend lackiert hatte. Die Backenknochen stark und ein prächtiges Gebiß verratend. Das Haar, von einem angenehmen Nußbraun, etwas grob wie Pferdehaar, war schlicht gescheitelt und zu einem Knoten im Nacken zusammengefaßt. Und um das Madonnenhafte noch zu verstärken, trug sie — an diesem Abend — einen schmalen Goldreif im Haar, in der Art, wie ihn — freilich aus Messing — in meiner Jugend die Wandervögel getragen hatten. Nein ... sie gefiel mir nicht besonders. Die Art, wie sie mich begrüßte, war geziert damenhaft und verriet, daß sie stolz war, die gesellschaftlichen Formen erlernt zu haben. Sie sprach freundlich und überaus lebhaft auf mich ein, als freue sie sich tatsächlich, mich kennen zu lernen. Dabei war ich — als einfacher Redakteur, keine Verbindung, auf die es im Augenblick ankam, als Mann nicht in Frage kommend — ihr völlig gleichgültig. Ich mochte auch ihre Stimme zuerst nicht. Sie war merkwürdig tief, durch vieles Rauchen rauh geworden und recht eintönig. Erst später mochte ich die Stimme recht gern. Eine Hafenstimme? Nein. Aber eine gleichmütige Stimme, gleichförmig wie Wasser, das in einen Holzbottich fließt, ohne Resonanz also.
Sie entschuldigte sich, daß sie sich nicht umgezogen habe. Die Koffer auszupacken sei sie zu müde gewesen. So müsse man mit ihrem Reisekostüm vorlieb nehmen, dem braunen Rock, dem kirschroten Pullover, der grasgrünen Wildlederjacke. Wildleder ... das war ihre Leidenschaft, kühl, weich und auch in den grellsten Farben noch dezent. Sie selbst ein ungezähmtes, freischweifendes Wild, den Jäger lockend und foppend. Aber nein ... das ist ein Urteil von jetzt her. Damals, an jenem ersten Abend in Wallberg, ging sie mir eigentlich auf die Nerven. Sie war mit ihrem Geziere und Getue, mit ihrem gurgelnden, mühsam ins Hochdeutsche geschliffenen Bayrisch durchaus nicht mehr als die hübsche Tochter eines kleinen, stockkatholischen Beamten aus Ingolstadt. Spernser behauptete, ihr Vater sei Fleischbeschauer. Aber das war Tücke. Er war beim Zoll oder beim Finanzamt irgendeiner der unzähligen Obersekretäre oder Inspektoren, die, weil sie die Möglichkeit haben, kleine Leute zu schikanieren, sich im Laufe ihres Lebens einen albernen Machtdünkel zuzulegen pflegen. Das Katholische an Manuela hielt ich zunächst für Modesache. Damals, als der Hitlerismus in den letzten Zügen lag, gebärdeten sich viele katholischer, als sie waren. Man konnte seine Opposition gegen die Nazis als Glaubenssache gleichzeitig tarnen und zeigen. Aber sie war tatsächlich — wie ich später merkte — strenggläubig, auf ihre Weise natürlich, jene naturhaft-bäurisch-bayrische Weise, die in der Beichte und Absolution immer wieder eine Vergebung der Sünden zu erlangen glaubt, auch wenn gar nicht daran gedacht wird, die Kette der immer gleichen Sünden jemals zu unterbrechen.
Wir hatten gleich einen kleinen Streit über ein paar Kruzifixe, die die weißen Zimmerwände schmückten, primitive, grell angestrichene Bildwerke, und ein paar Unterglasmalereien, die die Leiden des heiligen Sebastian mit Blut und Speeren schilderten. Ich fand — die beiden fragten mich danach –, daß diese Gebilde nicht recht zu den Perserteppichen passen wollten, nicht zu Vittorio und Manuela, den hypereleganten Berliner Bohemiens. Aber sie beteuerten beinahe leidenschaftlich, daß sie viel eher in dieses katholische Dorf paßten als nach Berlin, daß ihnen Heilige und Märtyrer näher stünden als die Perserteppiche und daß ich als Ungläubiger besser täte, Dinge, die ich nicht begreifen könne und die jetzt gerade wieder zu einer erstaunlichen Macht heranreifen würden, als außerhalb meines Horizontes stehend in Ruhe zu lassen. Ehe ich auf diese hochnäsige Zurechtweisung antworten konnte, kamen die andern, Willigrodt, der einarmige, einäugige, Tellermann mit dem Häschen, Fräulein Schröder, verlegen ihren Goldzahn entblößend, Spernser mit Herma Zacke und Didi Seifert, die weit ausgeschnittene Abendkleider trugen und die nackten Arme fast von oben bis unten mit Armbändern gepanzert hatten, und schließlich Direktor Kölle, ein Telegramm im Busen, das uns alle zu angespannter Arbeit aufforderte. Ich sollte z. B. eine Aufsatzreihe „Die Kultur nach dem Siege“ vorbereiten und darin allen Künstlern die lockenden Aufgaben in einem unter dem Hakenkreuz geeinten Europa schildern. Die anderen bekamen auch ihre Hausaufgaben und diskutierten nicht weiter darüber. Kölle übrigens auch nicht. Mit der Befehlserteilung hatte er ja seine Pflicht getan.
Es wurde dann ein krampfhaft munterer Abend. Alle waren sehr müde. Man hörte ein paarmal Fliegergeschwader über den Bayrischen Wald ziehn, feindliche natürlich. Die deutschen hatten keinen Benzin mehr und standen gut gegen Sicht gedeckt in den Schluchten und Wäldern. Unten in Rönitz ertönten die Sirenen zum ersten Male. Wir spürten alle das Unheil schnell näher kommen. Aber keiner sprach ein Wort darüber. Manuela war eine geschickte Wirtin. Sie schenkte eifrig ein, reichte Zigaretten und Keks und ließ keinen der Gäste ohne ein liebenswürdiges Wort, ein Lächeln, einen freundlichen und festen Blick, der wohl jeden (außer mir) in den Glauben versetzte, daß er einen ganz kleinen Vorzug in ihrem Herzen oder in diesem ihrem Zimmer einnähme. Vittorio strahlte. Er fand es herrlich, daß „wir“ alle wieder zusammen seien. Aber er meinte natürlich nur sich selbst und Manuela. Alle andern waren ihm völlig gleichgültig. Oder war Manuela ihm auch ein wenig gleichgültig, und liebte er sie nur, wie ein schöner Mensch eben seinen Spiegel liebt, der ja auch schön und klar sein muß? Ich glaube es jetzt beinah. Sonst ist von diesem Abend, den ich frühzeitig und etwas enttäuscht verließ, nichts zu melden.