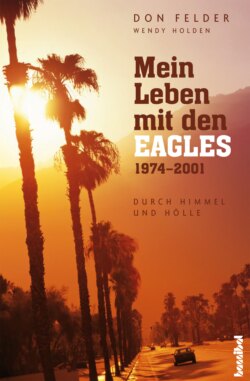Читать книгу Mein Leben mit den Eagles - Wendy Holden, Don Felder - Страница 10
ОглавлениеFÜNF
Der Sommer endete, und mit ihm mein Traum – Susan musste nach Bos-ton zurückkehren. Wir waren immer noch unsterblich ineinander verliebt, aber ein Teil von ihr sehnte sich danach, wieder nach Hause zu kommen. Sie vermisste das nördliche Wetter, die tausend Farben des Herbsts und die langen, kalten Winter. Außerdem hatte sie sich an einem angesehenen College für Mädchen eingeschrieben und freute sich schon auf die nächste Phase ihrer akademischen Laufbahn. So betrachtet, hätten wir unterschiedlicher nicht sein können.
Als sie die Stadt verließ, saß sie vorn im Auto ihres Bruders Bill. Ich dachte, ich müsste sterben, so sehr schmerzte es. In einem Zeitraum von wenigen Monaten hatte ich meine erste große Liebe und meinen besten Freund verloren und darüber hinaus den Kontakt zu meinen Eltern vollständig abgebrochen. Ich konnte es kaum fassen, dass mir so viel Unheil auf einmal widerfuhr.
Ich war nur selten aus Florida rausgekommen – abgesehen von ein paar Ausflügen nach Oklahoma und Washington in meiner Kindheit und ein paar Auftritten in New York. Nun hingegen reiste ich, so oft ich konnte, nach Boston. Ich nahm den Bus oder fuhr bei Bill mit, wann immer es ihn heimwärts zog. Einmal kratzte ich sogar genügend Geld zusammen, um mir einen Flug leisten zu können. Es war das erste Mal, dass ich mit dem Flugzeug flog, einer DC-3-Spornradmaschine, und es erschien mir wie ein Wunder, über Amerika hinwegzufliegen, anstatt zu fahren. Bis ich wieder nach Hause fliegen musste, hatten Susan und ich viel Spaß in Massachusetts, und es gelang uns, dort anzuknüpfen, wo wir uns verabschiedet hatten. Die erneute Trennung jedoch fiel uns dafür umso schwerer.
Wieder allein in Gainesville, veränderte sich alles. Ich war achtzehn Jahre alt und fühlte mich von allem abgeschnitten. Das Maundy Quintet löste sich auf, als Tom Long aufs College ging und mich mit einem Schlagzeuger und dem Bassisten Barry zurückließ. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte ich keine Band und war eine Zeit lang vollkommen orientierungslos.
Meine Liebe zu Susan stand aufgrund der Entfernung zwischen uns unter einem entsetzlichen Druck. Nach mehreren Monaten, in denen ich hin- und herreiste und versuchte, die Beziehung aufrechtzuerhalten, gestand ich mir ein, dass es keinen Sinn hatte.
„Es funktioniert einfach nicht“, sagte ich ihr in einem Ferngespräch. „Es sei denn, einer von uns ist bereit, dorthin zu ziehen, wo der andere lebt, und das wird nicht passieren.“ Ich glaube, ich brach ihr das Herz und meines auch, aber ich wusste, dass wir keine Zukunft hatten. Als ich den Hörer auflegte, dachte, ich würde sie niemals wiedersehen und nichts mehr von ihr hören.
Ich erteilte immer noch Gitarrenunterricht für Jugendliche und hatte auch noch eine Reihe anderer Jobs, konnte mich jedoch nicht entscheiden, ob ich wieder zur Schule gehen sollte oder nicht. Meine Eltern und Jerry drängten mich, aufs College zu gehen und einen Beruf zu erlernen, aber ich dachte, damit würde ich alles verraten, was ich bisher zu erreichen versucht hatte. Wie auch immer ich mich entschied, ich wusste, dass ich unbedingt Musik machen wollte, weil dies das Einzige war, worin ich mich für einigermaßen begabt hielt.
Ein Typ namens Paul Hillis, der ebenfalls bei Lipham’s als Musiklehrer arbeitete, war gerade nach zwei Jahren am Berklee College of Music aus Boston zurückgekehrt. Er war sechs Jahre älter als ich, ein exzellenter Gitarrist, der sich vor allem in Jazztechniken bestens auskannte. Als er zurückkehrte, konnte ich es kaum erwarten, ihn spielen zu hören und zu sehen, was er gelernt hatte. Zu meiner großen Überraschung jedoch hatte er das Instrument gewechselt. „Die Gitarre ist so begrenzt“, erklärte er abfällig. Er behauptete, auf einem Klavier ließe es sich leichter komponieren, und auch Harmonielehre und Theorie verstünde man besser.
Er eröffnete in Gainesville die Paul-Hillis-Musikschule, und ich schrieb mich dort ein, um von ihm Jazztheorie und Komposition zu lernen. Im Gegenzug unterrichtete ich dafür seine neuen Gitarrenschüler. Für jede Stunde, die ich für ihn arbeitete, widmete er mir eine Stunde seiner eigenen Zeit. In weniger als sechs Monaten lernte ich, was man ihm auf dem Berklee College of Music in zweieinhalb Jahren beigebracht hatte. Ich verinnerlichte jede noch so kleine Information.
Über bei den Verbindungskonzerten geknüpfte Kontakte und Freunde in der Musikszene sprach mich eine in Ocala ansässige junge Band namens Flow an. „Steig bei uns ein“, sagten sie. „Wir haben das Maundy Quintet gehört und kennen deine Arbeit. Wir brauchen einen richtig guten Leadgitarristen.“ Die Band bestand aus drei Musikern: dem Schlagzeuger Mike Barnet, dem Keyboarder und Sopransaxofonisten John Winter sowie dem Sänger und Bassisten Jack Newcomb.
Flow waren zweifellos das, was mein Vater eine Hippieband genannt hätte. Sie hatten sich auf eine freie Form des Jazzrock spezialisiert und rauchten eine Unmenge Gras. Ich musste jedes Mal nach Ocala fahren, um mit ihnen zu proben. Um zwei Uhr nachmittags waren sie oft noch im Bett, entweder bekifft oder weil sie sich noch von der vorangegangenen Nacht erholen mussten.
Ihr gemietetes Haus strotzte vor Dreck. In der Spüle türmte sich schmutziges Geschirr, das nie jemand abzuwaschen schien. Sie waren totale Kiffer, aber auch gute Musiker. Wenn wir uns trafen, spielten wir richtig gut zusammen. Sie lebten wirklich für die Musik. Dabei ging es ihnen nicht so sehr um großartige Songs und deren Vermarktung wie bei den Beatles. Vielmehr wollten sie rockig-poppige Songs schreiben und dazu den Rahmen nutzen, den Jazzmusiker bei ihren Improvisationen verwendeten – ein freier Fluss kreativer Energien, wie sie es nannten.
Wir sangen zunächst ein paar Strophen und einen Refrain und gingen dann in der Mitte des Stücks in einen freien Soloteil über, der irgendwo zwischen einer und fünf Minuten dauern konnte, je nachdem, wie gut es eben lief. Dann nahmen wir die Spannung wieder etwas heraus, sangen noch eine Strophe und einen Refrain, und das war’s dann. Es war perfekte Drogenmusik, aber mit einem moderneren Sound, als ihn eine Jazzband hatte. Für die damalige Zeit war das ziemlich innovativ. Das Beste daran war aber, dass man jedes Mal wieder aufs Neue ins kalte Wasser geworfen wurde, bildlich gesprochen.
Zwei ihrer Freunde waren die Tourneemanager der Young Rascals, die mit dem Song „Good Lovin’“ einen großen Hit gelandet hatten und in der Ed Sullivan Show aufgetreten waren. Sie hatten versprochen, aus New York herzukommen und sich Flow einmal anzuhören, wenn wir uns dazu bereit fühlten. Ich war hinzugenommen worden, um der Gruppe mehr Profil zu verleihen. Dafür konnte ich mich auf einer kreativen Spielwiese austoben: Jeden Abend, jedes Mal, wenn ich spielte, hatte ich Gelegenheit, zu improvisieren. Unter Anwendung von allem, was mir Paul Hillis über das Melodiespiel beigebracht hatte, lernte ich, spontan zu spielen und frei zu denken, ohne jede Befangenheit oder Angst. Anfangs war ich noch sehr unsicher, doch als ich erst einmal oft genug ins kalte Wasser gesprungen war, fühlte ich mich im Umgang mit den Mitteln, die mir zur Verfügung standen, recht wohl. Jemand spielte einen Rhythmus, und ich legte einfach los. Manches von dem, was ich spielte, war ganz in Ordnung, manches war klasse. Es gab einen konstanten kreativen Fluss. Je freier ich wurde, desto mehr gewann ich an Selbstvertrauen. Es war für meine spätere Arbeit als Songwriter und Arrangeur ungeheuer hilfreich.
Nun, da Susan und Bernie fort waren und niemand diese Lücke füllte, hätte ich leicht aus der Bahn geraten können, insbesondere, da die Band so viel Gras rauchte. Aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht ganz verstanden habe, hatte ich zum Glück jedoch nur ein geringes Suchtpotenzial. Zwar rauchte ich ab und zu gern ein bisschen Gras, aber ich hörte immer rechtzeitig auf, wenn ich das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren. Ich hatte eine Reihe paranoider Erlebnisse gehabt und in den Straßen von New York auch Heroinabhängige herumliegen sehen. Soweit ich das beurteilen konnte, machte das Marihuana meine Bandkollegen nur unmotiviert und lethargisch. Ich kann mich nicht entsinnen, dass einer von ihnen jemals einer geregelten Arbeit nachging. Außerdem hatte ich immer noch einen Heidenrespekt vor dieser ganzen Drogengeschichte. Ein schöner Rock ’n’ Roller war ich!
Oft lief ich mit griesgrämiger Miene umher, vermisste Susan und zerfloss in Selbstmitleid. Ich traf mich mit ein paar Mädchen, aber nichts war auch nur annähernd so aufregend wie zwischen Susan und mir. Eines der Mädchen trug den ungewöhnlichen Namen Season Hubley. Sie kam von New York nach Gainesville, um Freunde an der Uni zu besuchen. Sie war das erste Mädchen seit Susan, das ich wirklich mochte, und ich dachte, es könnte vielleicht etwas laufen, aber sie schien sich nicht für mich zu interessieren. Sie war nur auf der Durchreise. Dann stellte mich Susans Bruder Bill der Zimmergenossin seiner Freundin, Jan Booty, vor. Jan, eine Diplomatentochter, war für länger hier, da sie in Gainesville Kunst studierte. Sie war sehr kreativ, und ich mochte das sehr an ihr. Schließlich zogen wir für eine Weile zusammen. Wir teilten uns ein Haus mit einem anderen Paar, Barry und Patti, und Jans zwei Hunden, Rhythm und Blues. Als ich schon eine Weile mit Jan zusammenlebte, kam Jerry zu Besuch.
Seit er verheiratet war, hatten wir kaum noch Kontakt zueinander. Er arbeitete in einer kleinen Anwaltskanzlei in Gainesville, und wir hatten nicht besonders viel gemeinsam. Nun jedoch, da ich in Sünde lebte, hielt er es für seine Pflicht, mir mitzuteilen, was er über mich dachte. Ich habe immer den Verdacht gehegt, dass ihn Papa dazu angestachelt hatte.
„Was zum Teufel machst du mit deinem Leben, Don?“, fragte er mich und verzog das Gesicht. Er war erst fünfundzwanzig, doch in Schlips und Kragen wirkte er viel älter. „Mir kommt es so vor, als ob du deine Zeit verschwendetest.“ Bevor ich noch antworten konnte, ließ er sich über alles aus, was ich in seinen Augen falsch machte: Meine Ansichten über den Vietnamkrieg seien unpatriotisch, meine Verbindungen zu Demonstranten, Musikern und Drogenkonsumenten höchst fragwürdig, meine Moral- und Wertvorstellungen völlig aus der Spur. Seiner Meinung nach steuerte ich auf eine Katastrophe zu. Er hielt mich für einen hoffnungslosen Fall und ließ mich das wissen.
Wir fingen einen Riesenstreit an, in dessen Verlauf ich vieles sagte, von dem ich wusste, dass ich es später bereuen würde. „Du bist ja schlimmer als Papa“, warf ich ihm vor. „Du hast dich so lange angepasst, dass du vom wirklichen Leben gar keine Ahnung hast. Was willst du als Nächstes tun, Jerry? Deinen Gürtel herausziehen und mich schlagen?“
Schließlich verließ er angewidert das Haus, doch nicht bevor wir beide gesagt hatten, was uns schon lange auf der Zunge lag. Als ich ihn gehen sah, bezweifelte ich, dass wir je wieder miteinander sprechen würden. Es schien, als ob sich alle, die mich liebten, früher oder später von mir abwendeten.
Die Musik rettete mich vor der Traurigkeit, die sich auf mein Leben gelegt hatte. Sowohl die Arbeit mit Flow als auch Barry, der Ehemann des Paars, mit dem Jan und ich uns das Haus teilten, weckten bei mir zum ersten Mal ein Interesse für Jazz. Barry stammte aus New York und war süchtig nach Jazz, der bei ihm scheinbar pausenlos lief. Durch seinen Einfluss begann ich, diese Musik genauer anzuhören. Ich vertiefte mich in das Jazzgitarrenspiel, lernte bestimmte Soli und fand Geschmack an Leuten wie Sonny Rollins und Django Reinhardt. Bald begann ich, die Gitarre in einem ganz anderen Licht zu sehen. Country, Rock ’n’ Roll und Bluegrass klangen im Vergleich mit etwas so Komplexem und Intellektuellem ziemlich archaisch. Nachdem ich bei Paul so viel Theorie gelernt hatte, schien Jazz auf einmal genau das Richtige.
Eines Freitagmorgens hörte ich gerade eine Platte von Mel Bay, während Barry laut aus der Village Voice vorlas, die er sich mit der Post aus New York schicken ließ, da es so gut wie unmöglich war, diese Zeitschrift in Gainesville zu bekommen.
„O mein Gott“, sagte Barry und setzte sich plötzlich auf. „Miles Davis spielt morgen Abend im Village Gate.“
Ich hatte zwar von Miles Davis gehört, doch hatte ich noch nie jemanden live Jazz spielen hören – außer vielleicht in der Bar des Holiday Inn, und auch da war es nur Filmmusik gewesen.
„Miles Davis?“, fragte ich unschuldig.
„Nur einer der besten Jazzmusiker der Welt!“, rief Barry ungläubig und starrte mich einen Augenblick lang schweigend an. Dann fügte er autoritär hinzu:
„Pack deine Sachen. Wir fahren hin.“
Es hatte keinen Zweck, mit ihm zu streiten, also schnappten wir uns jeder ein paar saubere T-Shirts und eine Zahnbürste, tankten seinen VW voll und brachen auf. Wir fuhren nonstop und schliefen abwechselnd. Die Fahrt dauerte über sechzehn Stunden. Als wir in Manhattan ankamen, mieteten wir ein Zimmer in einem heruntergekommenen, billigen Hotel, nahmen eine Dusche, zogen frische T-Shirts an und bestiegen ein Taxi ins Greenwich Village. Wir betraten das Village Gate und nahmen ziemlich weit vorn Platz. Ungefähr zwanzig Minuten später stand die Band, über die wir am Morgen zuvor in Gainesville gelesen hatten, vor uns auf der Bühne.
Diese Musiker machten mich fertig. Die Finesse, die Improvisation und die Freiheit in ihrer Kunst – etwa in Stücken wie „Bitches Brew“ – waren unglaublich. Es war eine der spektakulärsten Besetzungen, die Miles Davis jemals hatte: Er selbst spielte Trompete, der erst siebzehnjährige Tony Williams Schlagzeug, Herbie Hancock Klavier, Wayne Shorter Tenorsaxofon und Ron Carter Bass.
In der Mitte der zweiten Konzerthälfte machte Miles Davis eine Pause und setzte sich an einen Tisch bei den Toiletten, um ein Bier zu trinken. Es gab keine Garderobe und auch sonst keine Rückzugsmöglichkeit für ihn. Ich war entschlossen, zu ihm hinzugehen und ihm zu sagen, wie sehr mir seine Musik gefiel, und setzte mich in Bewegung. Als ich nur noch ein paar Schritte von ihm entfernt war, sah er mich mit einem durchbohrenden Blick an, als wolle er sagen: „Komm ruhig näher, Junge, dann fresse ich dich bei lebendigem Leib.“ Also ging ich einfach an ihm vorbei und auf die Herrentoilette.
Dort drinnen starrte ich mich in dem zerbrochenen Spiegel an und nahm meinen ganzen Mut zusammen. „Ich muss es ihm sagen, ich muss es ihm sagen“, wiederholte ich es wie ein Mantra . Als ich wieder herauskam, wild entschlossen, ihm die Hand zu schütteln wie damals B. B. King, war er natürlich längst weg.
Jenes Konzert war vermutlich eines der prägendsten Erlebnisse meines ganzen Lebens. B. B. King hatte mich mit seinem Rhythm and Blues vom Stuhl gerissen, aber das Konzert im Village Gate war zweifellos mein stärkster Jazzeinfluss, ein Ereignis, das mir zeigte, wozu richtige Musiker in der Lage waren. Die Fingerfertigkeit, das Repertoire und die Dynamik bildeten ein ganz eigenes, noch viel komplexeres Genre für sich. Das war abermals ein ganz anderes Niveau, eine neue Herausforderung für mich. Ich war zu dieser Zeit bereits ein großer Jazzfan und spielte ihn auch mit Flow. In jener Nacht im Hotel tat ich kaum ein Auge zu und ließ den Auftritt wieder und wieder vor meinem geistigen Auge Revue passieren. Am nächsten Morgen fuhren Barry und ich in andächtigem Schweigen nach Hause.
Kurz darauf lag ich an einem sonnigen Sommernachmittag gerade mit Jan im Bett und schaute zu, wie sich die Vorhänge sanft im Wind blähten, als im Radio ein Song kam. Ich setzte mich auf, hörte genauer hin und erkannte die Stimme sofort. Der Moderator sagte, dass die Nummer „For What It’s Worth“ heiße und von Buffalo Springfield sei, aber ich wusste Bescheid. Die Stimme, die ich gerade gehört hatte, gehörte Stephen Stills, dem Ausreißer mit dem Militärhaarschnitt, der bei den Continentals gespielt hatte.
„Wow!“, dachte ich und lehnte mich mit einem Lächeln in die Kissen zurück. „Er hat’s geschafft! Das ist wirklich toll. Vielleicht gelingt mir eines Tages auch so etwas.“
Der Song wurde zur Hymne einer ganzen Generation junger Leute, die landesweit gegen das Establishment rebellierten. Jedes Mal, wenn ich ihn hörte, dachte ich an Stephen und lächelte. Anders als er und Bernie war ich jedoch noch nicht bereit, meine musikalische Karriere auf Kosten von allem anderen zu verfolgen.
Im Herbst 1968 waren Flow bereit für das Probekonzert in New York. John Calagna und Andy Leo, die beiden Tourmanager, waren nach Florida gekommen, um uns zu hören, und was sie hörten, gefiel ihnen. Sie dachten, sie hätten durch ihre Freundschaft mit Mike und John die Band „entdeckt“ und könnten uns nun über ihre Beziehungen zu den Young Rascals ins Geschäft bringen. Sie hatten Recht. Es war sicherlich der beste Kontakt zu einem Prominenten, den wir seit The Cyrkle gehabt hatten.
Der Auftritt sollte in einem kleinen Club in Manhattan stattfinden, dem Fillmore East. Die Gebrüder Allman hatten dort kurz vor uns gespielt. In Sachen Erfolg preschten sie uns voran. Duane hatte sich einen Namen als hervorragender Studiomusiker gemacht, sie hatten in L. A. ein Album aufgenommen und den Namen Allman Joys zugunsten von The Hourglass aufgegeben. Über Freunde in Daytona und Gainesville blieben sie jedoch mit uns in Verbindung, und wir wünschten einander alles Gute.
Mit geliehenem Equipment von den Young Rascals fuhren wir in einem Lieferwagen von Florida nach New York und bauten unsere Sachen auf der Bühne auf. Die Tourmanager hatten ein paar Leute aus der Plattenindustrie zu dem Konzert eingeladen. Unter ihnen war auch Creed Taylor, eine Legende im Musikgeschäft, der schon mit Stan Getz gearbeitet und gerade das phänomenale Quincy-Jones-Album Walking In Space produziert hatte. Er war unser Mann.
Wir waren eine von drei Bands, die an jenem Abend vor etwa fünfhundert Zuschauern spielten, in einem neuen und relativ unbekannten Club. Ich wusste, dass Hendrix dort einmal aufgetreten war, und hatte in der Vergangenheit ein Konzert von Paul Butterfield und einem monströsen Bluesgitarristen namens Buzzy Feiten besucht. Es war also durchaus beeindruckend, nun tatsächlich selbst dort zu sein. Glücklicherweise spielten wir an jenem Abend richtig gut, und als der Gig vorüber war, kam Creed Taylor zu uns in die Garderobe.
Creed war in mittleren Jahren, trug eine Wildlederjacke mit Flicken an den Ärmeln und strahlte Ruhe aus. „He, Jungs, das hat mir gut gefallen, was ich da heute Abend gehört habe“, sagte er zu uns. „Ihr wart klasse. Ich bin bereit, euch einen Plattenvertrag über fünftausend Dollar anzubieten. Was meint ihr dazu?“
So viel Geld hatten wir noch nie verdient. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Nach einem hastig einberufenen Treffen mit den Tourmanagern nahmen wir das Angebot sofort an und unterschrieben noch am nächsten Tag. Trotz aller Bedenken, die ich hatte, Gainesville zu verlassen, fand ich mich ein paar Monate später mit einem Plattenvertrag in der Tasche im Big Apple wieder. New York war irgendwie weniger Furcht einflößend als Kalifornien. Ich war bereits ein paar Mal dort gewesen. Ich konnte in weniger als vierundzwanzig Stunden nach Hause fahren, und außerdem war ich sowieso viel zu gespannt auf die Zukunft, um mich noch zu fürchten.
Unser Fünftausend-Dollar-Vorschuss reichte weniger als einen Monat. Wir leisteten eine Anzahlung auf einen Lieferwagen von Dodge – das war der Einzige, bei dem wir uns die Ratenzahlungen überhaupt leisten konnten. Dann kauften wir uns jeder einen warmen Mantel und ein paar Mikrofone für unsere Beschallungsanlage. Der Rest ging für Gras, Essen, Zigaretten und Jack Daniel’s drauf.
Da wir nun bei Creed Taylor Incorporated (CTI) unter Vertrag standen, mieteten wir eine kleine Wohnung in der Horatio Street an der Lower West Side. Sie lag im Fleischereibezirk, der damals keine besonders gute Wohngegend war. Einmal hätte man mich fast mit gezücktem Messer auf offener Straße ausgeraubt, und ein Freund, der zu Besuch kam, wurde von einem anderen Räuber mit einem Brett auf den Hinterkopf geschlagen.
Die Tourmanager halfen uns beim Songschreiben und Proben und organisierten ein paar Auftritte in der Stadt, um uns in Lohn und Brot zu halten. Die Young Rascals wurden unsere Sponsoren. Nach „Groovin’“ und „A Girl Like You“ hatten sie noch einige weitere Hits gehabt und gaben uns nun ein paar von ihren alten Instrumenten und liehen uns eine PA, damit wir in Clubs spielen konnten. Dino Danelli stiftete ein Schlagzeug, Felix Cavaliere eine Hammond B3, und Gene Cornish gab mir eine seiner Gitarren, eine dicke elektrische Gibson.
Als Teil einer Band mit einem Plattenvertrag in New York zu leben war gut und schön, aber meine Begeisterung wurde durch die Tatsache gedämpft, dass meine Mitmusiker ziemlich lethargisch waren und exzessiv Drogen konsumierten.
Zuvor war ich stets die treibende Kraft gewesen, hatte die Auftritte gebucht und Kontakte geknüpft. Ich war genauso Manager wie Musiker. Doch der Vertrag mit der Band war über John und Mike zustande gekommen, nicht durch mich. Die übrigen Jungs dachten offenbar, dass sie nicht viel tun müssten, weil die Tourmanager sie ohnehin zu Stars machen würden. Ich fühlte mich irgendwie hilflos, weil ich nichts an dieser Situation ändern konnte. Wir lebten in einem beschissenen Apartment, hatten kein Geld, und keiner von ihnen tat jemals etwas, außer Musik zu spielen. Jan und ich hatten uns aufgrund der Entfernung getrennt, und ich fühlte mich immer einsamer und elender.
Wann immer Bernie in die Stadt kam, wurde meine Frustration noch verstärkt. Er und ich waren in Kontakt geblieben, und bei ihm lief alles sehr gut. Als er damals nach Kalifornien zurückgekehrt war, hatte er sich zunächst als Banjospieler und Gitarrist einer Folkrockband namens Hearts & Flowers angeschlossen und war auch auf dem zweiten Album der Gruppe vertreten. Durch seinen alten Freund Chris Hillman hatte er Gene Clark von den Byrds und den legendären Banjospieler Doug Dillard kennengelernt. Bernie war zudem an der Gründung der Gruppe Dillard & Clark beteiligt gewesen, bevor er sich den Corvettes anschloss, der Begleitband von Linda Ronstadt. Diese ging auf Tournee, um für ihr erstes Soloalbum, Hand Sown … Home Grown, zu werben, das sie nach ihrem Ausstieg bei den Stone Poneys veröffentlicht hatte.
„Du musst mit mir in den Westen kommen, dort geht es wirklich ab, Mann“, sagte Bernie jedes Mal zu mir, wenn wir einander begegneten. Wenn er irgendwo auftrat, trafen wir uns meist in der Garderobe, jammten ein bisschen und tranken ein paar Bier. „Ich habe ein paar tolle Kontakte geknüpft, und ich bin sicher, dass ich dich unterbringen kann.“
„Danke, Bernie“, sagte ich dann stoisch. „Aber ich möchte erst noch ein Weilchen hierbleiben und sehen, wie es mit Flow so läuft. Wir haben jetzt einen Plattenvertrag, und ich wäre doch verrückt, würde ich jetzt abspringen. Außerdem habe ich kein Geld, geschweige denn ein Auto. Und wie soll ich mich denn ohne fahrbaren Untersatz in L. A. vom Fleck bewegen?“
Als schließlich die Zeit gekommen war, dass Flow ins Studio gingen, um ihr erstes Album aufzunehmen, waren wir alle ziemlich nervös. Creed Taylor buchte ein Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Der Raum, den wir benutzten, war rund und sollte natürliche Klangeigenschaften besitzen. Der Studiobesitzer und -betreiber war Rudy van Gelder, ein Deutscher, der von Beruf eigentlich Optiker war und sich als Toningenieur einen ungeheuren Ruf erarbeitet hatte. Er hatte Aufnahmen mit Miles Davis, John Coltrane und Thelonious Monk gemacht, und man sagte, er wäre für den typischen Blue-Note-Sound verantwortlich. Er hatte die besten Neumann-Mikrofone und Acht-Spur-Aufnahmegeräte auf dem neuesten Stand der Technik, mit Mischpulten und Equalizern. Er saß in seiner Kabine und bediente die Regler wie ein verrückter Wissenschaftler. Er trug sogar weiße Handschuhe, wenn er seine ganz sterilen, perfekten Hi-Fi-Aufnahmen machte.
Eines Tages nahmen uns Andy und John ins Atlantic-Studio mit und erlaubten uns, dabei zuzuhören, wie die Young Rascals ihre neueste Single aufnahmen. Man kannte einander gut, und die Atmosphäre war entsprechend entspannt. Als wir eintrafen, spielten sie gerade die letzte Version ein, und wir standen am Eingang des Studios und hörten ihnen zu, wie sie „It’s A Beautiful Morning“ aufnahmen. Es gefiel mir sofort. Das Stück klang richtig gut, sogar Bongos waren dabei. Ich fragte mich, ob es wohl ein Hit werden würde. Als wir an der Reihe waren und unsere Sachen im Englewood-Cliffs-Studio aufbauten, waren wir sehr nervös. Es war unsere erste richtige Aufnahme, und wir standen unter immensem Druck. Das Studio wirkte fast wie eine Klinik: Ein Mann im weißen Kittel rannte herum, und überall standen die neuesten Hightechgeräte. Creed kam herein und nahm im Regieraum Platz, wo er alles überblicken konnte, und machte den Eindruck, als wolle er gleich eine Pfeife hervorziehen und sie rauchen. Er sagte kein Wort. Es gab keinerlei musikalische Beschränkungen, nichts.
Plötzlich wurde mir zu meinem großen Unbehagen klar, dass es nicht Creed Taylor oder Rudy van Gelder waren, die all diese legendären Aufnahmen machten, sondern die Künstler selbst. Ich war nicht der Einzige, der Schmetterlinge im Bauch hatte. Wir begannen zu spielen, doch konnte man hören und spüren, dass es eine Darbietung unter Zwang war. Es war wie ein führerloser Zug, der auf einen Abgrund zuraste, und keiner von uns konnte auch nur das Geringste tun, um ihn aufzuhalten.
Das Album erhielt den Titel Flow. Auf dem Cover war der Bandname abgedruckt; von den Buchstaben triefte Seifenlauge. Wir hassten es. Es sah aus wie eine Waschmittelwerbung. Ich war einerseits stolz auf das Album, weil es mein erstes war, doch gleichzeitig war ich bitter enttäuscht. Ich hatte erwartet, dass ich es aus der Hülle nehmen und auflegen würde und dann ebenso hingerissen wäre wie damals bei der Platte von Quincy Jones. Ich hatte dieselbe Aufnahmetechnik, denselben Tontechniker und denselben Produzenten zur Verfügung gehabt. Ich konnte nicht verstehen, warum es mir beim Hören meiner eigenen Platte nicht genauso kalt den Rücken hinunterlief. Die Enttäuschung wurde sogar noch größer. Wir hatten zwar eine stattliche Menge von Radioeinsätzen im Großraum New York, aber wir waren nicht „UKW-tauglich“, sodass uns viele Radiostationen wegen unserer langen Jazzsoli nicht spielten. Es machte schnell die Runde, dass wir schon ganz in Ordnung seien, aber eben nicht die Young Rascals. Mag sein, dass wir ein bisschen wie sie klangen und aussahen, aber in Sachen Vermarktung waren wir ein Albtraum, weil es keine Schublade für uns gab. Wir scharten eine eklektische Schar von Jazzfans um uns, anstatt die Massen anzusprechen, die in die Clubs gingen und Schallplatten kauften.
Niemand sprach mehr von einem Nachfolgealbum, und plötzlich wurden die Phasen ohne Arbeit immer länger. Obwohl wir einen gewissen Erfolg gehabt hatten, war dieser letztlich doch nicht durch die Musik, sondern von Drogen inspiriert gewesen. Unsere Manager waren frustriert. Sie hatten die begrenzten Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, mehr oder weniger abgegrast. Wenn wir einmal ein paar Auftritte an Land zogen, dann mussten wir am Ende hauptsächlich Coverversionen von fremden Songs spielen, um unsere Rechnungen bezahlen zu können. In der Hoffnung, dass die Leute begriffen, worum es uns ging, versuchten wir, ein paar von unseren eigenen Stücken im Programm unterzubringen. Manchen schienen sie zu gefallen, die Meisten jedoch wollten nur tanzen.
Ich begriff, dass wir New York verlassen und uns in einem Umfeld niederlassen mussten, das dem Songwriting zuträglicher war, um die Band einen Schritt weiter zu bringen. Mike war in der Woche zuvor nach Poughkeepsie gefahren, um einen Freund zu besuchen, und hatte in einer Kleinstadt namens Dover Plains ein kleines Schild mit der Aufschrift „Zu vermieten“ am Straßenrand entdeckt. Er notierte sich die Telefonnummer. Nachdem wir mit dem Eigentümer gesprochen und festgestellt hatten, dass wir uns die Miete leisten konnten, packten wir unsere Siebensachen in unseren Dodge-Lieferwagen und fuhren nach Norden. Bob Dylans Begleitband, The Band, war in ein modernes rosa Haus in West Saugerties in den Catskills gezogen und hatte dort ihr erstes Album, Music From Big Pink, aufgenommen. Das Haus, das wir vorfanden, war nicht rosa. Es war weiß, lag auf einem eineinhalb Quadratkilometer großen Gelände und wirkte wie aus Vom Winde verweht. Es kostete uns einhundertfünfzig Dollar im Monat – weitaus weniger als das winzige Apartment in New York.
Das Haus war riesig. Vier weiß getünchte dorische Säulen standen vor der Eingangstür, durch die man in eine beeindruckende Diele und ein großzügiges Treppenhaus gelangte. Es gab eine Bibliothek, fünf offene Kamine und einen Hauswirtschaftsraum. Den Dachboden hatte man zu einem Ballsaal für Partys umfunktioniert, mit Bühne und allem Drum und Dran. Das umliegende Land war zum größten Teil verwildert. Einiges davon war jedoch offensichtlich irgendwann einmal landwirtschaftlich genutzt worden, denn alles, was nun darauf wuchs, waren Zucchini in rauen Mengen. Verarmt und konstant hungrig, wie wir waren, gab es Zucchinibrei zum Frühstück, Zucchinibrote zum Mittagessen und mit Käse überbackene Zucchini zum Abendessen.
Wir lebten achtzehn Monate in dem Haus und wurden mit jedem Monat ärmer. Unsere Auftritte in New York schrumpften auf ein Minimum zusammen, und die Hälfte der Zeit konnte sich die Band ohnehin nicht dazu aufraffen, für lausige einhundert Dollar die beschwerliche Reise von insgesamt drei Stunden in die Stadt und wieder zurück auf sich zu nehmen. Oft hatten wir noch nicht mal ein Transportmittel. Wenn jemand den Lieferwagen nahm, um ein paar Drogen zu besorgen oder seine Freundin zu besuchen, stand der Rest von uns ohne Auto da.
Eines Tages waren Chuck Newcomb und ich im Haus, als uns der Tabak ausging und der Lieferwagen wieder einmal nicht da war. Da wir beide starke Raucher waren, blieb uns nichts übrig, als zu Fuß in die Stadt zu gehen und welchen zu kaufen. Wir machten uns auf in Richtung Dover Plains und versuchten nicht einmal zu trampen, da wir beide aus Erfahrung wussten, dass nur wenige Leute aus der Gegend zwei langhaarige, bärtige Hippies mitnehmen würden. Als wir in die Stadt schlenderten, fuhr der Sheriff an Chuck und mir vorbei. Er hielt an, drehte um und verhaftete uns. Man warf uns Gehen auf der falschen Straßenseite vor. Die Strafe betrug fünfundzwanzig Dollar.
Schließlich fuhr uns der Sheriff zurück zum Haus, wo unsere überraschten Bandkollegen sahen, wie der Streifenwagen in der Einfahrt hielt. Schnell rannten sie umher und versteckten alle Drogen. John Winter trat mit einer Flöte in der Hand aus dem Haus. „Was ist denn los?“, fragte er. Der Sheriff gab keinerlei Erklärung, sondern durchsuchte mit seinen Leuten das gesamte Haus von oben bis unten. Es dauerte eine Weile, bis er wieder rauskam, und man konnte ihm im Gesicht ablesen, wie enttäuscht er darüber war, dass er nicht Badewannen voller LSD gefunden hatte. Ich versuchte, die mittlerweile extrem angespannte Situation aufzulockern, wendete mich an John und sagte: „Hey, warum spielst du dem Polizisten zum Abschied nicht ein kleines Ständchen?“
„Hä?“, fragte John und schien rein gar nichts zu begreifen.
„Deine Flöte“, sagte ich und deutete auf das Instrument in seiner Hand. „Warum spielst du nicht etwas, um zu zeigen, dass niemand sauer zu sein braucht?“
John schüttelte den Kopf. „Nein, nicht jetzt. Meine Lippen fühlen sich nicht gut an, Mann. Ich kann jetzt gar nichts spielen.“
„Ach, komm schon“, drängte ich ihn, weil ich seinen Widerwillen und die Unzufriedenheit des Sheriffs gleichermaßen spürte. „Nur ein paar Töne.“
„Ja, spiel uns was“, ermunterte ihn nun auch der Sheriff. „Ihr behauptet doch, Musiker zu sein. Also lass mal was hören.“
John wich nicht einen Millimeter. „Nein“, sagte er mit fester Stimme. „Tut mir leid, ich bin gerade nicht in Stimmung.“
Als der Sheriff und seine Männer abzogen, waren Chuck und ich von den Strapazen des Tages fix und fertig. Alles, worauf wir uns nun noch freuten, waren ein Zucchiniomelett und eine elende Nacht, in der wir wieder einmal die Stummel aus den Aschenbechern klauben mussten. Gereizt, wie ich war, lief ich im Hausflur John über den Weg und schnauzte ihn an: „Wenn du auf deiner verdammten Flöte etwas für den Sheriff gespielt hättest, wäre das alles vielleicht nicht passiert“, sagte ich.
John zuckte mit den Achseln. „Es ging nicht, Mann“, erklärte er und zeigte auf ein zusammengeknülltes Etwas, das aus der Flöte herauslugte. „In der Eile haben wir den ganzen Stoff darin versteckt.“