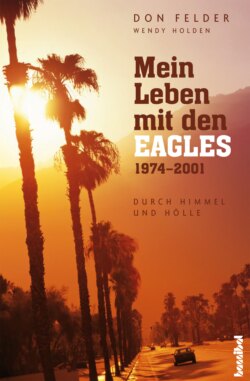Читать книгу Mein Leben mit den Eagles - Wendy Holden, Don Felder - Страница 11
ОглавлениеSECHS
Im August 1969 hörten wir per Mundpropaganda, dass auf einer zweieinhalb Quadratkilometer großen Milchfarm unweit von Dover Plains ein großes Musikfestival stattfinden sollte. Es wurde mit dem Slogan „Drei Tage des Friedens und der Liebe“ angekündigt und sollte in einem Ort namens Bethel in der Nähe von Woodstock stattfinden.
„Hey, da sollten wir hinfahren“, schlug ich meinen Zimmergenossen eines Morgens vor, nachdem jemand ein Flugblatt unter den Scheibenwischer des Lieferwagens geklemmt hatte. „Mehr oder weniger alle, die wir kennen, werden dort sein. Es kommen ein paar Jungs aus New York rauf, und vielleicht sogar aus Florida. Die Besetzung ist unglaublich: Janis Joplin, The Band, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, The Grateful Dead. Sogar Hendrix spielt.“
„Wahnsinn“, entgegnete Mike. „Okay. Organisier das.“
Als ich mich in die Liste der auftretenden Bands versenkte, entdeckte ich Crosby, Stills & Nash, deren Debütalbum, Suite – Judy Blue Eyes, rasch die Charts emporkletterte. Etwas sagte mir, dass sich der Pfad meines Lebens und der des jungen Stephen Stills auch in Zukunft kreuzen würden.
Ich hatte recht damit, dass alle nach Bethel kommen würden – am Schluss waren es eine halbe Million Menschen. Als wir mit einer Gruppe von Freunden aus New York in einem alten Chevrolet Suburban eintrafen, schien es, als versuchte jedermann, durch dasselbe zwei Meter breite Tor zu gelangen, auf das auch wir zusteuerten. Unter den Leuten in unserem Konvoi befand sich auch Season Hubley, das hübsche Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, als sie zwei Jahre zuvor nach Gainesville gekommen war. Leider war sie mit einem anderen dort. Ich wünschte, sie wäre mit mir zusammen statt mit ihm, was mir das gesamte Erlebnis des dreitägigen Festivals verdarb.
Ich kann mich erinnern, dass es häufig regnete. Es gab einen unglaublichen Sturm, der mit großen, geballten Wolken von Osten her heraufzog. Die kräftigen Winde bliesen beinahe die wackeligen Lautsprechertürme um. Wir schliefen in Schlafsäcken in dem Chevy und hörten zu, wie der sintflutartige Regen auf das Autodach prasselte. Als Sturm und Regen zu stark wurden, musste die gesamte Bühnenelektronik mit Plastikfolie abgedeckt werden, damit es zu keinem Kurzschluss kam. Abgesehen von dieser Unterbrechung, gab es nonstop Musik. Wir lagen hinten im Auto, waren total zugedröhnt und warteten gespannt, wer als Nächstes angekündigt werden würde.
„O Mann, das muss ich sehen“, sagte ich dann und raffte mich auf, stieg aus dem Wagen und schlitterte im Regen den rutschigen Hügel hinunter in Richtung Bühne. Dort lauschte ich den Klängen von Santana, Hendrix oder Alvin Lee, bis ich glaubte, mir müsste das Blut aus den Ohren schießen.
Es war eine Schlammschlacht, absolut grauenhaft, kalt und nass. Der klebrige Lehm drückte sich zwischen unseren Zehen empor und fand seinen Weg in jede Pore und jede Falte, aber das schien niemanden zu kümmern. Gemeinsam mit Tausenden anderer Menschen stand ich im strömenden Regen, wiegte mich im Takt zur Musik, dann kehrte ich zurück und trocknete mich ab. Die Autofenster beschlugen, bis die Matschkruste endlich getrocknet war. Woodstock war wirklich eine Erfahrung für sich.
Als wir nach dem Festival wieder zurück in Dover Plains waren, fiel es mir auf einmal nicht mehr ganz so leicht, unser Dasein zu ertragen. Ich hatte Stephen Stills als Jugendlichen gekannt, doch nun war er in Woodstock aufgetreten, um vier Uhr morgens, auf derselben Bühne wie die Großen des Rock ’n’ Roll, und hatte mit Leuten wie Graham Nash musiziert, den ich so bewundert hatte, als er mit den Hollies nach Gainesville gekommen war. Es war erst das zweite Mal, dass Crosby, Stills & Nash live zusammen spielten, aber sie waren verdammt heiß. Stephen saß auf einem Barhocker, trug einen blauweißen Poncho und sang mit seiner eindringlichen, leicht rauen Stimme. Es war mitreißend. Ich hätte alles dafür gegeben, hätte ich nur dort oben an seiner Seite sein können.
Stattdessen hing ich mit einem Haufen Kiffer in irgendeinem großen Haus in der Pampa herum und versuchte, eine Situation zu retten, von der ich genau wusste, dass sie aus dem Ruder lief. Ich fühlte mich menschlich und musikalisch völlig isoliert. Wir waren meilenweit von allem entfernt, und es gab keine Mädchen oder Freunde außerhalb der Band. Der Winter nahte, und wir waren pleite. Niemand schien zu begreifen, dass wir in diesem riesigen, unbeheizten Haus zu erfrieren drohten, wenn wir nicht schleunigst etwas unternahmen.
Der Winter kam und mit ihm der Schnee. So etwas hatte ich noch nie gesehen: In New York oder Boston waren vielleicht einmal ein paar Flocken gefallen, aber der Schneefall hier war so stark, dass er sich wie weiches, feines Puder vor unserer Vordertür anhäufte. Er roch nach Stahl. Zu Anfang war es ein Spaß, wir veranstalteten Schneeballschlachten und alberten herum. Als der Reiz des Neuen jedoch verflogen war, isolierte uns der Schnee in unserer ohnehin angespannten Situation nur noch mehr. Ohne jede Fluchtmöglichkeit waren wir nun tagein, tagaus zusammen im Haus gefangen. Die Spannungen zwischen uns traten immer deutlicher zutage. Jene bitteren letzten Monate erinnerten mich an mein letztes Jahr im Haus meiner Eltern, und es tat mir auf einmal leid, dass wir im Streit auseinandergegangen waren. Eines Tages in jenem Winter setzte ich mich an einen Schreibtisch, den ich aus alten Holzresten gezimmert hatte, die im Hof herumgelegen hatten. Ich nahm einen Stift und Papier und schrieb einen Brief an meine Mutter, in dem ich ihr mitteilte, wo ich war und dass alles in Ordnung sei. „Danke für all die Jahre, in denen Du mich unter schwierigen Lebensumständen großgezogen hast“, schrieb ich, „und für alles, was Du mich gelehrt hast. Erst jetzt beginne ich zu begreifen, was für eine gute Mutter Du mir warst.“ Ich dankte ihr sogar dafür, dass sie mich am Ohr in die Kirche gezerrt hatte. Ich versah den Umschlag mit meiner Adresse und warf ihn ein. Es war der erste Kontakt mit meinen Eltern seit zwei Jahren, und bald kam ein Antwortbrief mit der Post.
„Lieber Don“, schrieb sie. „Wie wundervoll, von Dir zu hören. Ich habe mich zu Tode geängstigt …“ So begann eine Korrespondenz mit ihr, die viele Jahre andauerte. Mein Vater schrieb nie ein Wort.
• • •
Ich begann zu begreifen, dass meine Träume, ein Musikstar zu werden, möglicherweise nichts als Luftschlösser waren. Es war das sogenannte „Ichjahrzehnt“ nach Vietnam, für mich indes liefen die Dinge nicht besonders gut. Unser einziges regelmäßiges Engagement war am Goddard College in Plainfield, Vermont, einer progressiven Einrichtung für freie Künste, die ein paar Hundert Kilometer nördlich lag. Wir erlebten dort Carlos Santana, wie er sein „Black Magic Woman“ spielte, was damals ein großer Hit war. Arlo Guthrie war Musikstudent am College, und sie hatten sogar eine Gamelangruppe, ein indonesisches Percussionorchester. Als wir eines Tages zu einem Auftritt am Goddard unterwegs waren, gab ich einem plötzlichen, dringenden Bedürfnis nach. Ich parkte den Lieferwagen neben einem Münzfernsprecher, kramte etwas Kleingeld hervor und wählte die Nummer von Susans Familie in Boston, die ich die ganze Zeit über im Kopf behalten hatte.
„Hallo, Mistress Pickersgill, hier spricht Don, Don Felder aus Gainesville. Ist Susan da?“
„Hallo, Don. Das ist ja eine ganze Weile her. Nein, mein Lieber, sie lebt nicht mehr hier. Sie hat eine eigene Wohnung gefunden. Möchtest du vielleicht ihre Nummer?“
Susan war sehr überrascht, von mir zu hören. Achtzehn Monate waren vergangen, seit wir das letzte Mal etwas voneinander gehört hatten. Sie hatte gerade mit ihrem letzten Freund Schluss gemacht, einem Sänger und Gitarristen, und arbeitete im Harvard History Research Center als Sekretärin. Wir plauderten, bis mir das Geld ausging, und ich versprach, sie wieder anzurufen. Eine Woche später tat ich es, dann wiederum eine Woche später. Es war ein gutes Gefühl, mit jemandem zu reden, der nicht die ganze Zeit total zugekifft war. Sie hatte einen guten Job und ihre eigene Wohnung – etwas, das ich mir niemals hätte leisten können. Ich war beeindruckt.
Ein paar Wochen darauf erzählte mir Susan, dass sie eine Weile im Haus ihrer Schwester in Scituate auf Cape Cod verbringen würde, um dort deren Kind zu hüten. „Willst du auch rauskommen?“, fragte sie mich. „Wir könnten uns wieder kennenlernen.“ Mein Leben war zu einem Trümmerhaufen geworden, also ergriff ich die Gelegenheit beim Schopf. Als das Wochenende an jenem wunderschönen Atlantikstrand zu Ende ging, war uns beiden klar geworden, wie sehr wir einander immer noch liebten. Es war, als wäre ich nach Hause gekommen.
In den nächsten Monaten pendelten Susan und ich zwischen Boston und Dover Plains hin und her und versuchten, die verlorene Zeit wieder wettzumachen. Anfangs war sie vom Gammlerleben, das ich führte, fasziniert – ich lebte in einem alten Herrenhaus, mit einer Band, die gerade eine Platte aufgenommen hatte, auf Zucchinidiät.
Nach einer Weile jedoch verflog dieser Zauber, und sie konnte die ganze unterschwellige Hässlichkeit sehen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Drogenmissbrauch. Als Jimi Hendrix und Janis Joplin in jenem Herbst unter Drogeneinfluss starben, fühlte ich mich wie damals, als JFK ermordet worden war: schockiert und ein bisschen verängstigt. Nicht einmal ein Jahr zuvor hatte ich beide noch in Woodstock auf der Bühne gesehen. Nun gab es sie nicht mehr, sie waren begraben, und mit ihnen waren auch ihre Zukunftsversprechen gestorben. Susan war der Ansicht, ich würde nun mit der Richtung, die ich in meinem Leben eingeschlagen hatte, zunehmend unzufriedener werden, wenn ich mich nicht von diesen Einflüssen befreite. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich mich von Flow trennte.
„Komm nach Boston“, drängte Susan. „Du kannst bei mir einziehen und dir einen Job suchen. Es wird schon ein bisschen Studioarbeit geben oder eine Band, die einen Gitarristen sucht.“
Ich wusste, dass sie recht hatte, aber ich brauchte noch ein paar Wochen, bis ich mir ein Herz fasste. Schließlich gab ich damit unseren Traum aus Woodstock auf, oder? Hatte ich Bernie nicht erklärt, dass dies vermutlich die beste Chance auf Erfolg war, die wir hatten? Warum war das alles nur schiefgegangen? Als mir der Dreck, die Apathie und die Lethargie schließlich zu viel wurden, rief ich Creed Taylor an.
„Hallo, Creed, hier spricht Don Felder von Flow“, sagte ich. „Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich dazu entschlossen habe, die Band zu verlassen. Es läuft nicht so, wie ich es mir wünsche, also muss ich einfach gehen.“
Creed schien keinesfalls überrascht und sagte, er verstehe mich. „Wo willst du hin?“, fragte er.
„Boston“, sagte ich. „Meine Freundin arbeitet in Harvard.“
„Super“, entgegnete er. „Hör zu, ich kenne ein paar Leute in Boston. Genauer gesagt, ich bin im Vorstand des Berklee College of Music. Wenn du willst, rufe ich dort an und schaue, ob ich dich dort unterbringen kann.“
Ich war angesichts dieser Großzügigkeit ebenso dankbar wie überrascht. „Okay, okay“, sagte ich. „Allerdings hatte ich nicht gedacht, gleich wieder die Schulbank zu drücken. Ich muss dringend etwas Geld verdienen.“
Creed lachte. „Ich habe auch nicht gemeint als Student, Don. Ich meinte als Lehrer. Du hast eine ganze Menge zu bieten, weißt du.“
Trotz seines offensichtlichen Vertrauens in mich war ich noch nicht ganz bereit dazu, mir meinen Bart abzurasieren, mein Haar kurz zu schneiden und ein Mitglied des Bildungsestablishments von Boston zu werden.
„Auf jeden Fall mal vielen Dank“, sagte ich, innerlich grinsend. Unwillkürlich musste ich mir vorstellen, wie ich in Kunstleder und Tweed gekleidet Jugendlichen das Gitarrespielen beibrachte. „Ich behalte dein Angebot im Hinterkopf, aber ich glaube, ich versuche erst mal, mir eine andere Band zu suchen.“
Die anderen Bandmitglieder waren über meine Entscheidung alles andere als glücklich. Sie betrachteten sie als Ausverkauf. Mike schnappte nach Luft, als ich es ihm sagte: „Was soll das heißen, du steigst aus? Wir stehen kurz davor, ganz groß rauszukommen.“
„Glaubst du das wirklich?“, fragte ich vernichtend. Ich ließ meinen Blick umherschweifen. Das Haus, das wir gemeinsam bewohnten, glich einer Müllhalde. Seit Monaten hatte niemand mehr ernsthaft geübt oder Songs geschrieben. „Oder stehen wir nur an der Schwelle dazu, fast bereit zu sein, uns ein paar erste Gedanken darüber zu machen, ob wir vielleicht ein paar Songs für ein mögliches zweites Album schreiben sollten? Wach auf, Mike, das hier wird nichts mehr.“
Aus ihrem Unmut heraus kam die Band bald auf ihr einziges Transportmittel zu sprechen. „Wenn du gehst, lässt du den verdammten Lieferwagen hier“, sagte John zu mir. „Wir haben keine Lust darauf, ohne fahrbaren Untersatz hier draußen festzusitzen.“
„Jawohl“, sagte Chuck und wendete sich mir in der Küche zu. „Und die Gitarre, die dir Gene gegeben hat, kannst du auch gleich hierlassen.“
„Ich lasse den Lieferwagen nicht hier, solange er noch auf meinen Namen eingetragen ist“, sagte ich hartnäckig und trat einen Schritt zurück. „Wenn ihr mit den Zahlungen nicht hinterherkommt, habe ich für den Rest meines Lebens eine schlechte Kreditbonität.“
Zu meinem Entsetzen ging Chuck auf mich los, aber Mike hielt ihn zurück. „Hey, Mann, spiel hier nicht den Verrückten“, schrie er. „Das lässt sich alles regeln.“
Mit weit mehr Groll, als nötig gewesen wäre, wurde der Wagen schließlich auf Andy Leo umgeschrieben, und ich durfte gehen. Ich packte meine Sachen und verließ dieses Haus, während der Rest der Band auf der Veranda stand und mir schweigend zusah. Wir waren übereingekommen, dass ich mit dem Wagen bis nach Boston fahren durfte, um meinen Kram zu transportieren. Chuck sollte mich quasi als Rückversicherung begleiten und ihn wieder zurückbringen. Als wir aus der gewundenen Kieseinfahrt hinausfuhren, blickte ich noch einmal zurück und wünschte, es wäre zu einem glücklicheren Ende gekommen.
„Wo sind der ganze Frieden, die Liebe und die Fröhlichkeit geblieben?“, fragte ich Chuck.
Er war viel zu high und zu wütend, um zu antworten.
• • •
Boston war eine ganz andere Welt. Susan und ich lebten glücklich zusammen in ihrer kleinen Souterrainwohnung auf der Commonwealth Avenue, doch es fiel mir anfangs schwer, ohne eine Band, in der ich spielen konnte, wieder in einer Stadt zu sein. Es war 1970, das Jahr, in dem sich die Beatles trennten, und sosehr ich auch erleichtert war, dass sich das Kapitel Flow erledigt hatte, so wurde ich doch das Gefühl nicht los, die Orientierung verloren zu haben. Ich nahm fast jeden Job an, der mit Musik zu tun hatte, nur um finanziell über die Runden zu kommen. Zum Dinner im Holiday Inn auf dem Harvard Square spielte ich sogar von sechs bis neun Uhr abends Filmmelodien auf einer Nylonsaitengitarre. Die meisten Songs, die man mich zu spielen bat, kannte ich nicht einmal. Irgendein Typ kam an und sagte: „Hey, heute ist unser Hochzeitstag. Kannst du das Lieblingslied meiner Frau spielen? Es ist ‚The Shadow Of Your Smile‘. Sie mag es unheimlich gern.“
„Klar“, entgegnete ich dann mit einem dümmlichen Grinsen. „Nach der nächsten Pause.“
Meine „Pause“ verbrachte ich dann in meiner „Garderobe“ (einer schäbigen Ecke der Hotelküche; direkt neben mir schälten sie die Kartoffeln), wo ich mich in ein Notenbuch mit Songs und Melodien vertiefte, die Akkorde lernte und sie übte. Wenn ich dann zwanzig Minuten später wieder herauskam, konnte ich die Nummer spielen, als ob ich sie im Schlaf beherrschte – und bekam meine fünf Dollar Trinkgeld.
Es war mir schmerzlich bewusst, dass dies nicht gerade das war, was ich mir als Karriere vorgestellt hatte, und so versuchte ich, mit so vielen anderen Musikern wie möglich in Kontakt zu kommen. Boston war jedoch nicht gerade der Mittelpunkt des musikalischen Universums, und es gab nicht besonders viel zu tun. Dennoch lernte ich ein paar interessante Leute kennen. Einer davon war ein Engländer namens Peter Green, der kurz zuvor den größten Teil seines Geldes weggegeben und die Band verlassen hatte, die ihn berühmt gemacht hatte – Fleetwood Mac. Ich traf ihn während einer Jamsession bei einem Gratiskonzert im Park. Wir kamen ins Gespräch, und ich erfuhr, dass er eben erst in der Stadt eingetroffen war und keinen Platz zum Schlafen hatte.
„Du kannst eine Weile bei mir unterkommen, wenn du magst“, sagte ich zu ihm. Er hatte etwas in seinen Augen, das mich ihm vertrauen ließ. Er kam mit mir nach Hause und schlief ein paar Tage lang auf unserem Sofa. Wir spielten ziemlich viel zusammen – er war ein großartiger Bluesgitarrist. Er hatte einen breiten Cockney-Akzent und einen hintergründigen Humor. Wir entdeckten sogar eine gemeinsame Leidenschaft für B. B. King. Er nahm jedoch für meinen Geschmack zu viele bewusstseinsverändernde Substanzen, und dann war er eines Tages einfach verschwunden, sodass nichts aus unserer Zusammenarbeit wurde. Ich hörte später, dass er nun ganz auf dem religiösen Trip sei und den Rest seines Geldes für wohltätige Zwecke gespendet habe.
Ich fand einen Job für fünfzig Dollar die Woche in einem preiswerten Tonstudio namens Triple A. Meine Aufgabe war es, die Sessionmusiker für die Aufnahmen zu buchen, darunter viele Studenten des Berklee College of Music. Einer von ihnen war Abraham „Abe“ Laboriel, der seitdem zu einem der gefragtesten Studiobassisten im Jazz und Pop geworden ist. Wenn er zu spielen begann, spitzten alle die Ohren. Abe und ich wurden Freunde, und ich buchte ihn, so oft ich konnte.
Joe, der Eigentümer, betrieb das Studio wie ein Uhrwerk. Er war ein Meister der Überredungskunst, wenn es darum ging, Leuten weiszumachen, dass ihnen eine Karriere als Sänger bevorstünde – selbst wenn er wusste, dass sogar ein Hund besser sang. Er schaltete Anzeigen in Zeitungen, in denen er nach neuen Talenten suchte. Darauf meldeten sich alle möglichen Leute, von der gelangweilten Hausfrau bis zum Stadtbusfahrer. Er überzeugte sie allesamt davon, dass sie die neue Streisand oder der neue Sinatra seien und es ihre beste Chance auf Erfolg sei, ein Soloalbum bei ihm aufzunehmen. Wenn sie das Studio verließen, schwebten sie förmlich auf dem Traum, dass er sie zu Stars machen würde.
Abends und am Wochenende hatte ich noch zwei weitere Jobs in zwei anderen Studios, wo ich Werbejingles für Autohäuser und Fabrik-Outlets schrieb. Ich spielte Gitarre und dazu ein bisschen Klavier und Schlagzeug, dann erfand ein Jinglesänger einen Text zu meiner Aufnahme. Eines der Studios hieß Ace. Der Sohn des Eigentümers, ein Jugendlicher namens Shelly Yakus, kam oft vorbei und fegte zusammen, rollte die Kabel auf und sah mir bei der Arbeit zu. Heute ist er einer der besten Tontechniker im Musikgeschäft, der Platten mit Größen wie Bruce Springsteen und U2 macht. Jahre später liefen wir einander über den Weg, und wir erkannten uns sofort.
Ich arbeitete Tag und Nacht, verdiente aber praktisch kein Geld. Den ganzen Tag lang arbeitete ich bei den Sessions und spielte dann noch von neun bis zwei in einem Club Rhythm and Blues. Es war ein elendes Leben, nicht zuletzt deshalb, weil ich nie Zeit für Susan hatte. Ich begann mich ernsthaft zu fragen, ob ich nicht meinen ersten Job als Musiklehrer wieder aufnehmen oder sogar etwas vollkommen anderes machen sollte. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee kam – vielleicht durch das schwierige Verhältnis zu meinem Vater –, aber ich begann, Abendkurse in Kinderpsychologie an der Universität von Boston zu besuchen. Es war nicht leicht, wieder die Schulbank zu drücken, aber mein Bruder Jerry – zu dem ich wenig oder gar keinen Kontakt hatte – erfuhr von meiner Mutter, was ich machte, und schickte mir aus heiterem Himmel einen Scheck über fünfhundert Dollar.
„Ich dachte, du könntest das gut gebrauchen, um dich die nächsten paar Monate über Wasser zu halten“, schrieb er. „Ich weiß, wie schwer man es als Student manchmal hat.“ Diese Geste der Zuneigung werde ich nie vergessen. Ich rief ihn an, dankte ihm aus tiefstem Herzen und versprach, ihm das Geld eines Tages zurückzuzahlen. (Viele Jahre später tat ich das tatsächlich und berechnete sogar die Zinsen, die er für das Geld, das er mir geliehen hatte, bekommen hätte, doch er sendete mir den Scheck mit der Notiz zurück, er sei stolz darauf, in meine Karriere investiert zu haben.)
Hin und wieder kam Bernie in die Stadt, und ich freute mich stets, ihn zu sehen. Er hatte eine Weile in Linda Ronstadts Begleitband gespielt, doch der entscheidende Wendepunkt in seiner Karriere kam erst, als er sich einer Gruppe namens The Flying Burrito Brothers anschloss, die von Gram Parsons geleitet wurde. Sie hatten bereits ein erfolgreiches Album eingespielt und waren nun im Rahmen einer bundesweiten Tournee unterwegs an der Ostküste. Susan und ich gingen zu ihrem Konzert. Sie waren großartig.
„Du musst hier raus, Mann“, sagte Bernie nach dem Konzert zu mir auf dem Rückweg zu seinem Hotel. „Du hast was Besseres verdient, als Autojingles zu schreiben. Du bist ein klasse Gitarrist, Don. Du musst in den Westen gehen.“ Susans Gesicht sagte mir alles, was ich wissen musste. Sie stammte aus Boston, sie war gern in der Nähe ihrer Familie, und wenn ich weiterhin mit ihr zusammenbleiben wollte, dann musste ich eben in Boston bleiben.
„Ich habe eine tolle kleine Doppelhaushälfte in Hingham gefunden, Schatz“, erzählte sie mir an einem Winterabend im Januar 1971. „Es liegt ganz in der Nähe von dem Haus, wo ich aufgewachsen bin.“
„Weiß nicht“, sagte ich. „Ich bin nicht sicher, wie lange ich dieses Arbeitstempo noch durchhalten kann, und ich möchte auch nicht unbedingt aus der Stadtmitte von Boston wegziehen und noch mehr Miete bezahlen.“
Sie sah zu mir auf und blickte mich mit ihren großen blauen Augen an. Ich konnte nicht widerstehen. „Okay“, stimmte ich zu. „Wenn du unbedingt willst.“
Susans Mutter, die mich immer gemocht hatte und stets freundlich zu mir gewesen war, fand plötzlich, dass dies nun einen Schritt zu weit ging. Hingham war ein schmucker Vorort von Boston fünfundzwanzig Kilometer weiter südlich an der Küste – und, was noch wichtiger war, sie lebte immer noch dort.
„Du ziehst mir nicht wieder zurück in deine Heimatstadt, um hier in Sünde zu leben!“, sagte sie entsetzt zu Susan, als wir ihr die Nachricht überbrachten. „Entweder du heiratest und lebst ein anständiges Leben, oder du kannst dir einen anderen Platz zum Leben suchen.“
Wir hatten die Doppelhaushälfte bereits besichtigt und zugesagt, sie zu nehmen. Außerdem hatten wir unsere alte Wohnung gekündigt. Draußen war es bitterkalt, es schneite, und ich wusste, dass es unwahrscheinlich war, dass wir für unser Budget zu dieser Jahreszeit etwas vergleichbar Hübsches finden würden.
Ich sagte nichts, borgte mir fünf Dollar von Susan und ging in ein Juweliergeschäft in der Nähe von Harvard. Als sie später am Abend von der Arbeit nach Hause kam, zog ich einen Verlobungsring aus der Tasche und platzte heraus: „Willst du mich heiraten?“
„Ja, natürlich will ich, du Dussel“, war ihre lachende Antwort. Es war sehr unromantisch und so ganz und gar nicht, was sie oder ich uns vorgestellt hatten. Ich hatte das Gefühl, dass wir es nur ihrer Mutter zuliebe taten. Bis zum heutigen Tag bin ich mir nicht sicher, ob Susan und Mistress Pickersgill das Ganze nicht gemeinsam ausgeheckt hatten, um mich dazu zu bewegen, Nägel mit Köpfen zu machen. Wie auch immer, es funktionierte, und ich habe es nie bereut.
Die Hochzeit wurde für den 23. April 1971 festgelegt. Meine Eltern, die ich nicht gesehen hatte, seit ich von zu Hause weggegangen war, wollten gemeinsam mit meinem Bruder Jerry von Gainesville herfahren. Ich hatte Jerry gebeten, mein Trauzeuge zu sein. Außer ihnen würde auf meiner Seite der Kirche sonst wohl niemand sitzen – Bernie konnte nicht kommen, weil er auf Tournee war, und die meisten meiner alten Freunde aus Gainesville hatte ich aus den Augen verloren. Susan hingegen hatte an die einhundert Gäste eingeladen.
Mein Vater hielt vor unserem Apartment. Er fuhr einen weißen, viertürigen Oldsmobile, für den er den grünen Pontiac in Zahlung gegeben hatte. Ich stand da, mit schulterlangem Haar, Koteletten und einem Schnurrbart, und fühlte mich wie ein unartiges Kind, als er mir auf dem Bürgersteig entgegenkam, um mich zu begrüßen. Genau in diesem Augenblick kreuzten zwei der freizügigsten Homosexuellen, die ich je gesehen hatte, unseren Weg. Einer trug rote Hotpants und hochhackige Schuhe und hatte den Arm um die Hüfte des anderen gelegt. Ich hatte sie noch nie in meinem Leben gesehen. Meinem Vater fiel die Kinnlade fast bis auf den Asphalt.
Ich begann zu sprechen: „Willkommen in Boston, Papa … Papa?“ Ich konnte sehen, dass ihm der Kopf schwirrte. All seine schlimmsten Albträume wurden wahr. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er es vorzog, nichts zu sagen – wenn es mir auch nicht entging, dass er meine ausgestreckte Hand nicht ergriff.
Wir führten sie in unsere kleine Wohnung mit dem Bett in der Ecke, einem wackeligen Tisch und zwei Stühlen in dem kleinen Erkerfenster, einer schäbigen Couch, einer kleinen Küchenzeile und einem winzigen Badezimmer. Susan setzte eine Kanne Kaffee auf. Mama gab genau die richtigen Töne von sich und zeigte sich ganz begeistert von der Hochzeit und der Tatsache, dass sie Susan und ihrer Mutter bei den Vorbereitungen helfen konnte. Papa war nicht feindselig, nur gleichgültig, und natürlich sprachen wir nie darüber, was sich ereignet hatte, als wir einander das letzte Mal gesehen hatten.
„Verdienst du genug?“, fragte er und sah sich in unserer Wohnung um, als wäre ihm ein unangenehmer Geruch in die Nase gestiegen.
„Ja“, entgegnete ich unsicher.
„Gut.“
Er schien sich auf seine eigene Art und Weise für mich zu freuen, aber ich konnte spüren, dass er meinen Lebensstil immer noch missbilligte, obwohl er meine Beziehung mit Susan und die Hochzeit von ganzem Herzen guthieß.
Die Hochzeit sollte in einer historischen Kirche nördlich von Boston stattfinden. Susans Mutter wollte, dass wir dort heirateten. Meine Eltern stiegen in einem billigen Hotel irgendwo in der Nähe ab. Susan wollte das einhundert Jahre alte Hochzeitsgewand ihrer Großmutter tragen, das auch ihre Mutter getragen hatte. Ihre Kombination wurde von einem großen weißen Hut mit Spitzen gekrönt. Da ich keinen Anzug besaß und Jeans und T-Shirt offensichtlich nicht gestattet waren, zerrten mich Jerry und Susans Bruder Bill in ein preisgünstiges Geschäft, wo man mir einen grauen Nadelstreifenzweireiher und ein Paar anständige Schuhe verpasste. Beides zog ich nie wieder an.
Bei der Zeremonie selbst war ich weit weniger nervös. Es gelang uns sogar, unsere eigenen Gelübde zu sprechen – wir dachten, das wäre ziemlich cool. Der Empfang fand in einem nahe gelegenen Freizeitheim statt. Eine halbwegs passable Highschoolband schrammelte in der Ecke. „Spielt bitte nicht ‚Louie Louie‘“, wies ich sie an. Den Song zu hören, den ich in Daytona Beach hundertmal gespielt hatte, wäre einfach zu bedrückend gewesen. Die Frauen der Familie Pickersgill machten das ganze Essen und den Hochzeitskuchen. Wie es das Zeremoniell verlangte, schnitten wir ihn an, bevor wir in unserem Wagen flüchteten. Es war ein rostiger weißer Volvo, Baujahr 1965, mit einhundertneunzigtausend Kilometern auf dem Tacho. Susans Schwager Bobby hatte ihn mit Rasierschaum verziert und an der hinteren Stoßstange Blechdosen und Papierschlangen befestigt.
Kurz bevor ich abfuhr, schüttelte mir Papa die Hand. „Nun, du hast jetzt eine Verantwortung, Don“, sagte er streng. „Sieh zu, dass du ihr auch nachkommst.“ Mama weinte, als wir einander zum Abschied umarmten, und rang mir das Versprechen ab, sie zu besuchen. Jerry wünschte mir alles Gute, und ich dankte ihnen für ihr Kommen.
Wir fuhren zurück in unser neues Zuhause in Hingham, und ich trug Susan über die Schwelle. „Wo ist die Heiratsurkunde?“, fragte ich sie, sobald wir drin waren.
„Warum?“, fragte sie. Sie öffnete ihre Handtasche und gab sie mir.
Bevor sie etwas sagen konnte, nahm ich einen Hammer und einen Nagel aus meiner Werkzeugkiste und nagelte die verdammte Urkunde an die Schlafzimmertür, damit uns niemand mehr dumme Fragen stellen konnte.
„Jetzt ist es offiziell“, sagte ich zu ihr. „Wir sind jetzt angesehen genug, um hier zu leben.“
Im Alter von dreiundzwanzig Jahren war ich ein Ehemann. Die Verantwortung schien erdrückend.
Wir hatten nicht viel Geld, aber wir waren jung, verliebt und lebten in einer Doppelhaushälfte neben einem Friedhof. Das Leben schien plötzlich süß. Aus dem örtlichen Tierheim retteten wir eine weiße Schäferhundmischung mit großen Schlappohren. Wir nannten ihn Kilo, nach einem Kilo Gras. Er bewachte tagsüber die Wohnung, wenn wir bei der Arbeit waren, und leistete Susan Gesellschaft, wenn ich abends in den Clubs spielte.
Es machte Susan nichts aus, dass sie die Haupternährerin war und ein regelmäßiges Einkommen nach Hause brachte, während ich mich in der Stadt herumschlug, Sessionjobs machte und auf der Suche nach mehr Beschäftigungsmöglichkeiten die Studios abklapperte. Da mir Bernies erstaunliche Vielseitigkeit immer noch im Kopf rumging, versuchte ich laufend, meine musikalischen Fähigkeiten weiter zu verbessern, um meinen Marktwert zu steigern. Ich nutzte das Equipment, das mir zur Verfügung stand, und brachte mir selbst die Grundlagen des Schlagzeug-, Keyboard- und Bassgitarrespiels bei. Außerdem lernte ich, wie man Bänder abmischt und Overdubs aufnimmt. Meinen Job tagsüber konnte ich zwar nicht aufgeben und dafür eines meiner neuen Instrumente spielen, aber ich kam zurecht. Ich wünschte mir nur, dass ich mit meinen neuen Fähigkeiten etwas Sinnvolles anfangen könnte.
„Du bist ein Musiker, Don“, sagte Susan nüchtern zu mir, wenn ich spät und müde von einem Club zurückkam und sie mir Kaffee machte. „Was willst du denn sonst tun?“
Trotz meines immensen privaten Glücks litt ich unter dem Gefühl, dass der Zug irgendwie abgefahren war. Dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als John Winter, der ehemalige Keyboarder und Saxofonist von Flow, anrief und fragte, ob er bei uns übernachten könne. Er war gerade aus einer psychiatrischen Einrichtung im Bundesstaat New York entlassen worden, in die man ihn wegen drogenbedingter emotionaler Störungen eingewiesen hatte. Er brauchte schnell ein Versteck, bevor sich seine Mutter und seine Schwester seiner annehmen konnten. Seine Erscheinung schockierte mich. Er schien nur noch die Hülle des begabten jungen Mannes zu sein, der er einmal gewesen war. Ich rief seine Familie an, um sie wissen zu lassen, dass er in Sicherheit war. Wir kümmerten uns um ihn und gaben ihm etwas Geld.
„Hast du mal was von den anderen Jungs gehört?“, fragte ich.
„Nicht viel“, sagte er verdrießlich. „Alles, was ich weiß, ist, dass Mike Burnett nach Woodstock gezogen ist und dort seine Zeit mit Malen und Drogen verbringt. Andy Leo lebt in einer Hippiekommune auf Hawaii.“ Um Gottes willen, dachte ich.
Bernie hingegen hatte mit den Flying Burrito Brothers einen Erfolg nach dem anderen; Stephen Stills war ein etablierter Rockstar mit einem millionenfach verkauften Album, auf dem Eric Clapton, Jimi Hendrix und Ringo Starr vertreten waren; die beiden Allman Brothers hatten sowieso einen unglaublichen Höhenflug. Dann kam Duane Allman in jenem Herbst bei einem Motorradunfall ums Leben. Die Band hatte gerade ihren Albumklassiker At Fillmore East aufgenommen und war mit dem nächsten, Eat A Peach, bereits halb fertig.
Die Nachricht war ein fürchterlicher Schlag für all jene von uns, die Duane gekannt und geliebt hatten. Wahre Schockwellen gingen durch die Musikergemeinde. Eric Clapton verkündete, er sei – wie ich – erst durch Duane Allman zur Slidegitarre inspiriert worden. Duane hatte großen Anteil an Layla And Other Assorted Love Songs von Derek And The Dominoes gehabt und während der gesamten Aufnahmen unter Strom gestanden. Auf der Bühne spielte er Slidegitarre ohne einen einzigen falschen Ton, was wirklich schwierig ist. Als ich es zum ersten Mal hörte, dachte ich: „O mein Gott – Clapton ist Gott, aber Duane ist der zweite Gott, das ist einfach zu viel!“ Noch heute muss ich jedes Mal, wenn ich diesen unverkennbaren Gitarrensound höre, an ihn denken. Duane war in meinem Alter. Es kam mir vor, als wären wir gemeinsam aufgewachsen.
Er hatte mich so vieles gelehrt. „Schließ die Augen, und hör ganz auf die Musik, Mann“, hatte er einmal zu mir gesagt. „Du musst sie in deinem Herzen fühlen, und wenn es dir kalt den Rücken runterläuft, dann weißt du, dass alles stimmt.“ Der Gedanke, ihn nie wieder spielen zu hören, war beinahe ein körperlicher Schmerz.
Im Sommer darauf kam Stephen Stills nach Boston. Crosby, Stills, Nash & Young hatten sich für eine Weile getrennt, um eigene musikalische Wege gehen zu können. Stephen hatte eine Band mit dem Namen Manassas gegründet, zu der auch ein großartiger Pedal-Steel-Gitarrist namens Al Perkins und Bernies Freund Chris Hillman von den Flying Burrito Brothers gehörten. Ich war über die Aussicht, Stephen wiederzusehen, hocherfreut und ging zu seinem Konzert, um ihn spielen zu hören. Er war klasse. Er besaß immer noch diese unverkennbare Stimme und die Fähigkeit, sein Publikum zu begeistern. Die Band spielte sehr gut zusammen, und die Show war beeindruckend.
High vom Adrenalin und der Musik, schlenderte ich in den Garderobenbereich. Es gab so viel zu besprechen. Ich fragte mich, ob er sich wohl an unseren verrückten Abend in Palatka erinnern würde, als wir Jack Daniel’s getrunken hatten und auf dem Bett herumgesprungen waren, oder ob er noch Kontakt zu Jeff hatte, dem Schlagzeuger der Continentals.
Ein Gorilla in einer Sicherheitsweste stellte sich mir in den Weg. „Wo willst du hin?“, knurrte er.
„Ach, ich muss mit Stephen Stills sprechen.“
„Warum?“
„Ich bin ein alter Freund von ihm“, grinste ich.
Er wirkte immer noch äußerst skeptisch.
„Wir haben in Florida in derselben Band gespielt.“ Immer noch keine Regung.
„Hör zu, sag ihm einfach, Don Felder würde ihn gern sprechen, okay?“
Es kostete mich einige Überredungskunst, bis er meiner Bitte nachkam. Ich wartete zusammen mit ein paar hoffnungsvollen Fans, zuversichtlich, dass mein Bote jeden Augenblick mit einem Backstagepass zurückkehren und sich entschuldigen würde.
Schließlich kam er zurückgeschlendert und nahm seinen Posten wieder ein. Sein Gesicht war so leer wie zuvor. Er sagte kein Wort.
„Und?“, fragte ich nun etwas ungeduldig.
„Nichts und“, sagte der Affe. „Mister Stills ist im Augenblick zu beschäftigt, um dich zu empfangen.“
• • •
In den nächsten paar Monaten fiel ich in ein emotionales Loch. Ich begann mich zu fragen, ob mein Vater nicht vielleicht doch recht hatte. Ich war verheiratet, fast fünfundzwanzig, und wenn ich es bis jetzt nicht geschafft hatte, würde ich es vermutlich nie schaffen. Vielleicht gab es für mich in der Musik keine Zukunft, und vielleicht hätte ich aufs College gehen sollen, wie es mein Vater immer gewollt hatte. Dann hätte ich wenigstens etwas, worauf ich zurückgreifen könnte. Dann rief mich eines Tages einer meiner Freunde an, den ich aus New York kannte, ein großartiger E-Bassist.
„Hey, Don, ich bin in Boston“, sagte er mir am Telefon. „Ich trete vor Delaney & Bonnie auf, weißt du, dieser Ehepaarband, die mit Eric Clapton und George Harrison zusammengearbeitet hat. Warum kommst du nicht zum Konzert? Wir spielen auf dem Collegecampus.“
Ich war beeindruckt. Delaney Bramlett und seine Frau Bonnie wurden mit einigen ziemlich legendären Namen im Musikgeschäft in Verbindung gebracht, und obwohl sie nicht mehr ganz so viele Schlagzeilen machten, seit Clapton das Projekt verlassen hatte, interessierte mich ihre einzigartige Mischung aus Gesang, Bläsern und Percussioninstrumenten immer noch sehr. Auf Bitten meines Freundes ging ich ein bisschen früher hin und schlenderte in die Garderobe, um erst einmal ein wenig mit ihm zu jammen. Dort saß er mit dem Bassisten der Band zusammen, der auf einem alten Gibson leise vor sich hin spielte. Gleichzeitig entdeckte ich eine elektrische Gitarre, die an der Wand lehnte.
„Was dagegen, wenn ich mitmache?“, fragte ich.
„Überhaupt nicht.“
Ich war es durch meine Studioarbeit gewöhnt, spontan mit anderen Musikern zusammenzuspielen. Also dachte ich mir nichts weiter dabei, schnappte mir die Gitarre und spielte mit diesem Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich hatte keinerlei Berührungsängste; es gab musikalisch nichts, was mich noch überraschen konnte. Ich dachte, ich hätte nichts zu verlieren – schlimmstenfalls würde man mich am Hosenboden packen und vor die Tür setzen.
Der Bassist spielte sehr gut, und wir hatten eine Menge Spaß. Einer nach dem anderen trudelten auch die übrigen Bandmitglieder in der Garderobe ein, angezogen von der Musik. Nach einer Weile zündete jemand einen Joint an, jemand anderes öffnete ein paar Bierflaschen, und wir hatten viel Spaß.
„Hey“, sagte Delaney, als wir schließlich doch irgendwann ein Ende fanden und alle spontan applaudierten. „Warum kommst du heute Abend nicht zu uns auf die Bühne und spielst mit?“
„Was?“, fragte ich verblüfft.
„Ja, auf geht’s, das wird ein Spaß“, fügte seine Frau hinzu. Sie war eine hübsche kleine Frau mit kurzem blondem Haar.
„Oh, okay, ich meine, klar“, sagte ich und zuckte mit den Schultern. Später am Abend wurde ich als „Neuentdeckung“ von Delaney & Bonnie angekündigt. Ich spielte Blues mit ihnen. Es war ein großartiger Auftritt, alles war ganz spontan und machte einfach Spaß, wie zu besten Flow-Zeiten. Es hob meine Stimmung ungeheuer.
Musik war das, worin ich gut war, sagte ich zu mir selbst. Seit ich vor langer Zeit in meinem Zimmer Stücke von Chet Atkins geübt hatte, war ich stets dann am glücklichsten gewesen, wenn ich Gitarre spielte, und es hatte mir noch nie so viel Spaß gemacht wie jetzt. Nach dem Konzert lud mich die Band überraschend ein, mit ihnen auf Tournee zu gehen.
„Wann?“, fragte ich, begeistert von dieser Aussicht. Wenn eine Tournee mit ihnen über ein paar Wochen auch nur halb so viel Spaß machte wie dieser Auftritt, sah ich keinen Grund, warum ich nicht zusagen sollte. Ich war sicher, Susan würde nichts dagegen haben, wenn ich eine Weile weg wäre, und in den Studios würde man mir vermutlich einige Zeit freigeben.
„Morgen früh“, entgegneten sie strahlend. „Um vier Uhr in der Frühe brechen wir mit dem Bus zu einer dreimonatigen bundesweiten Tournee auf.“
Mein Mut verließ mich. Ich wusste, dass ich so kurzfristig nicht gehen konnte. Außerdem waren drei Monate viel zu lang. Ich hätte es nicht ertragen, von Susan getrennt zu sein.
„Tut mir leid, Jungs“, sagte ich und schüttelte traurig den Kopf. „Ich bin verheiratet. Ich habe eine Verantwortung. Es geht einfach nicht.“
Mit offensichtlichem Verdruss sagten sie, sie hätten dafür Verständnis. Zum zweiten Mal in meinem Leben sah ich zu, wie mir eine großartige Gelegenheit durch meine Gitarre spielenden Finger rann.